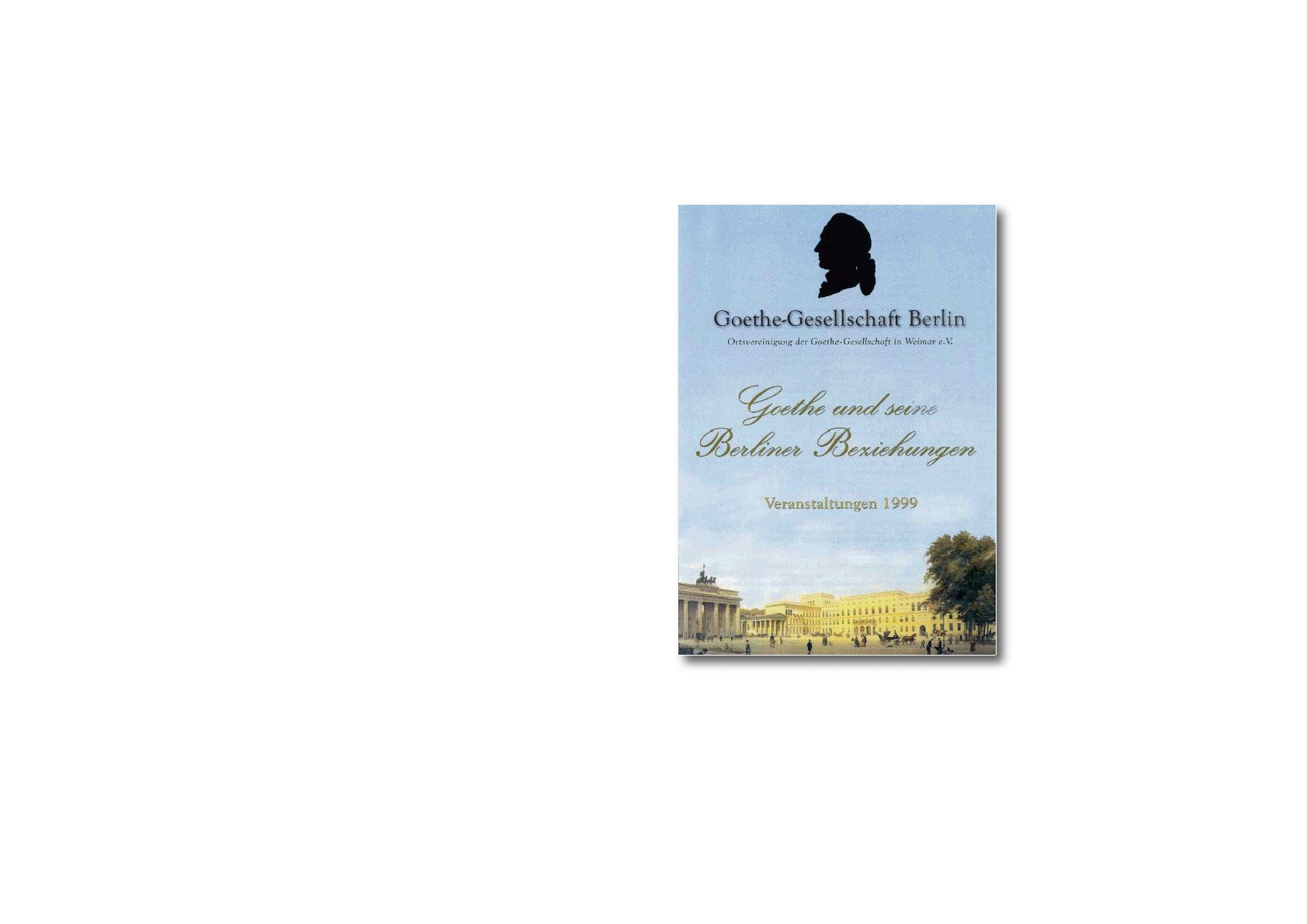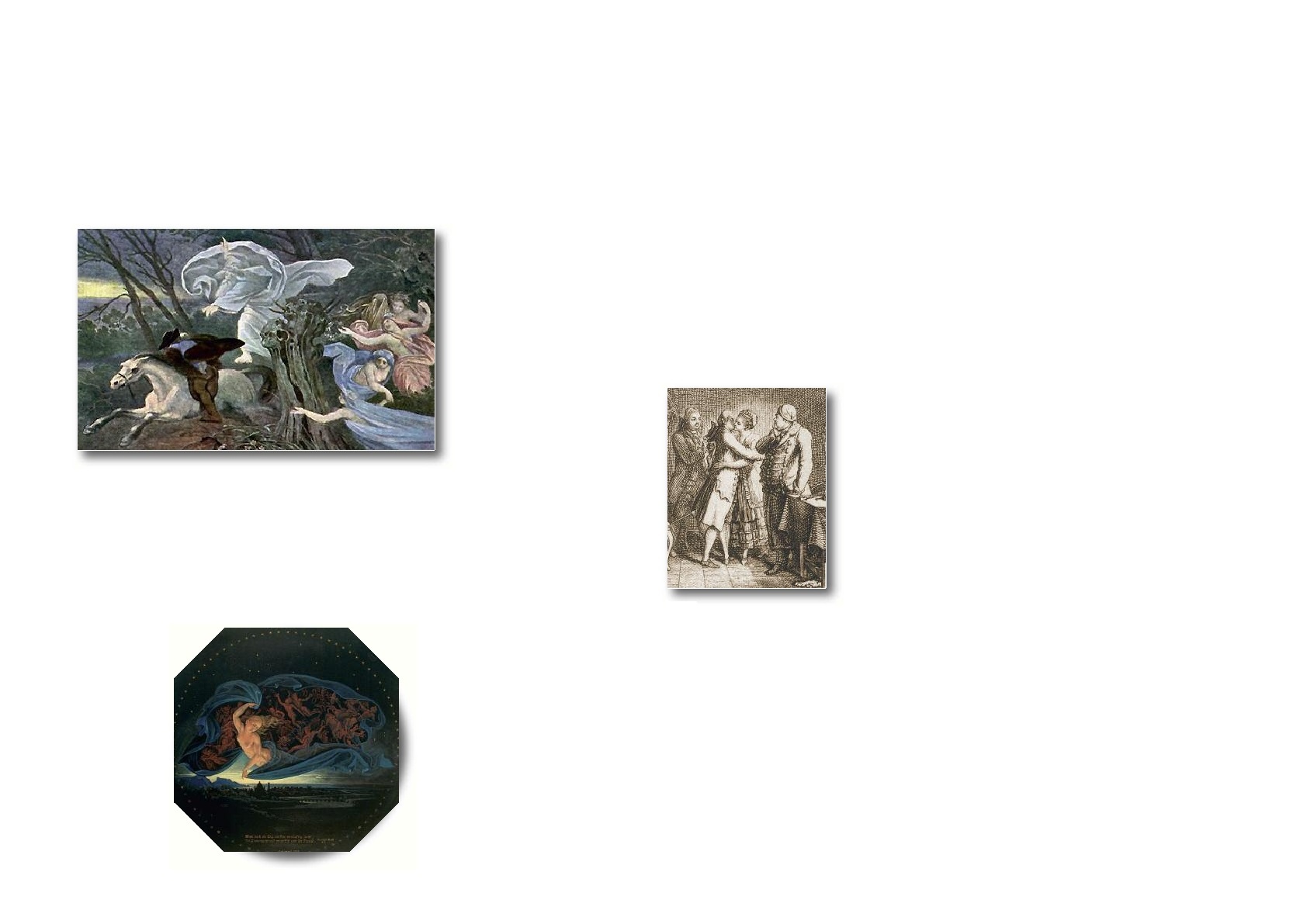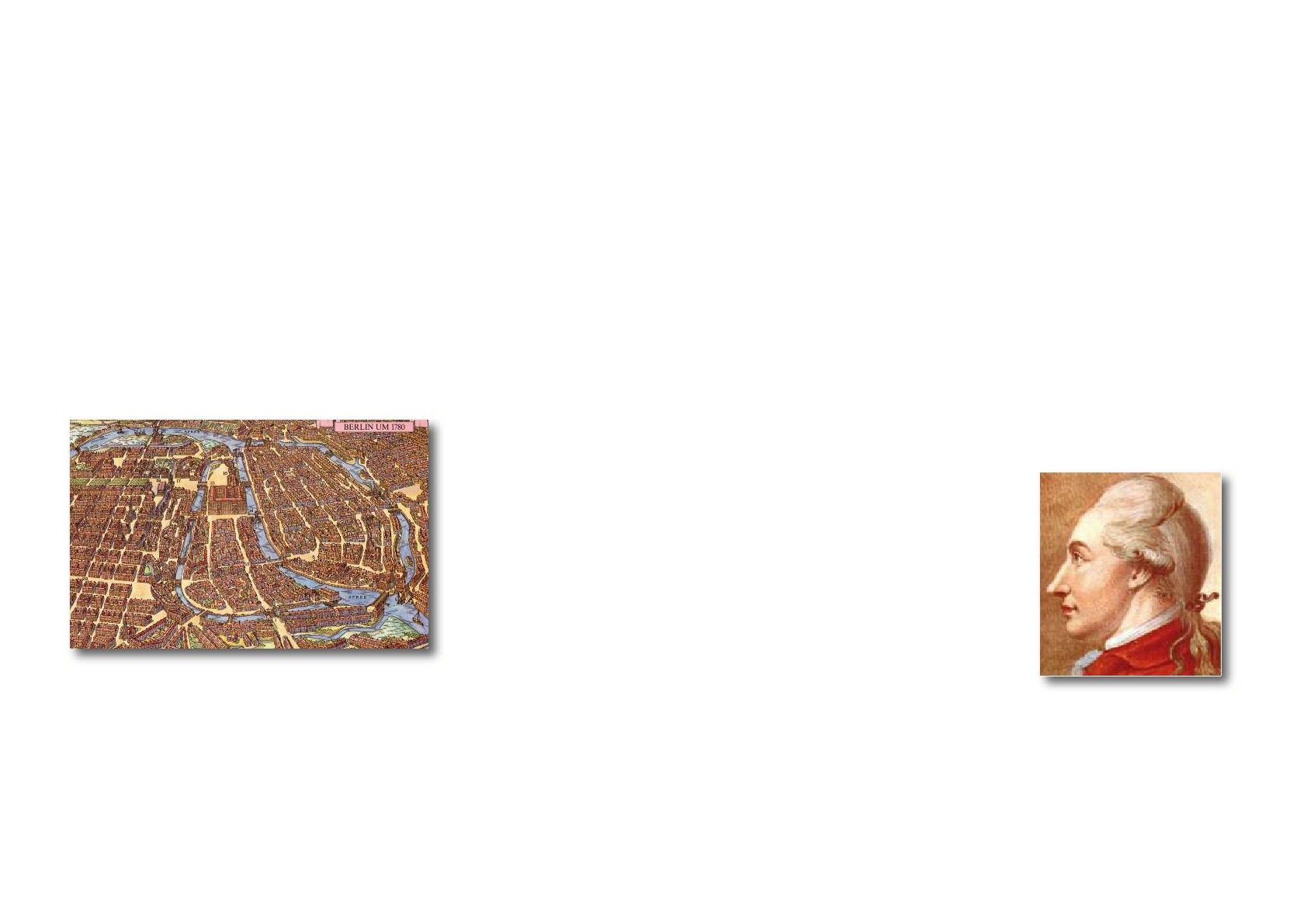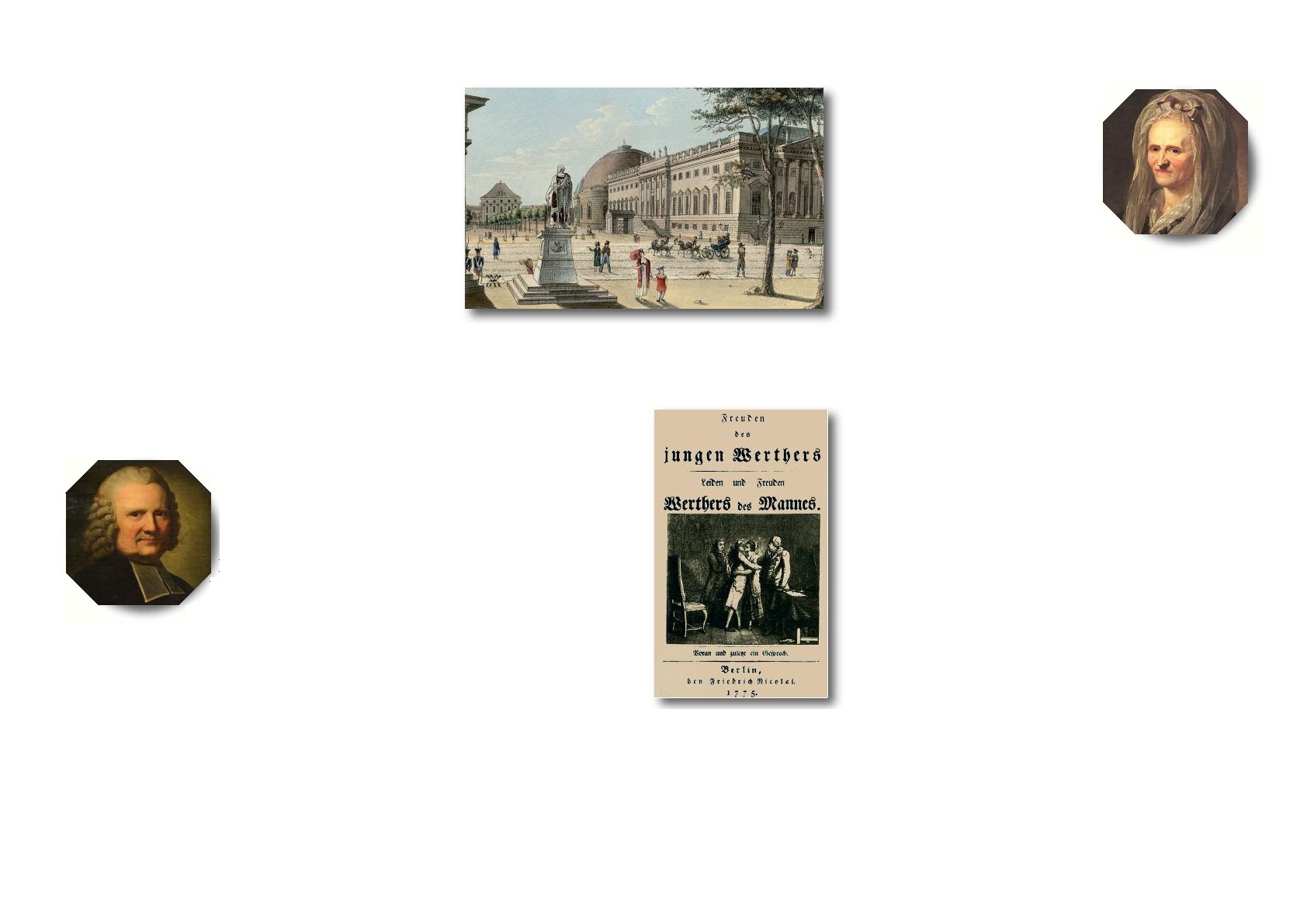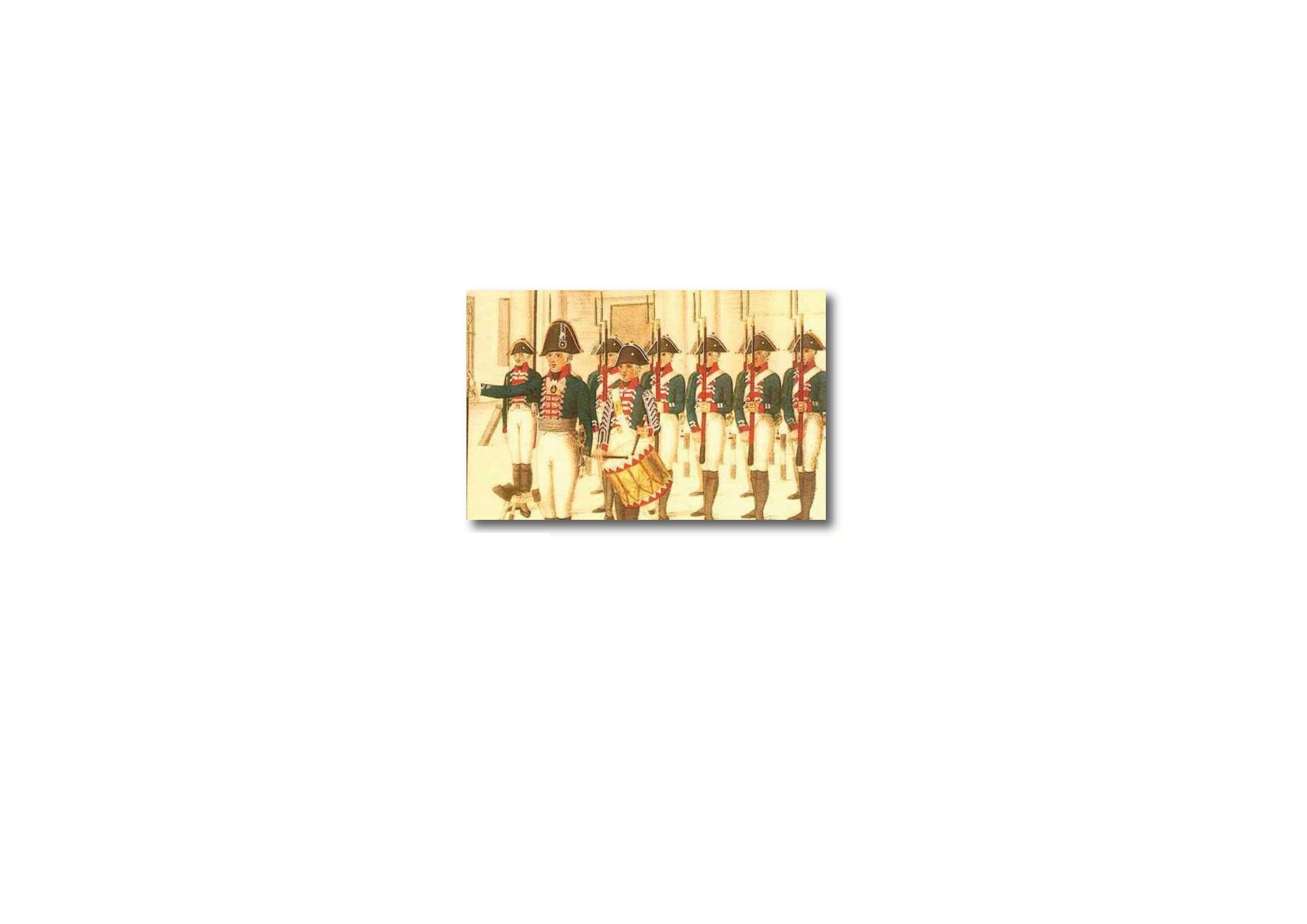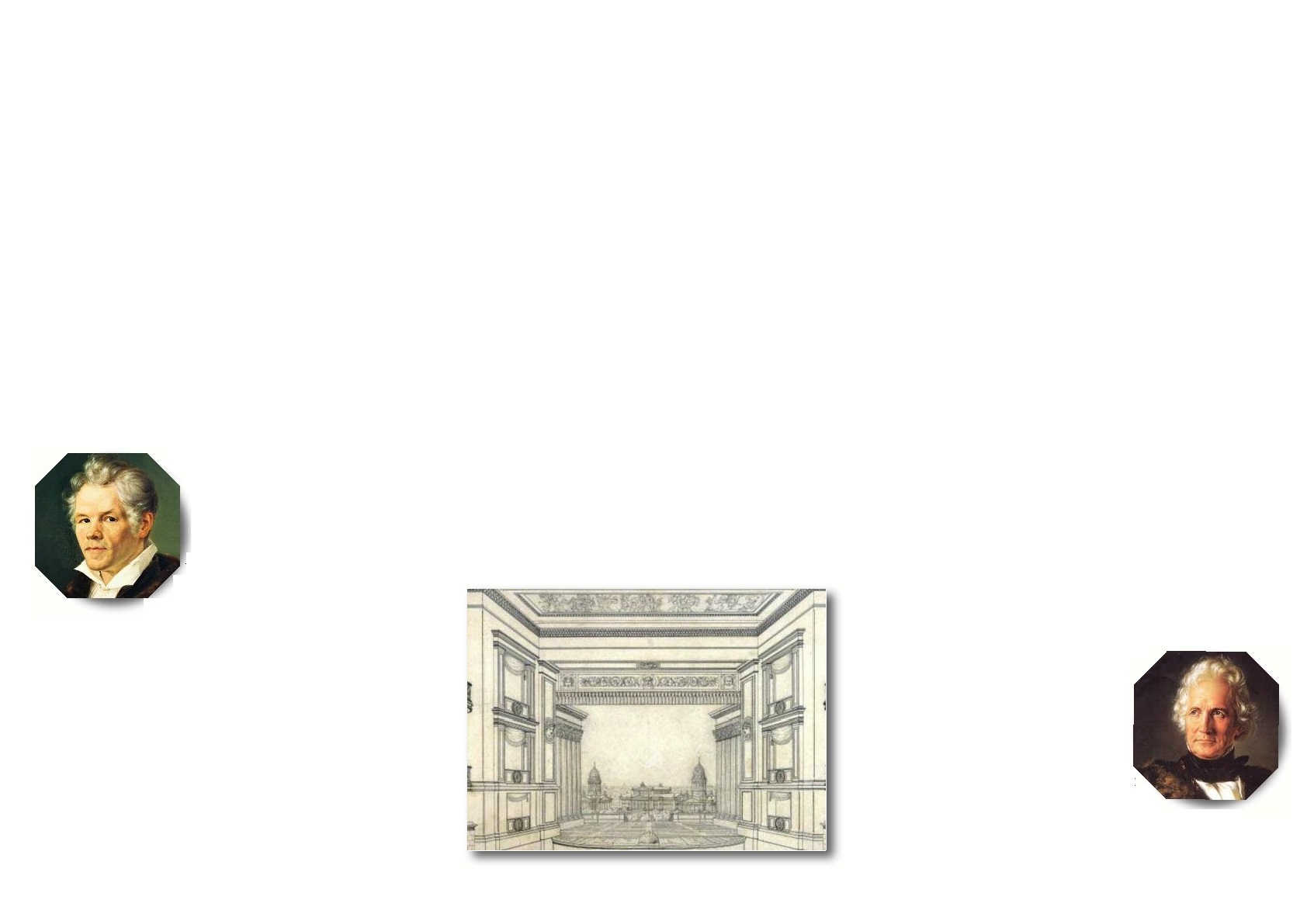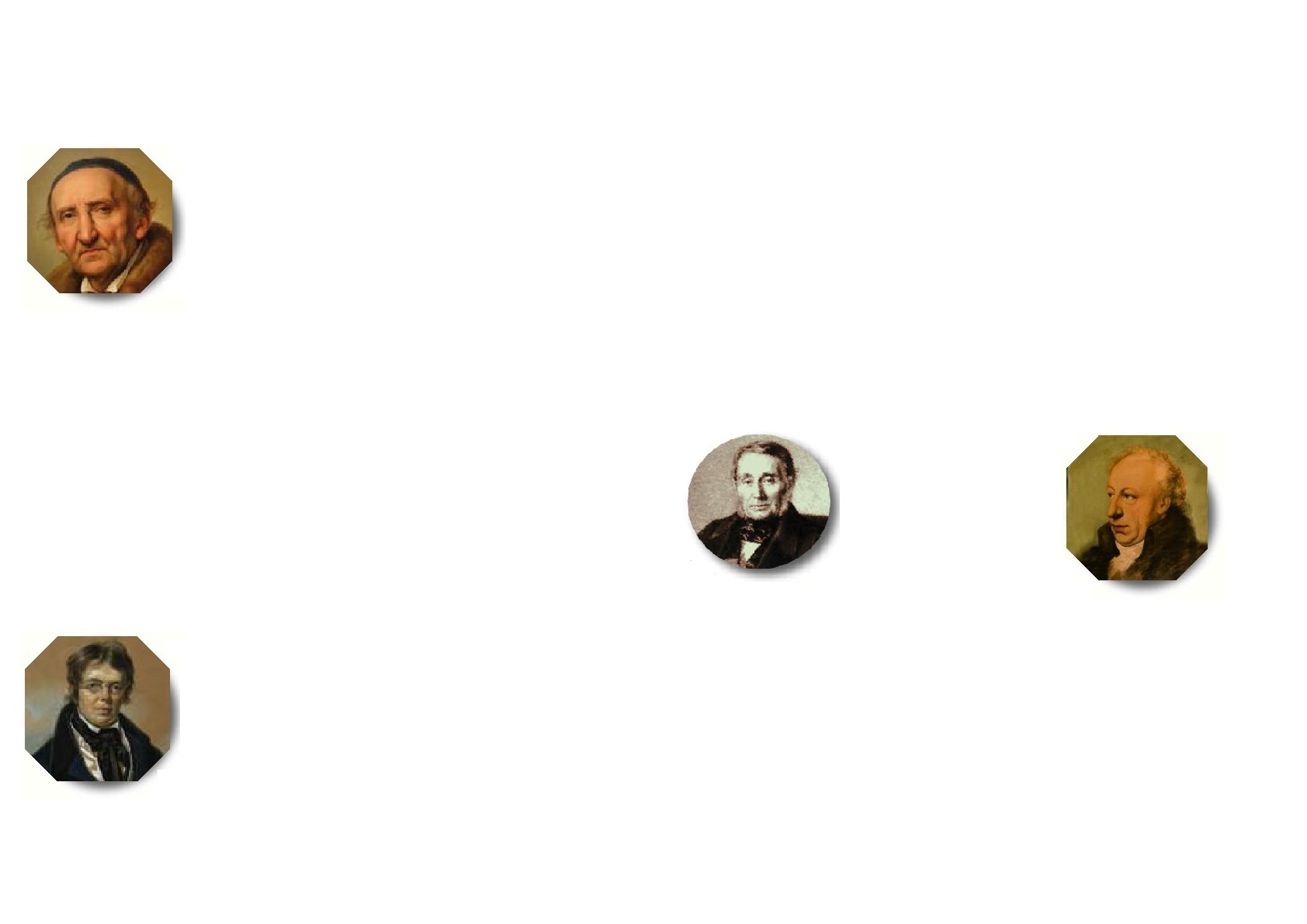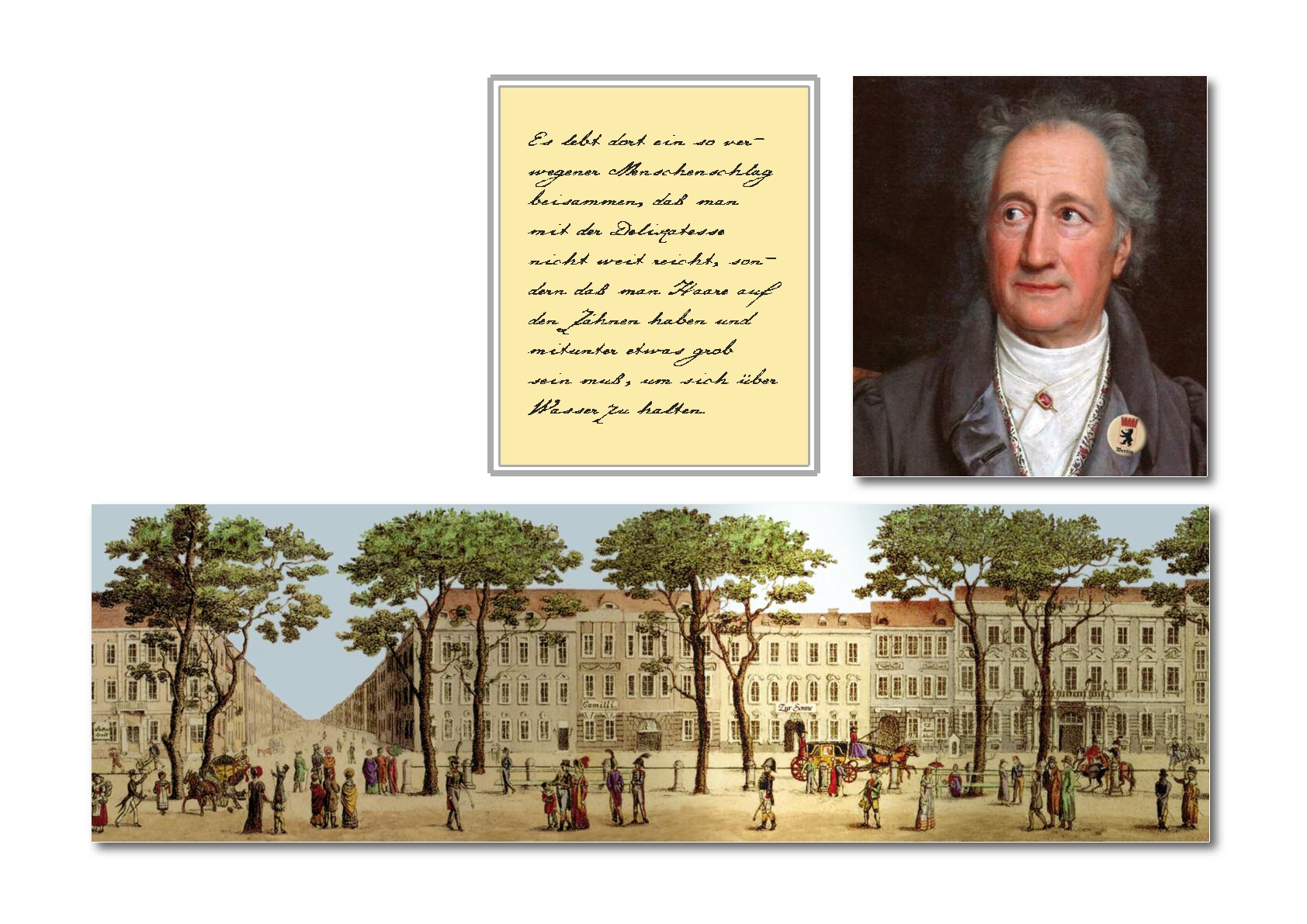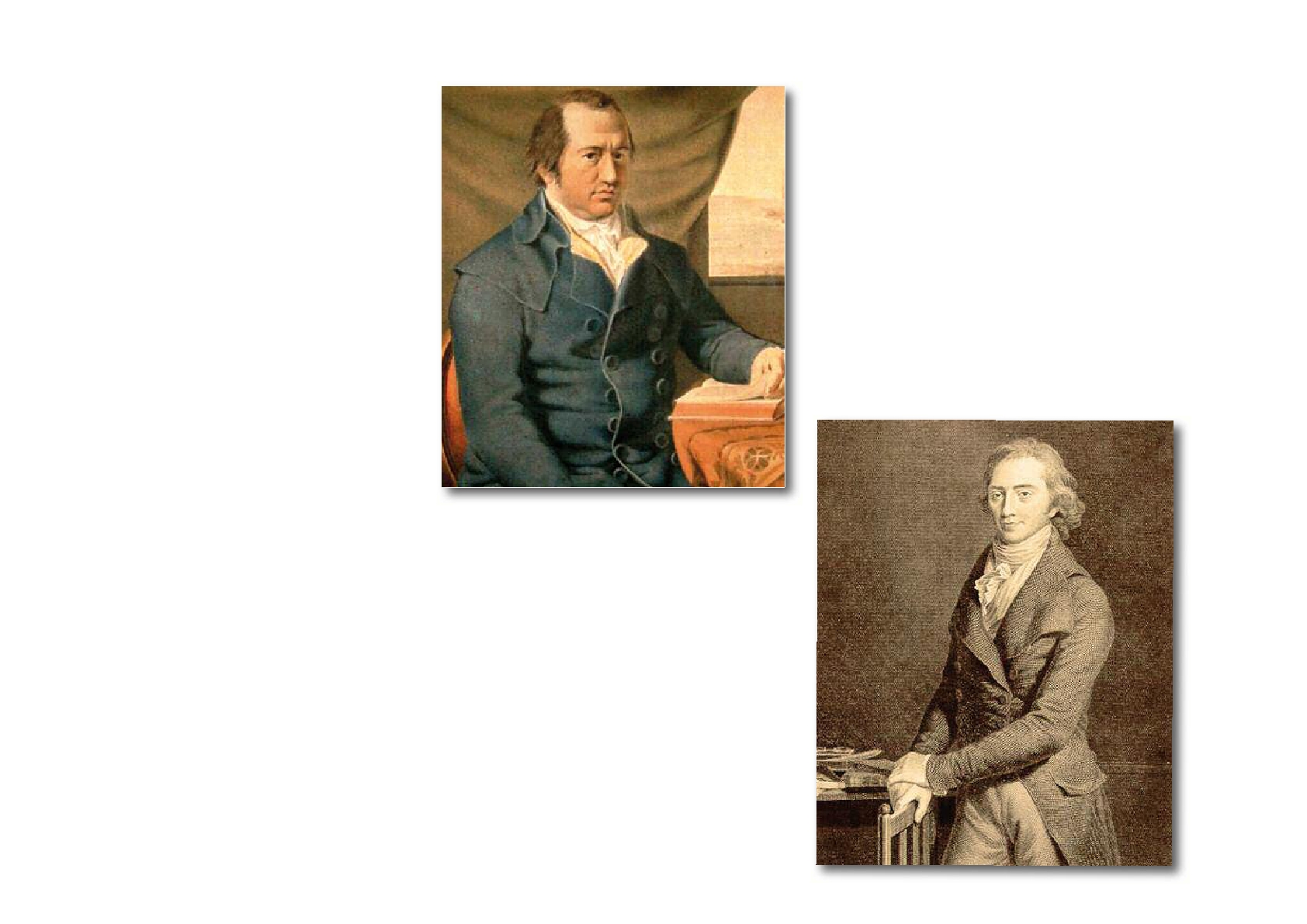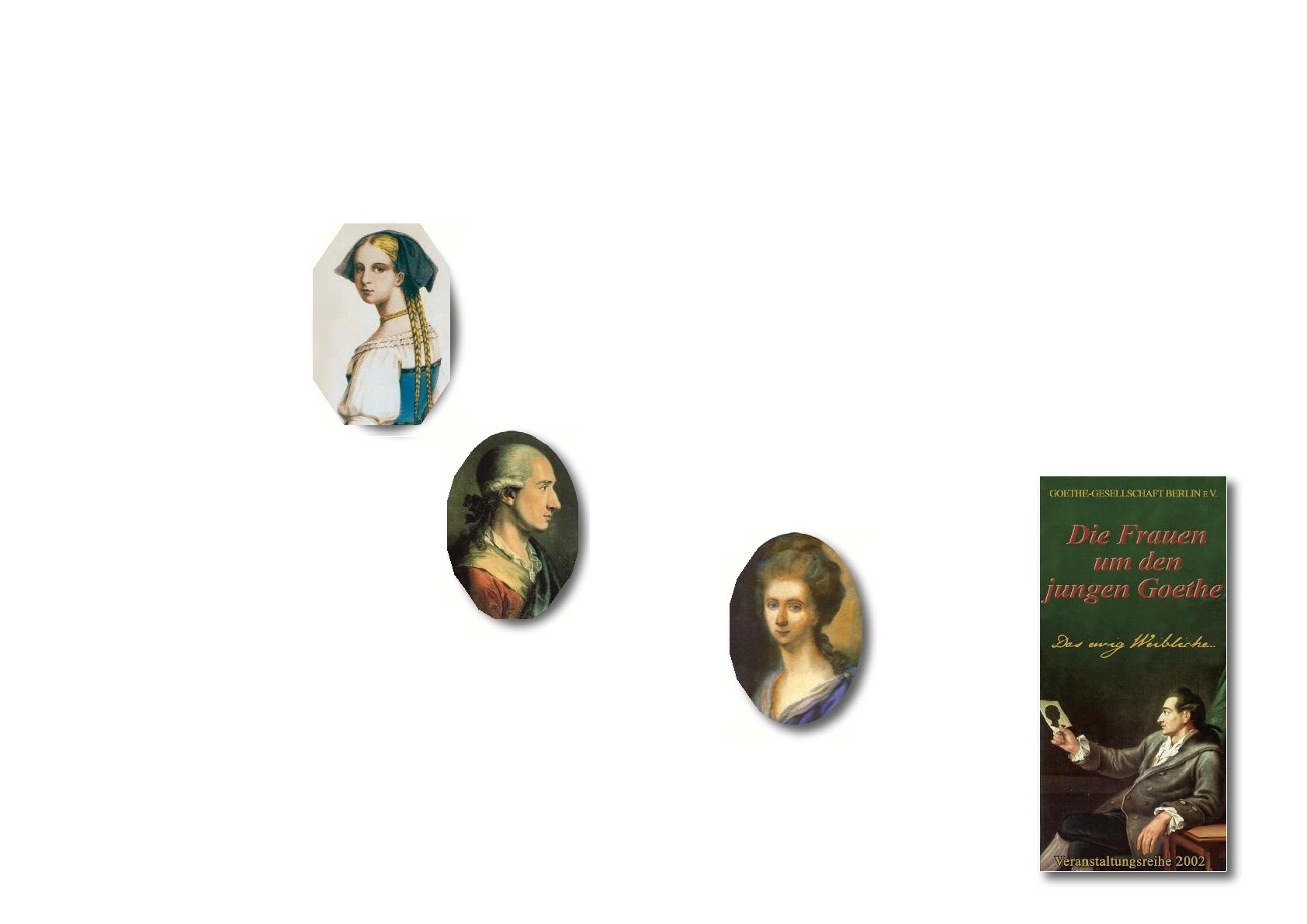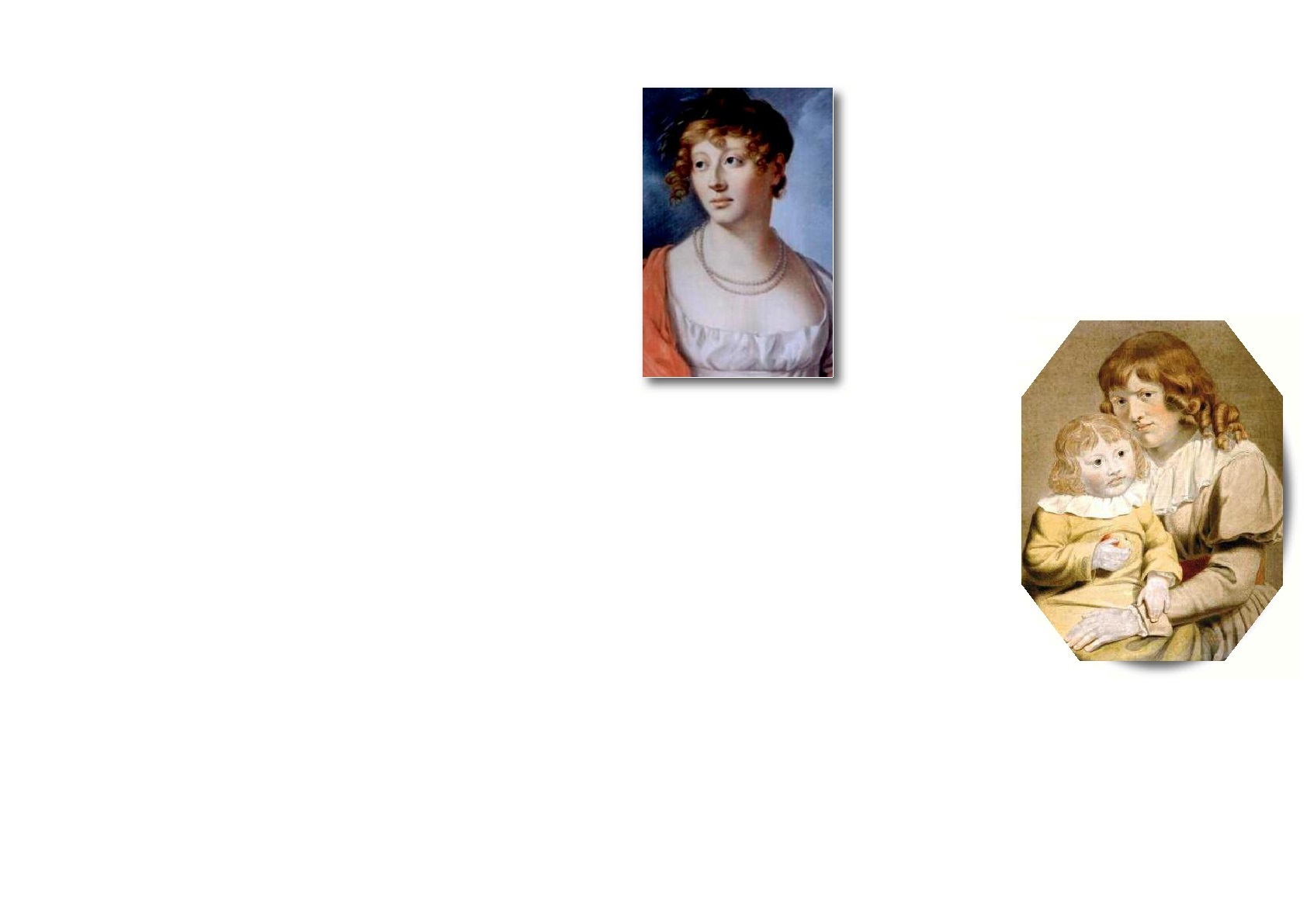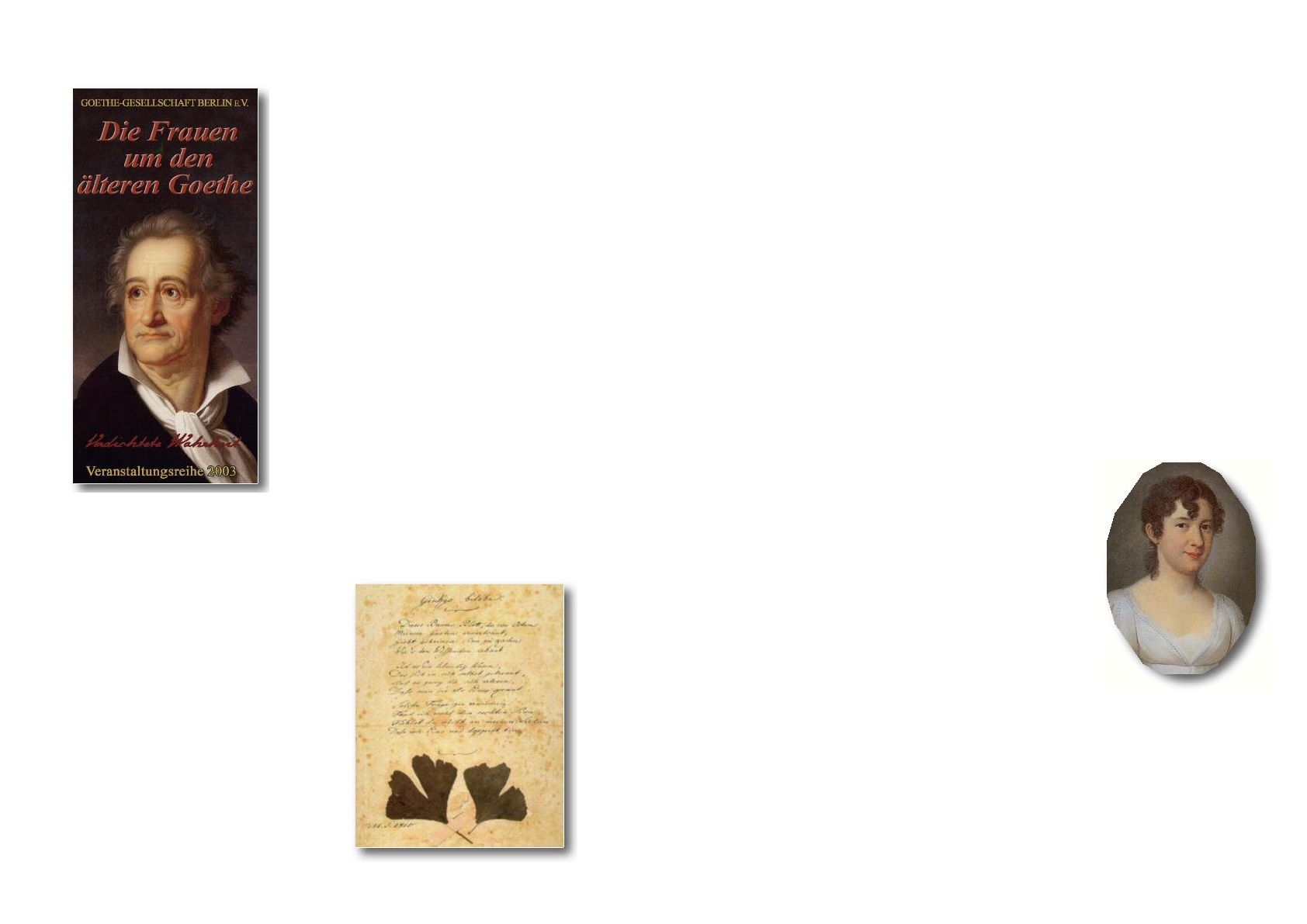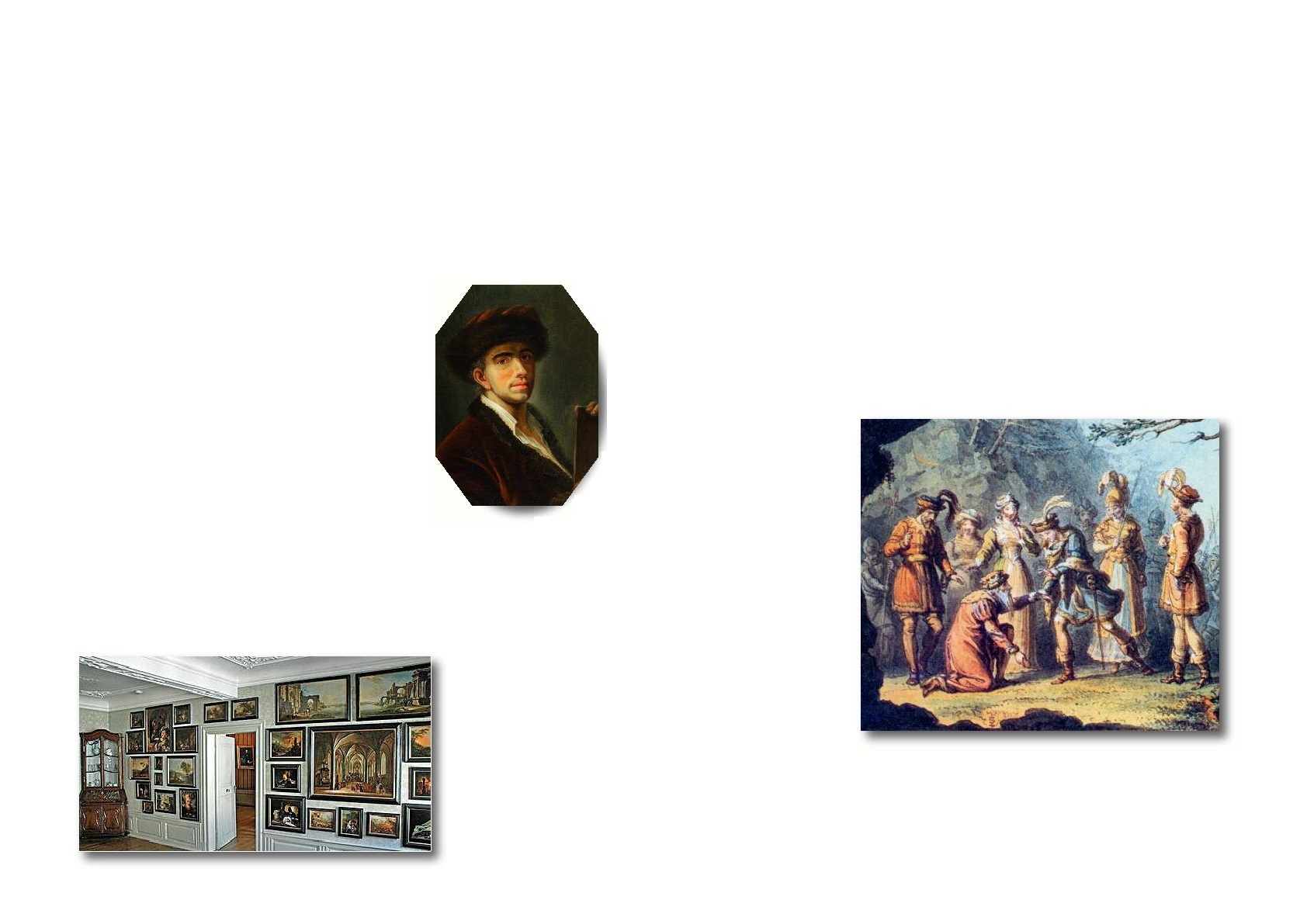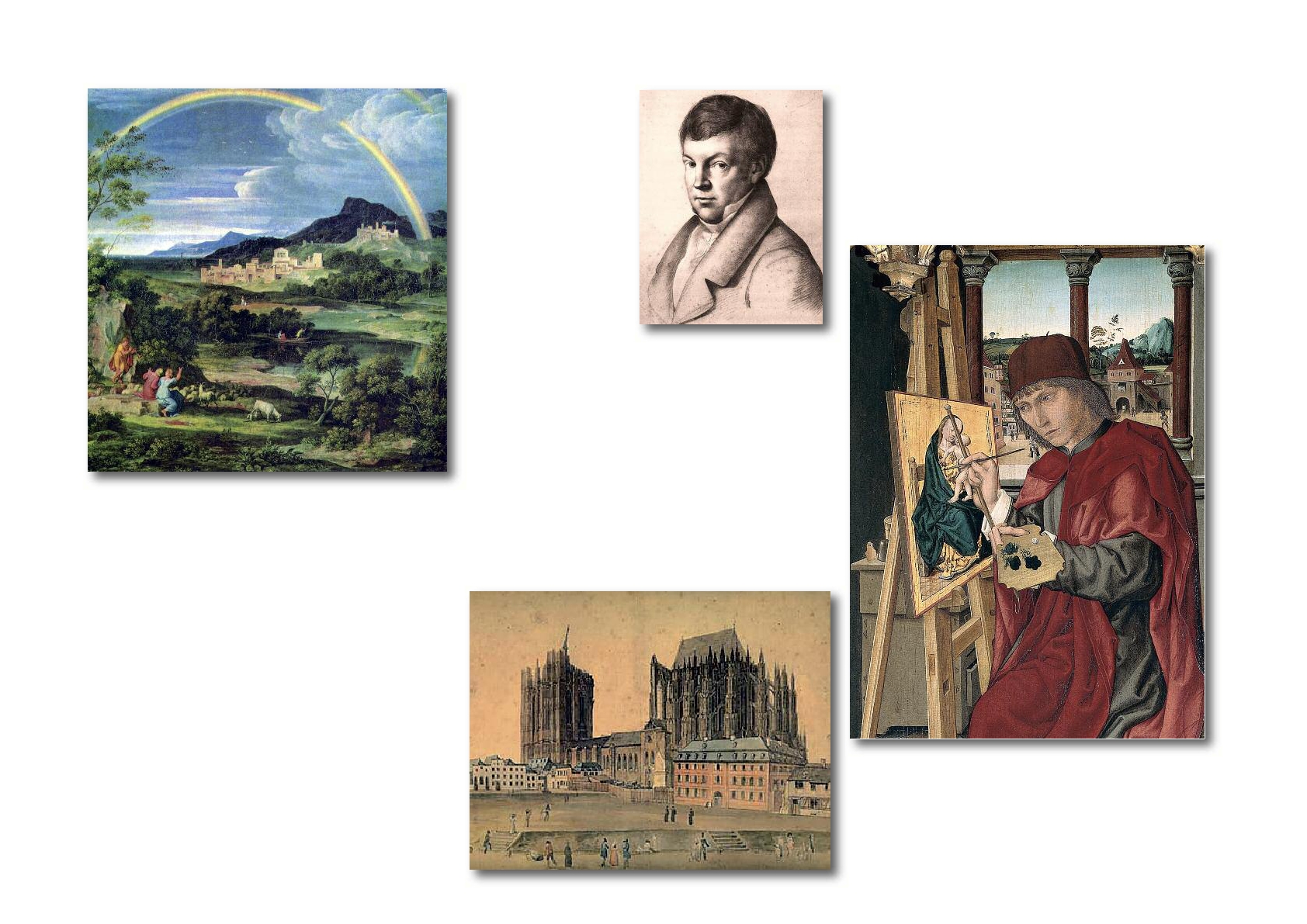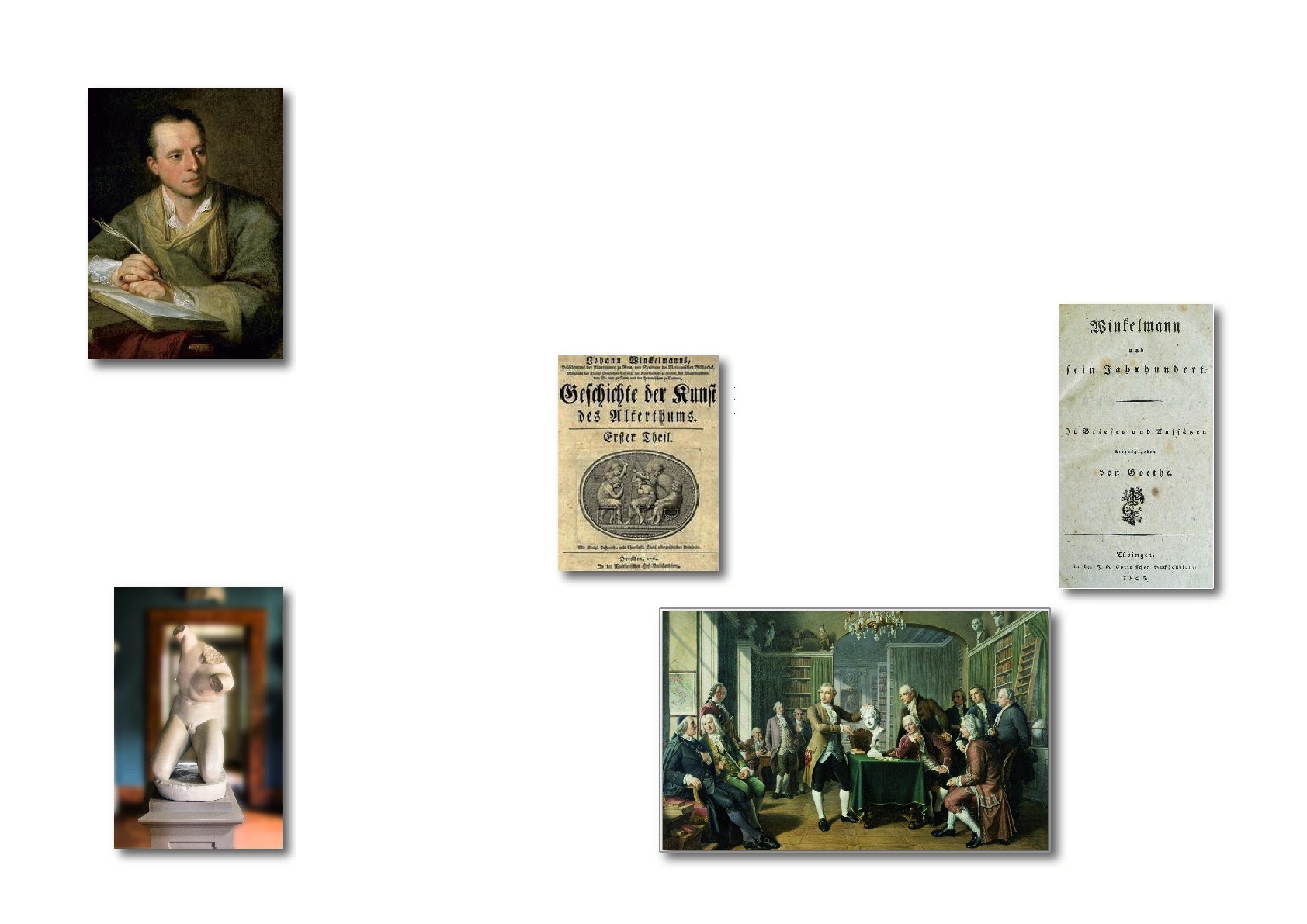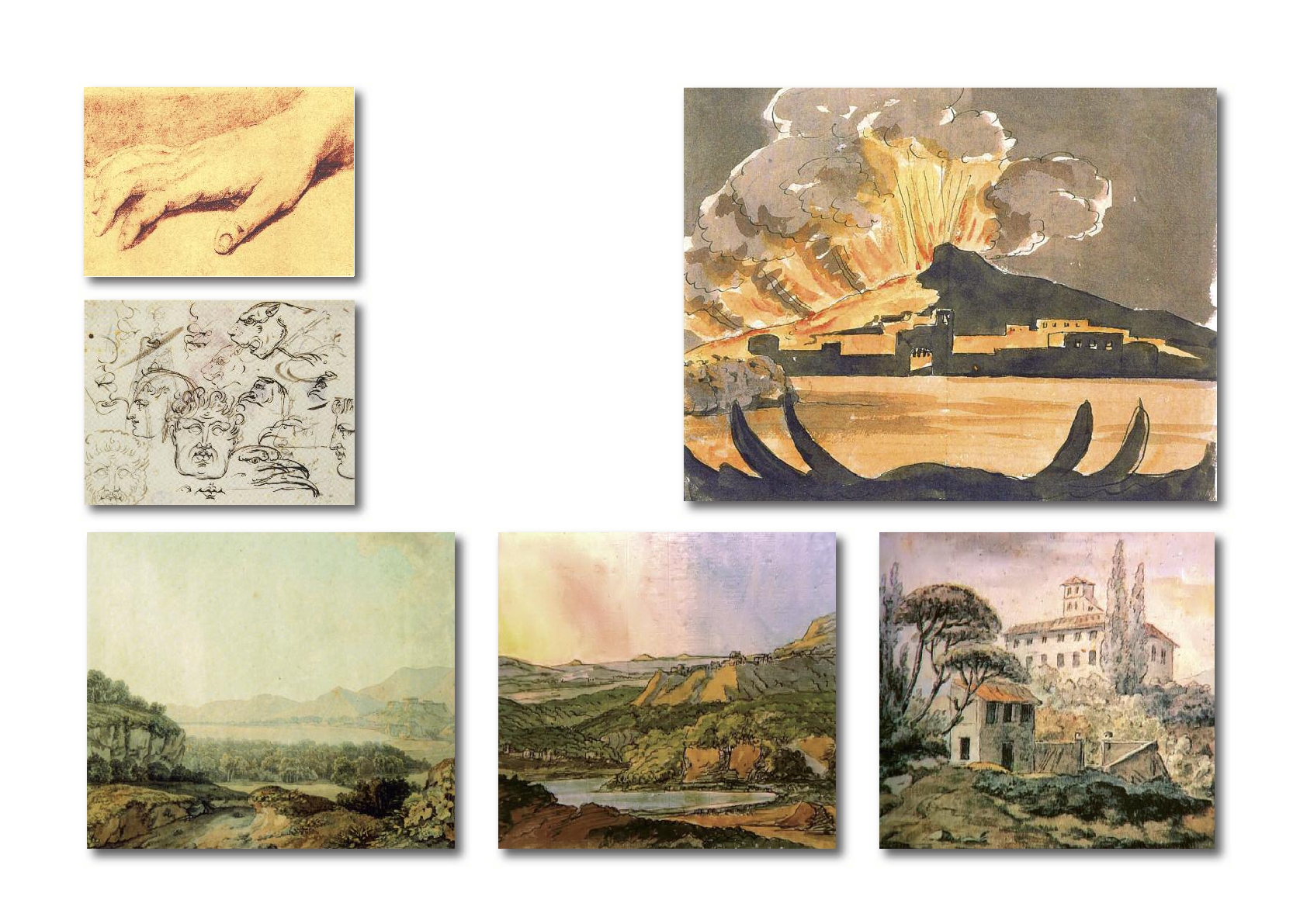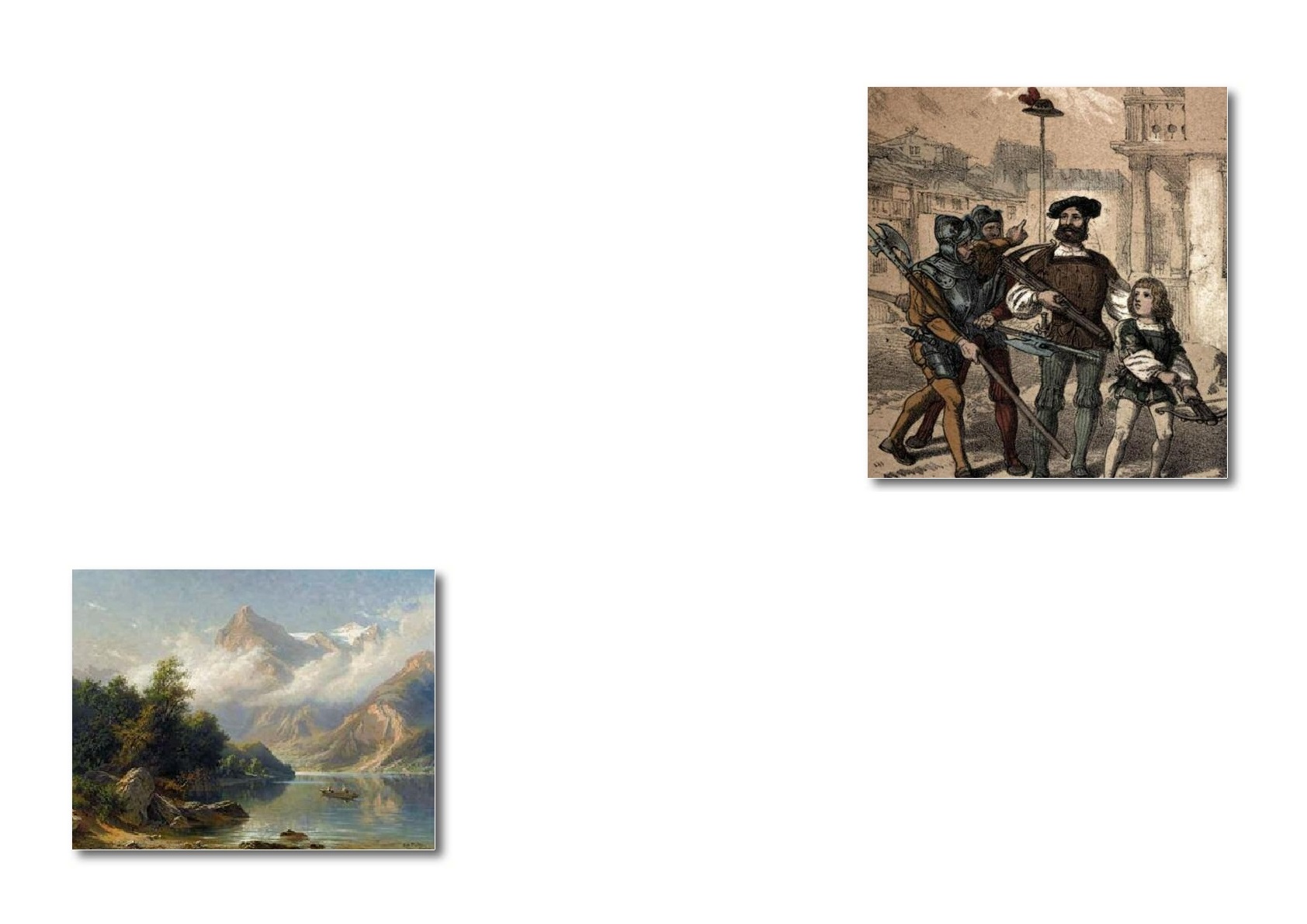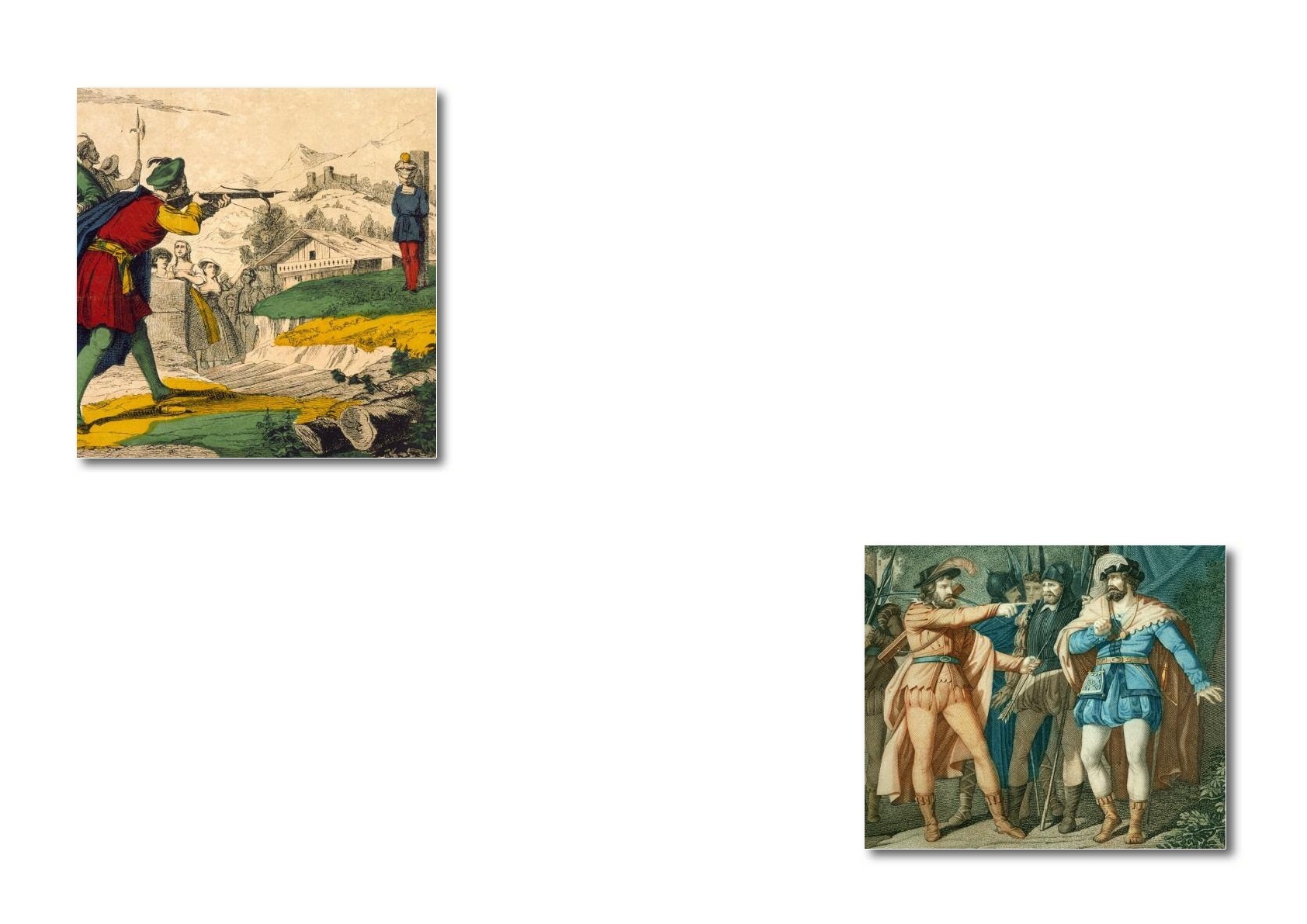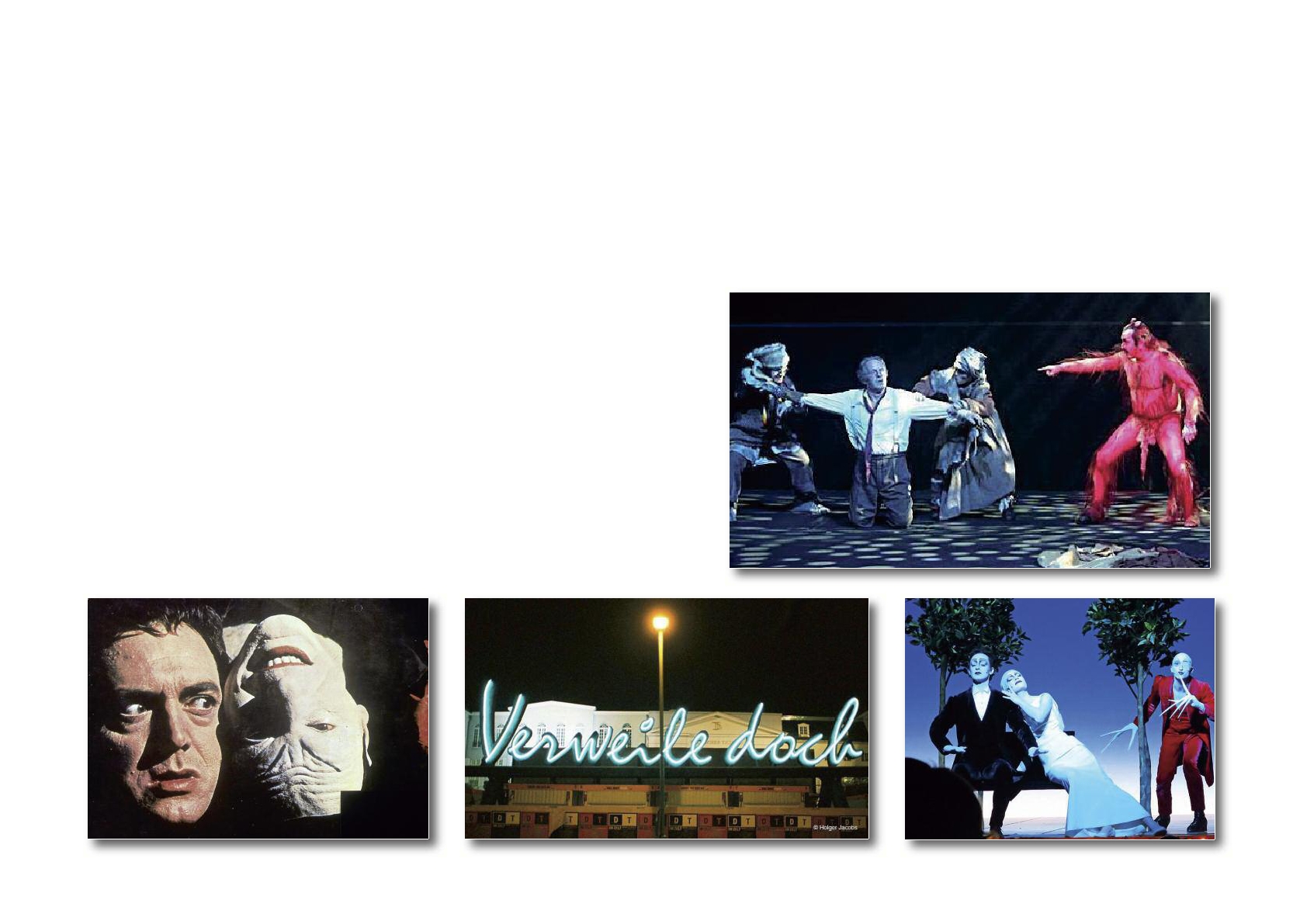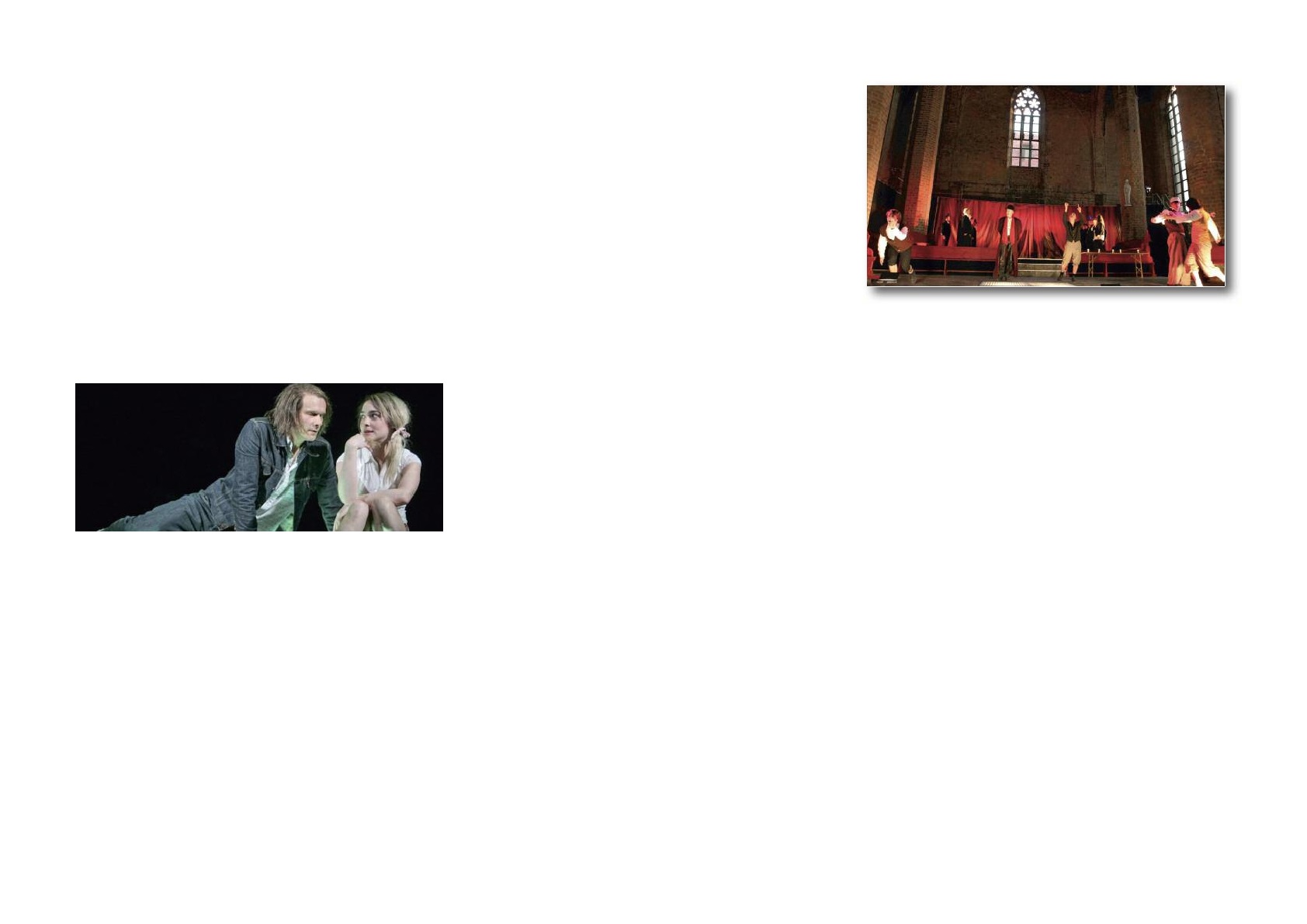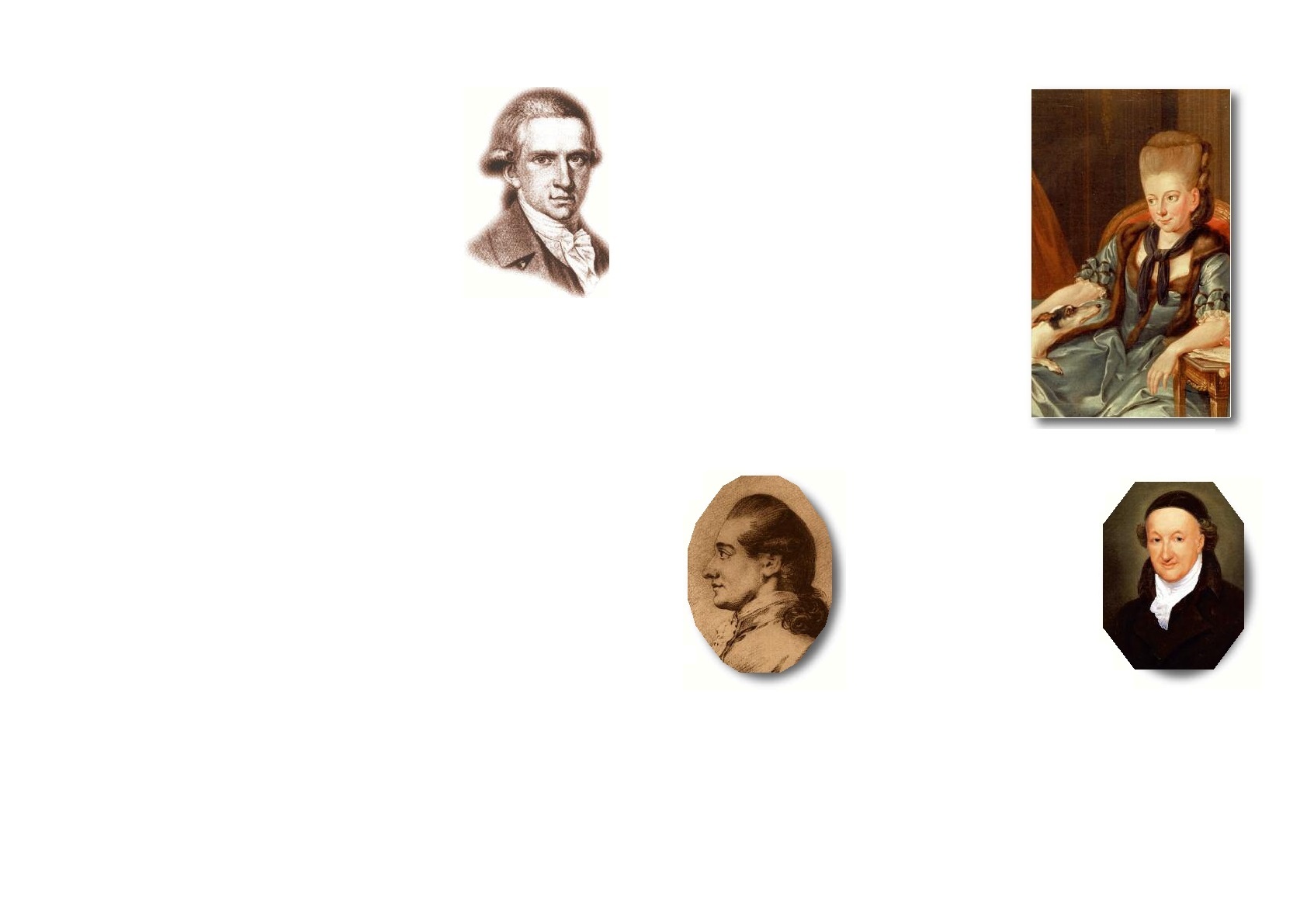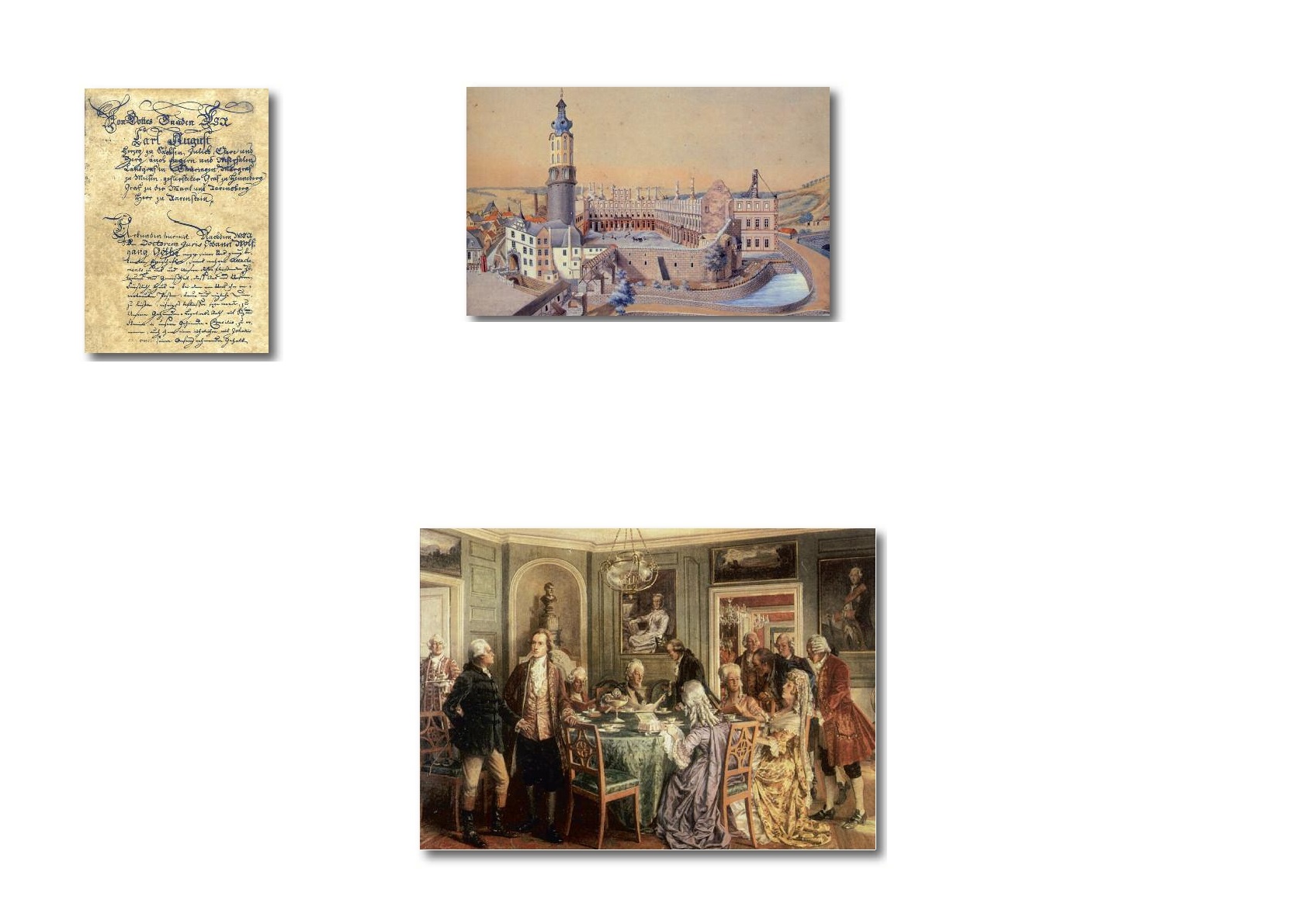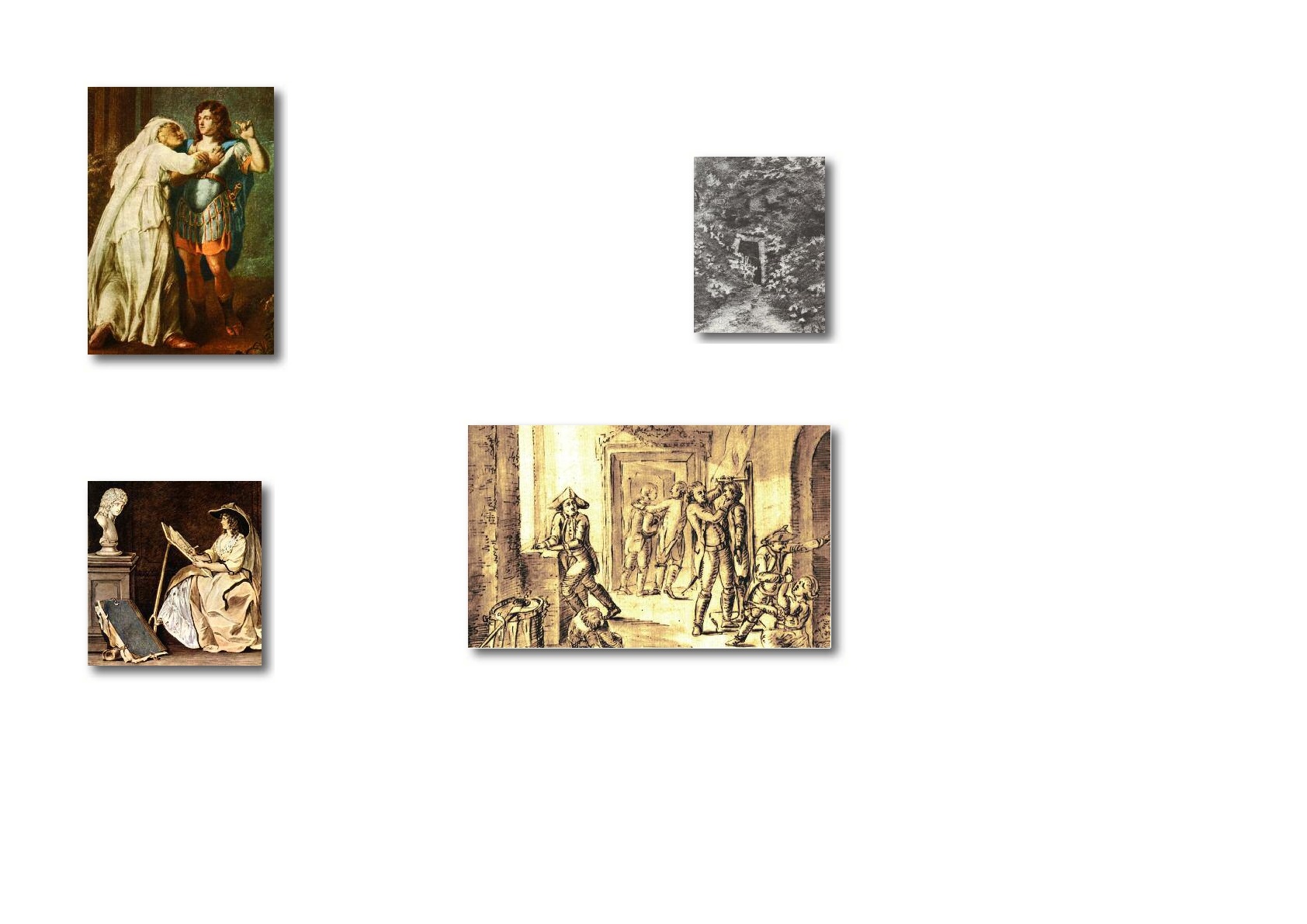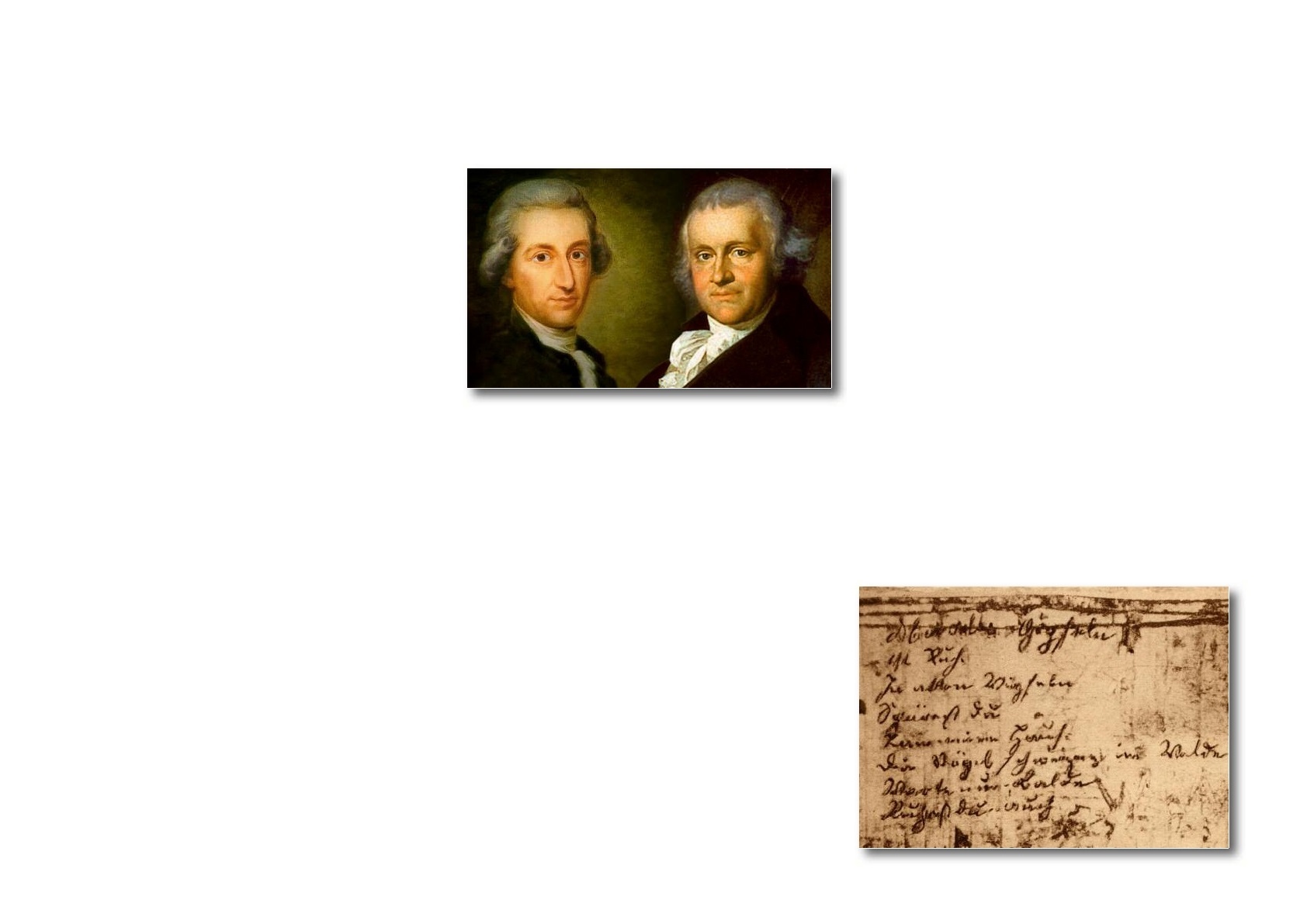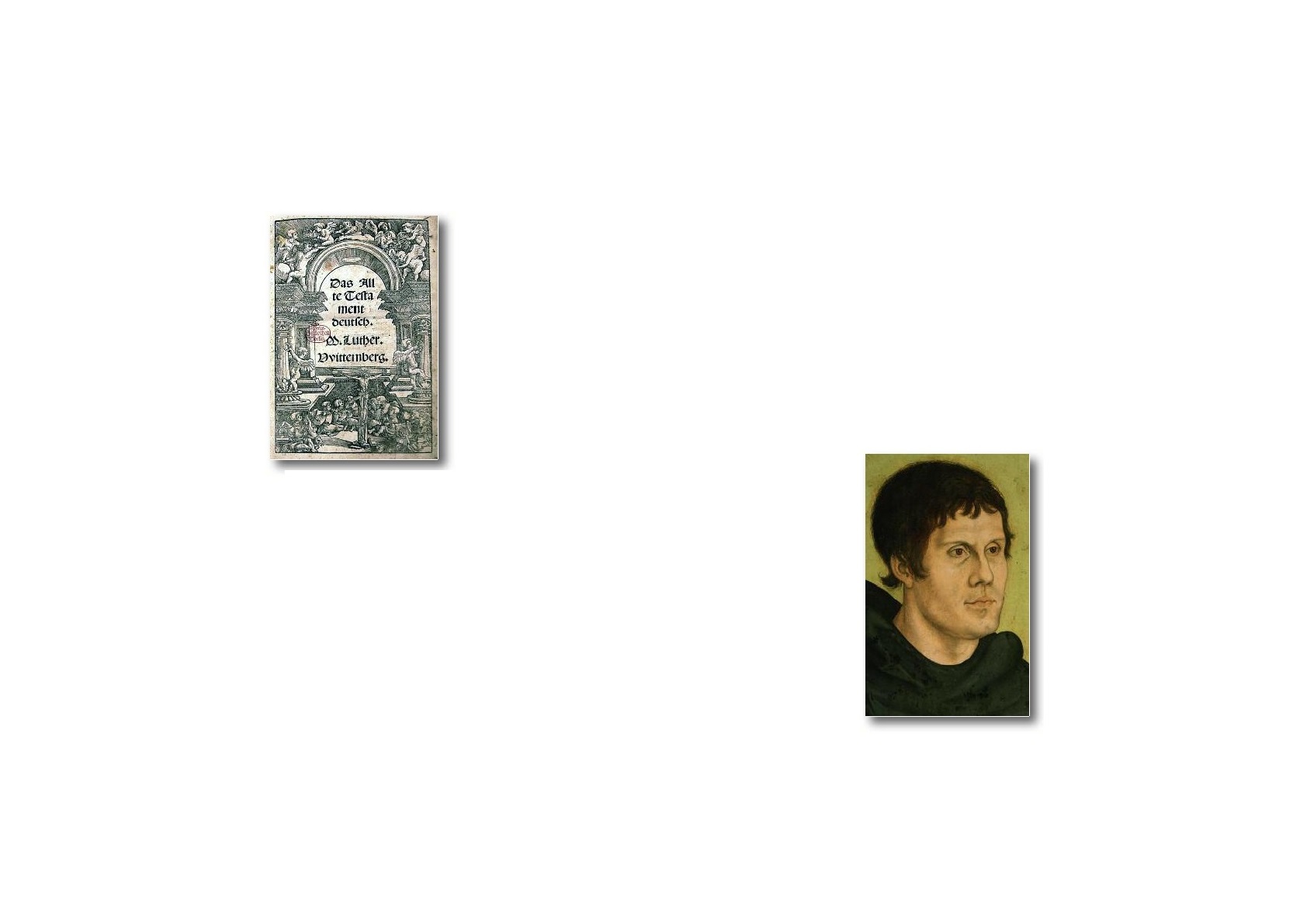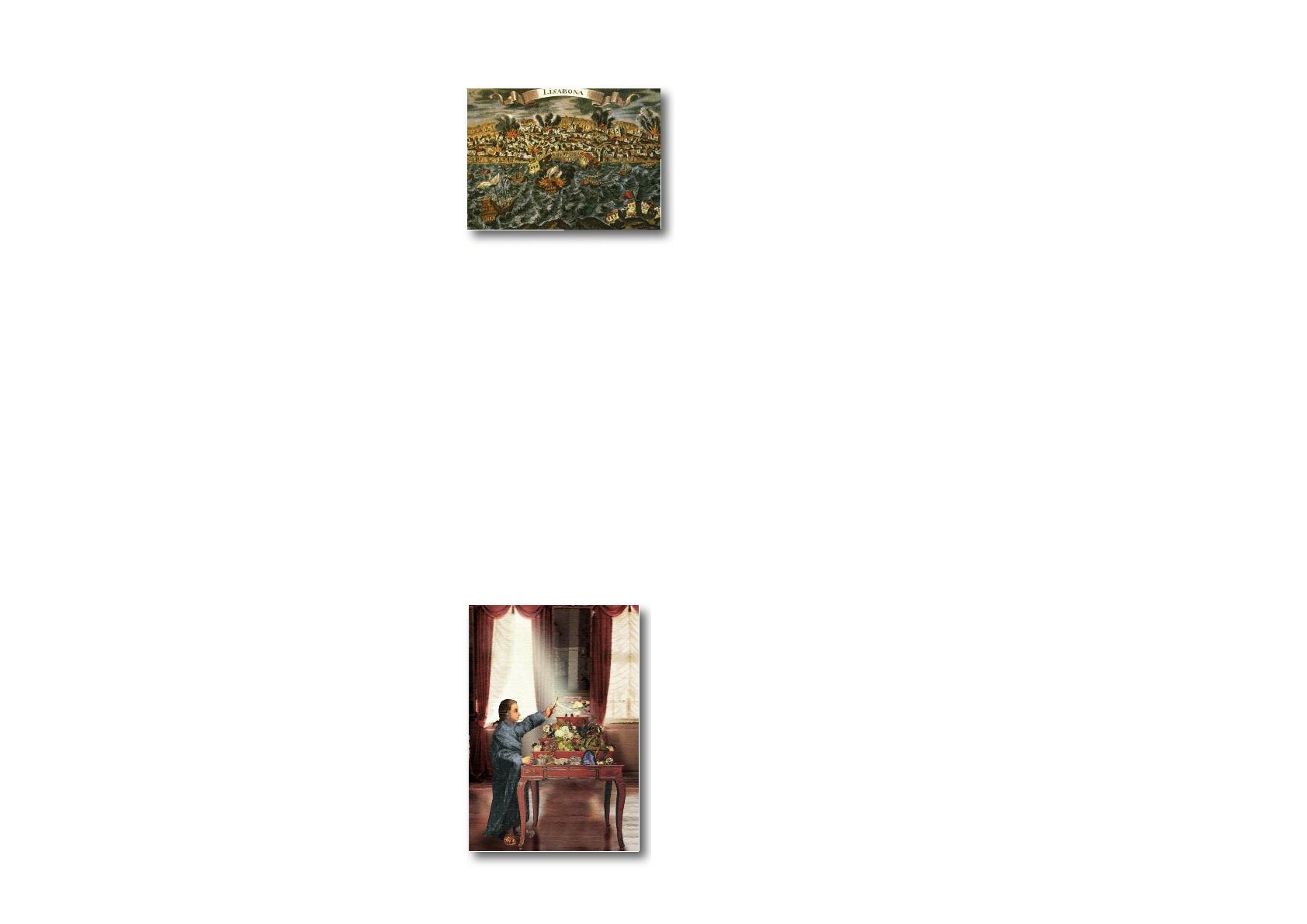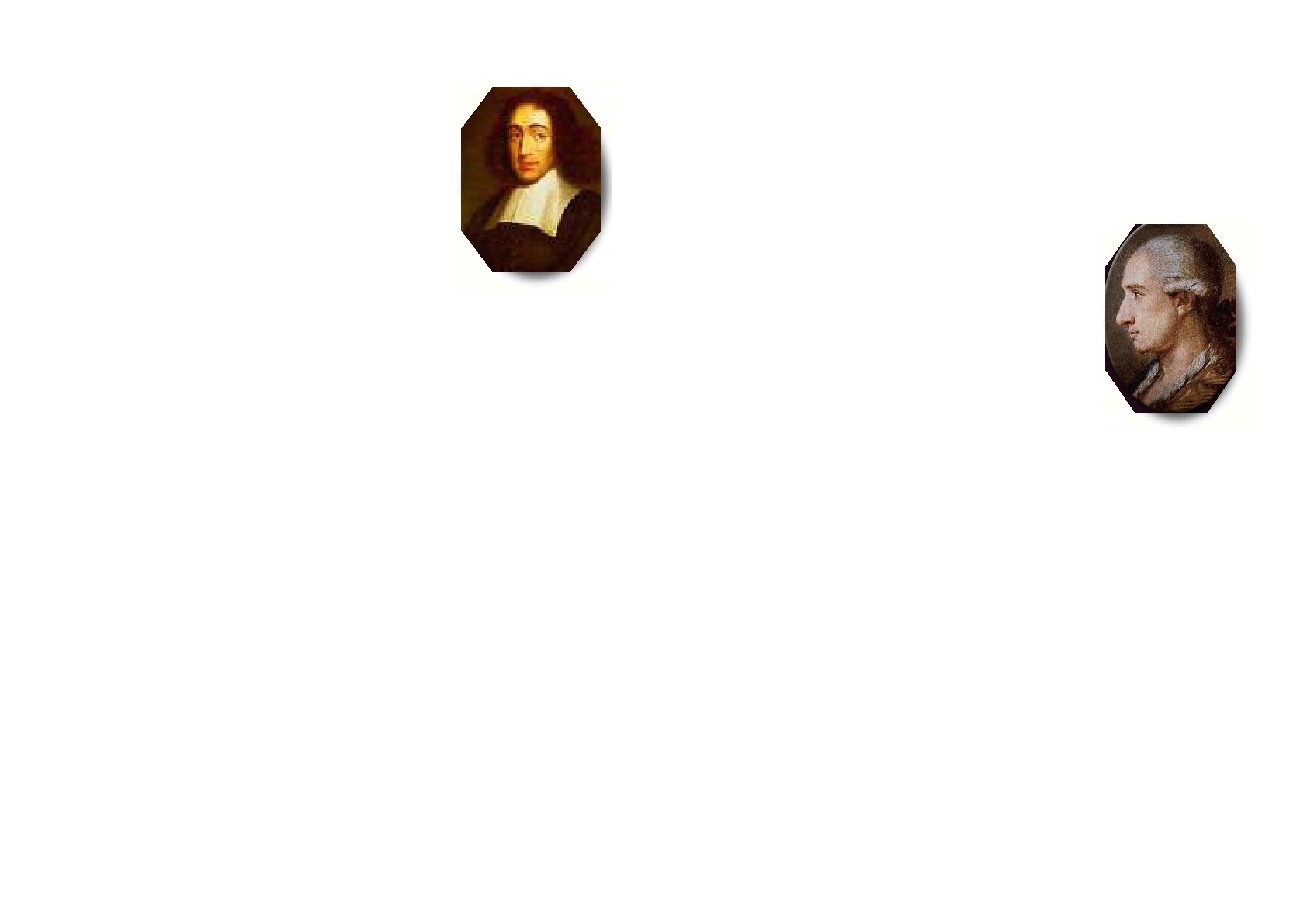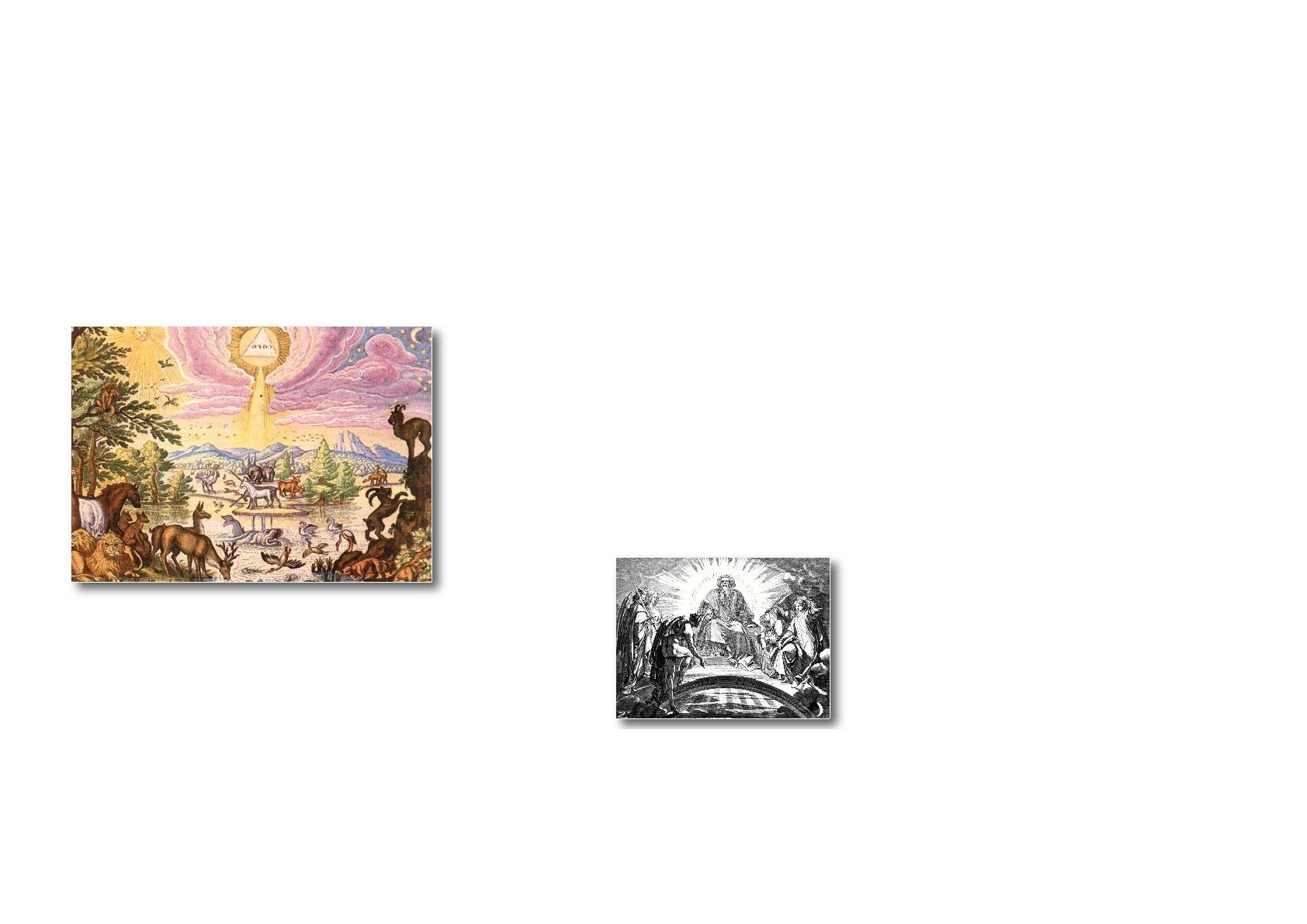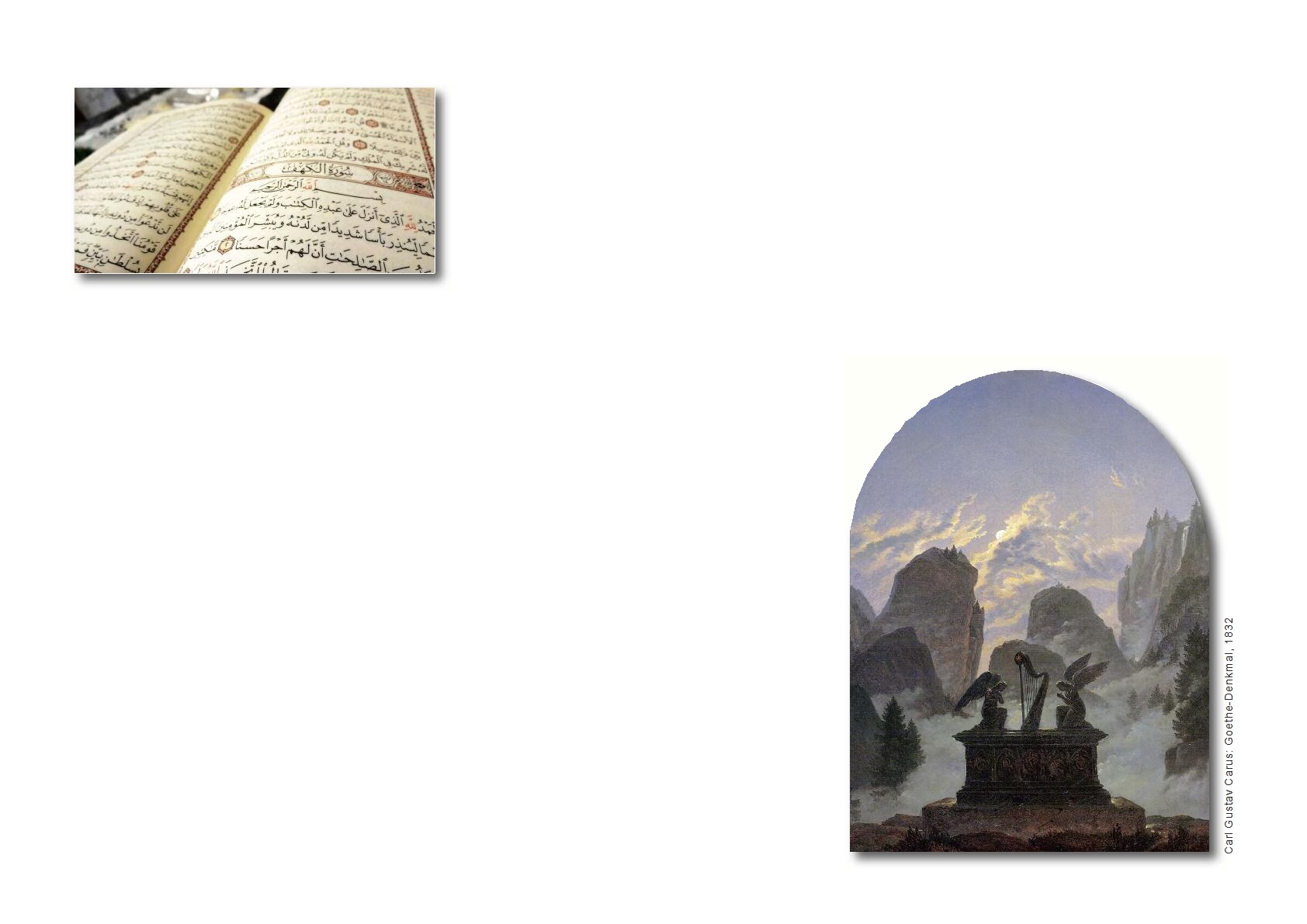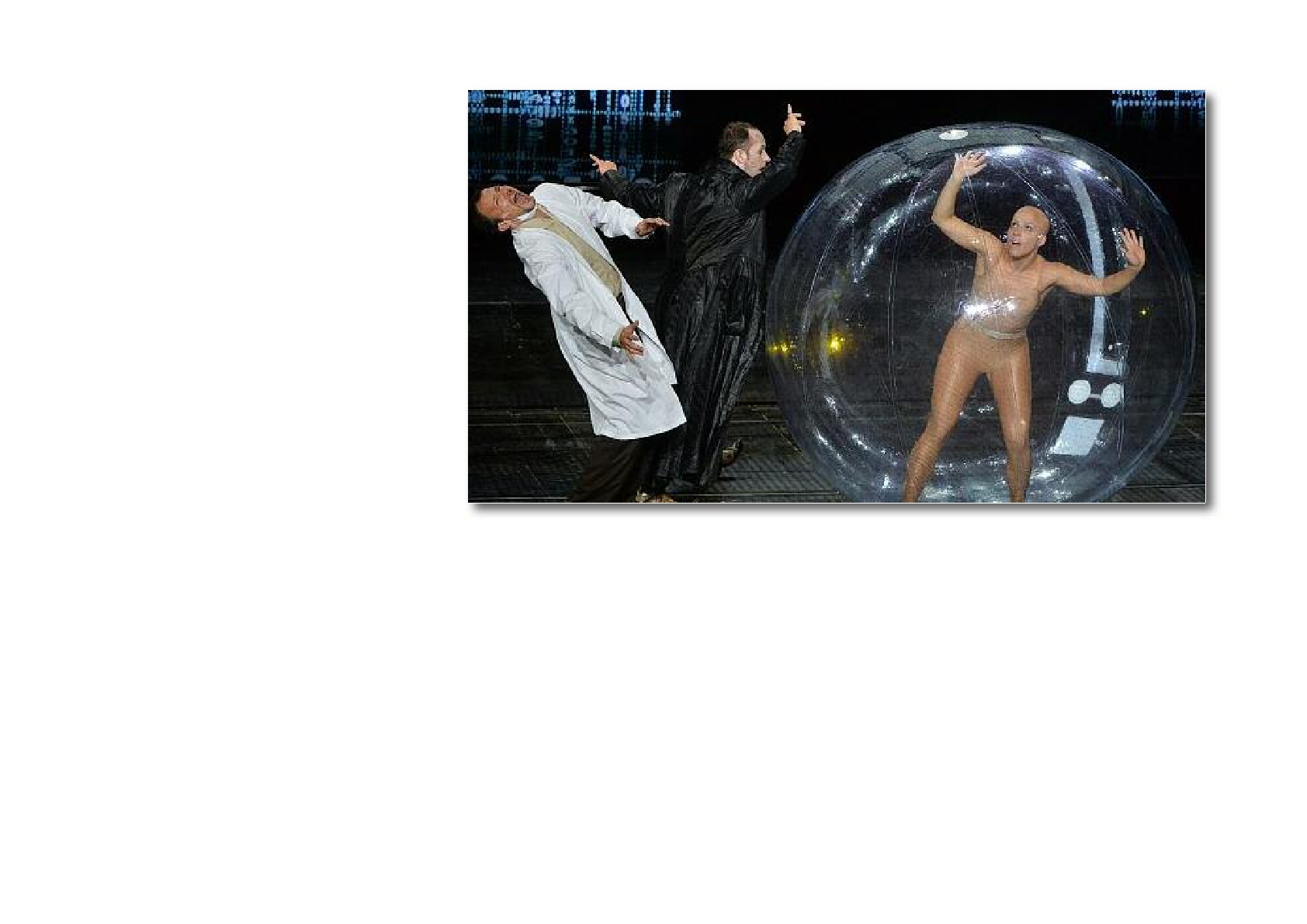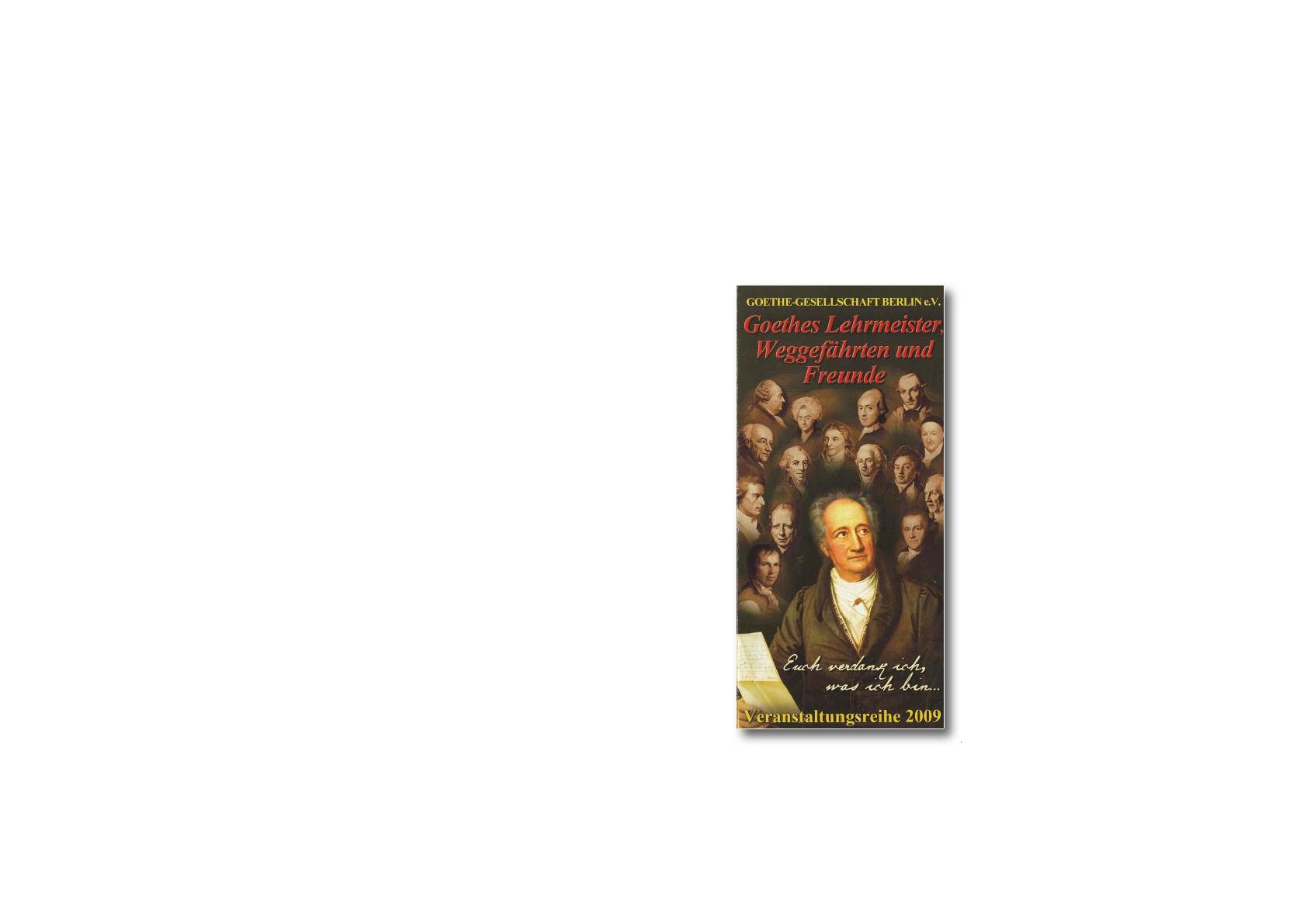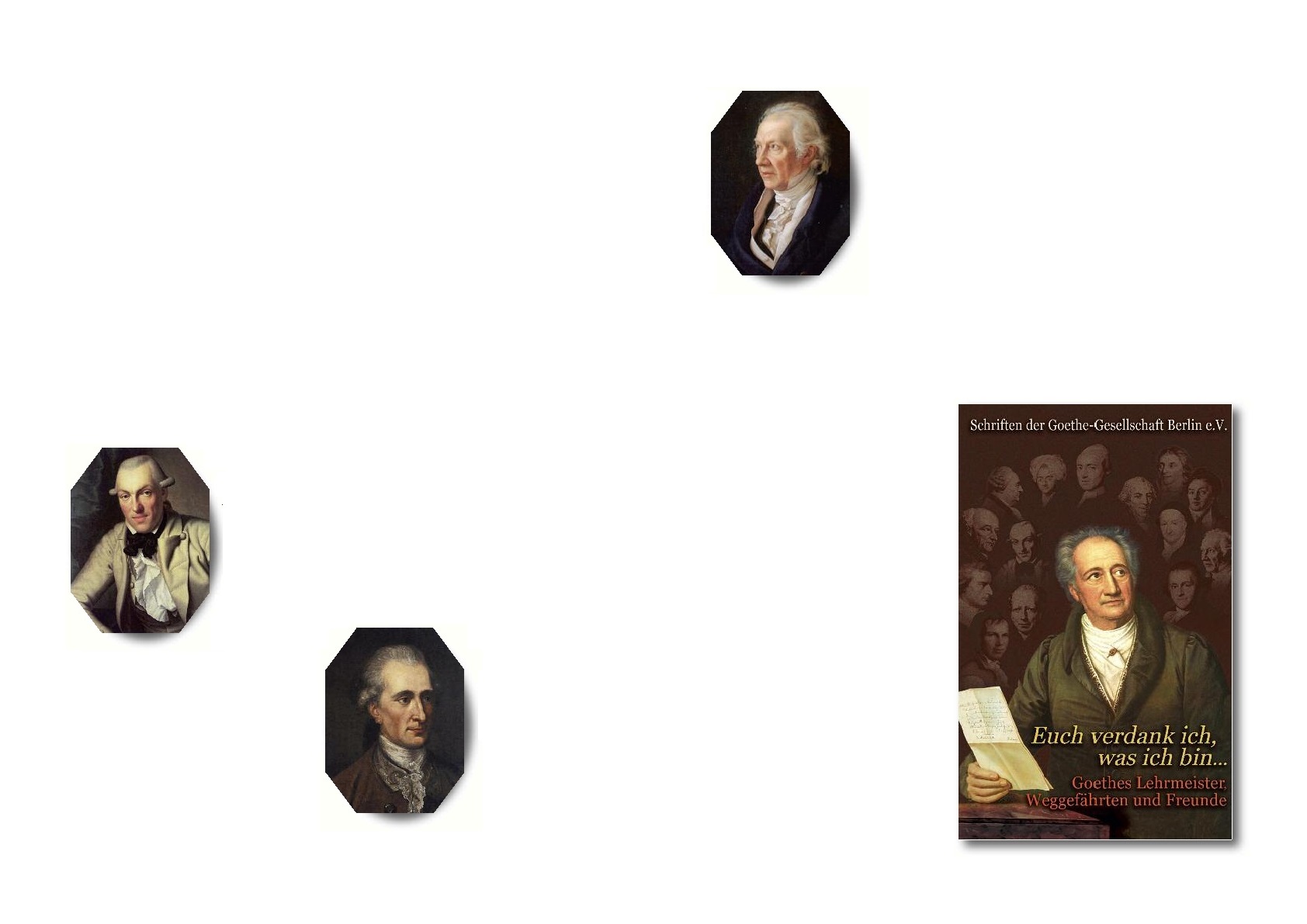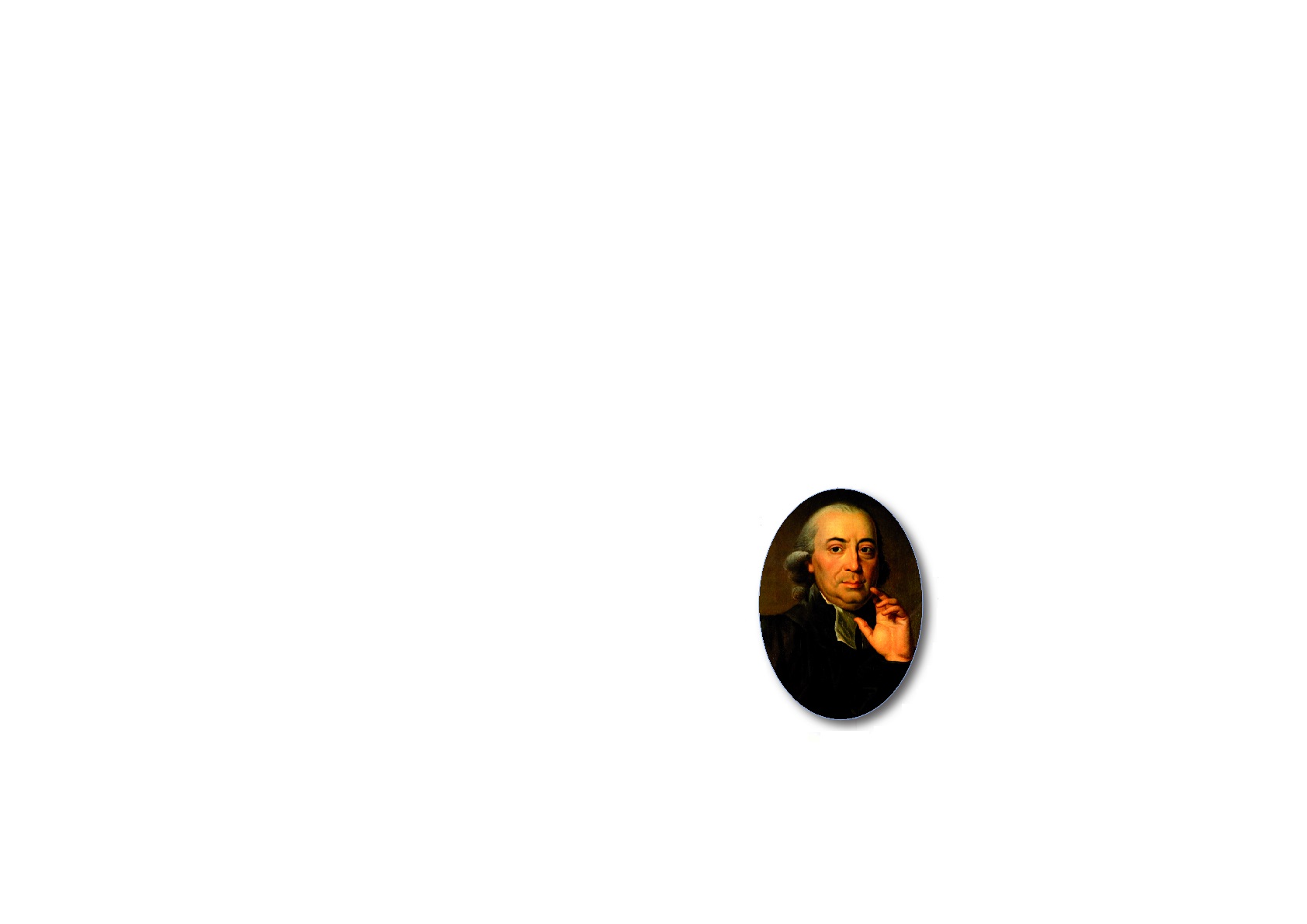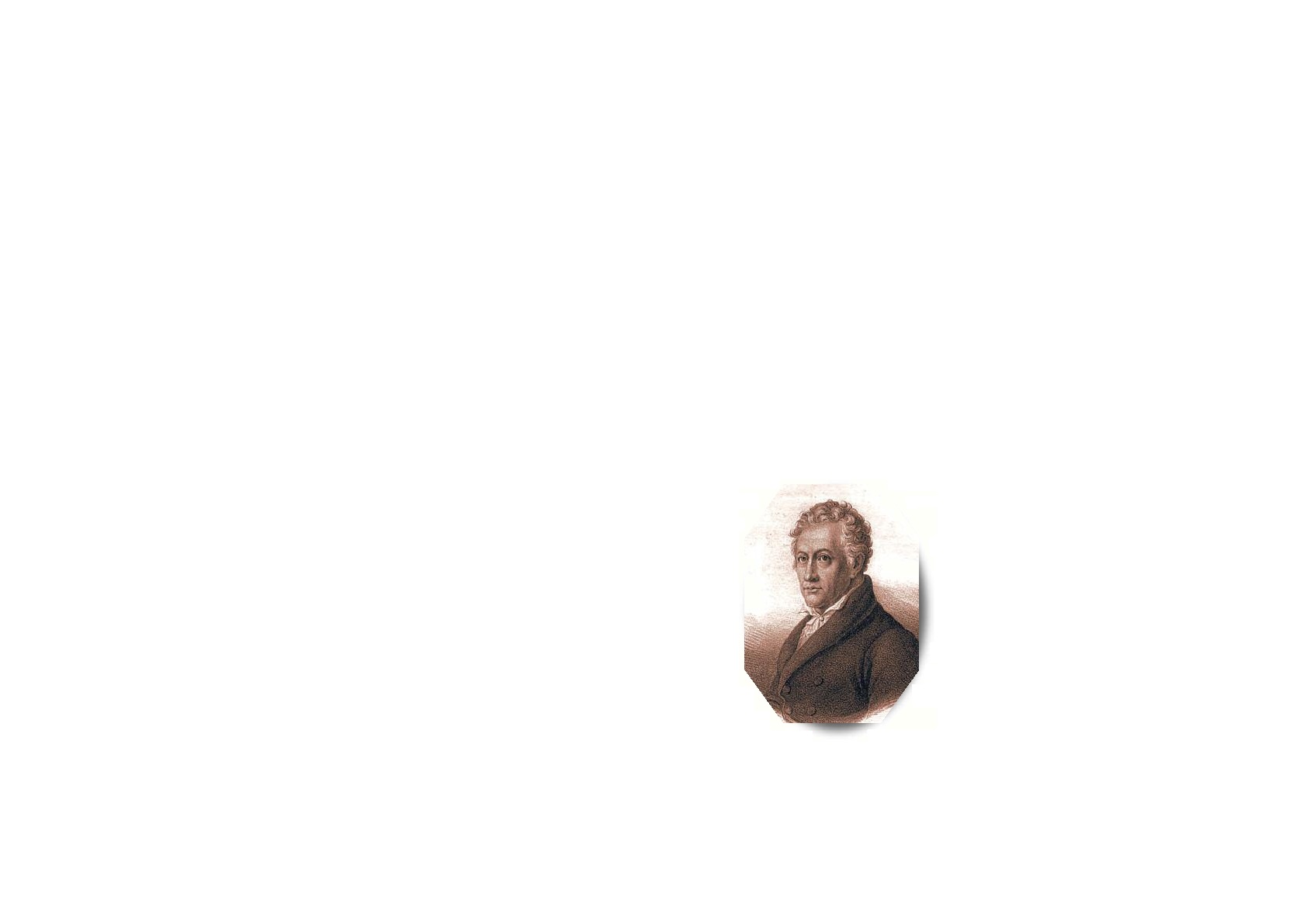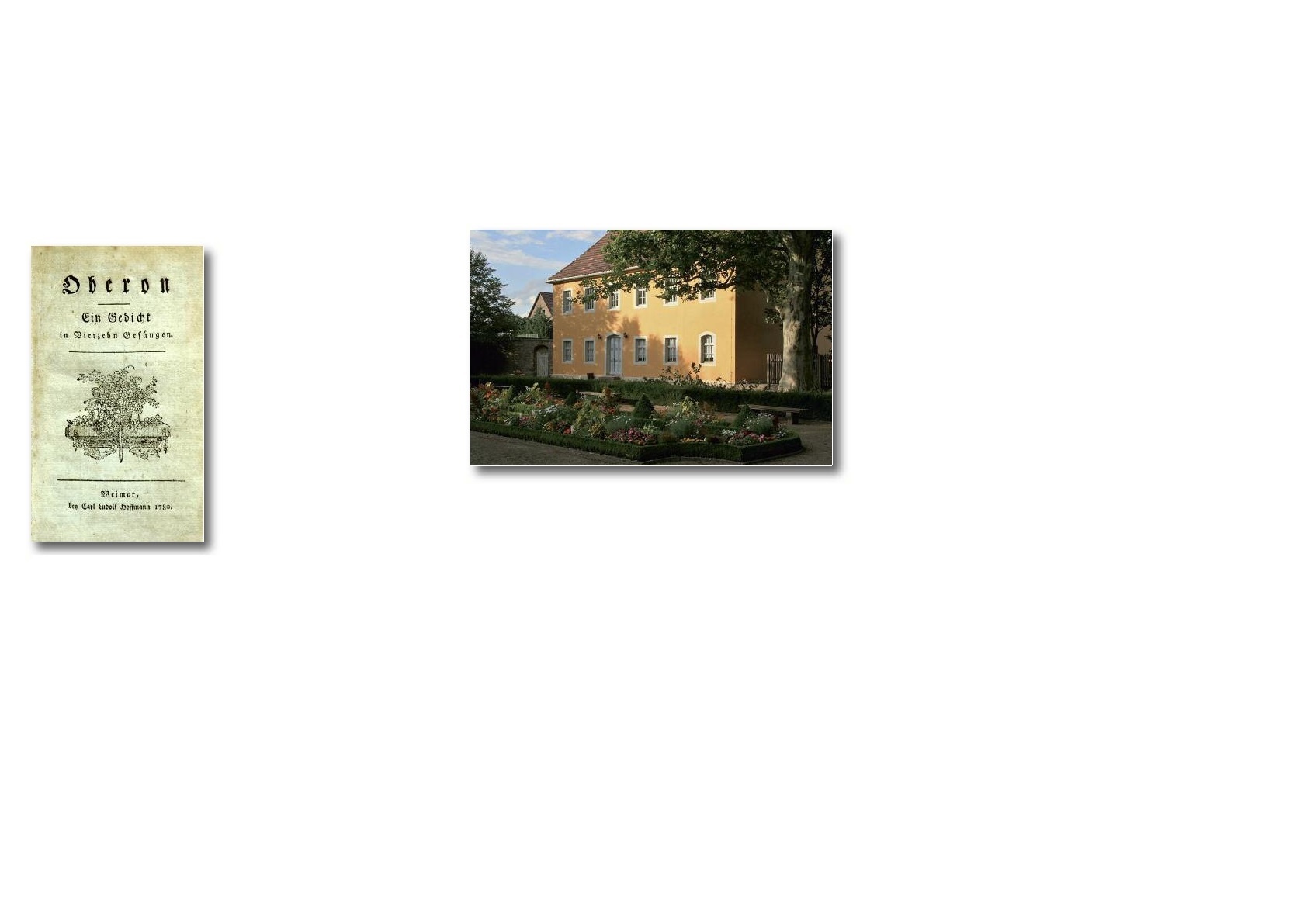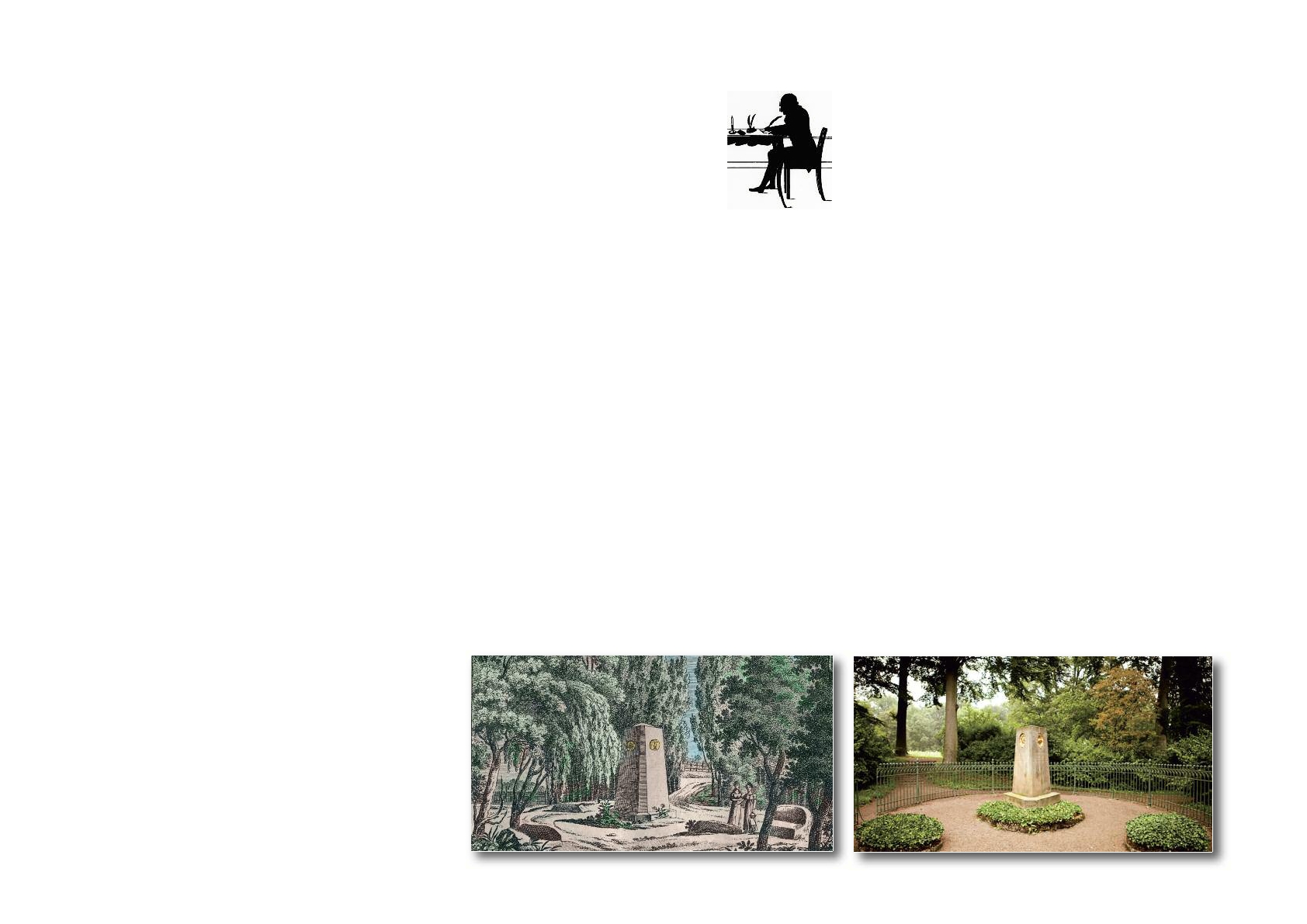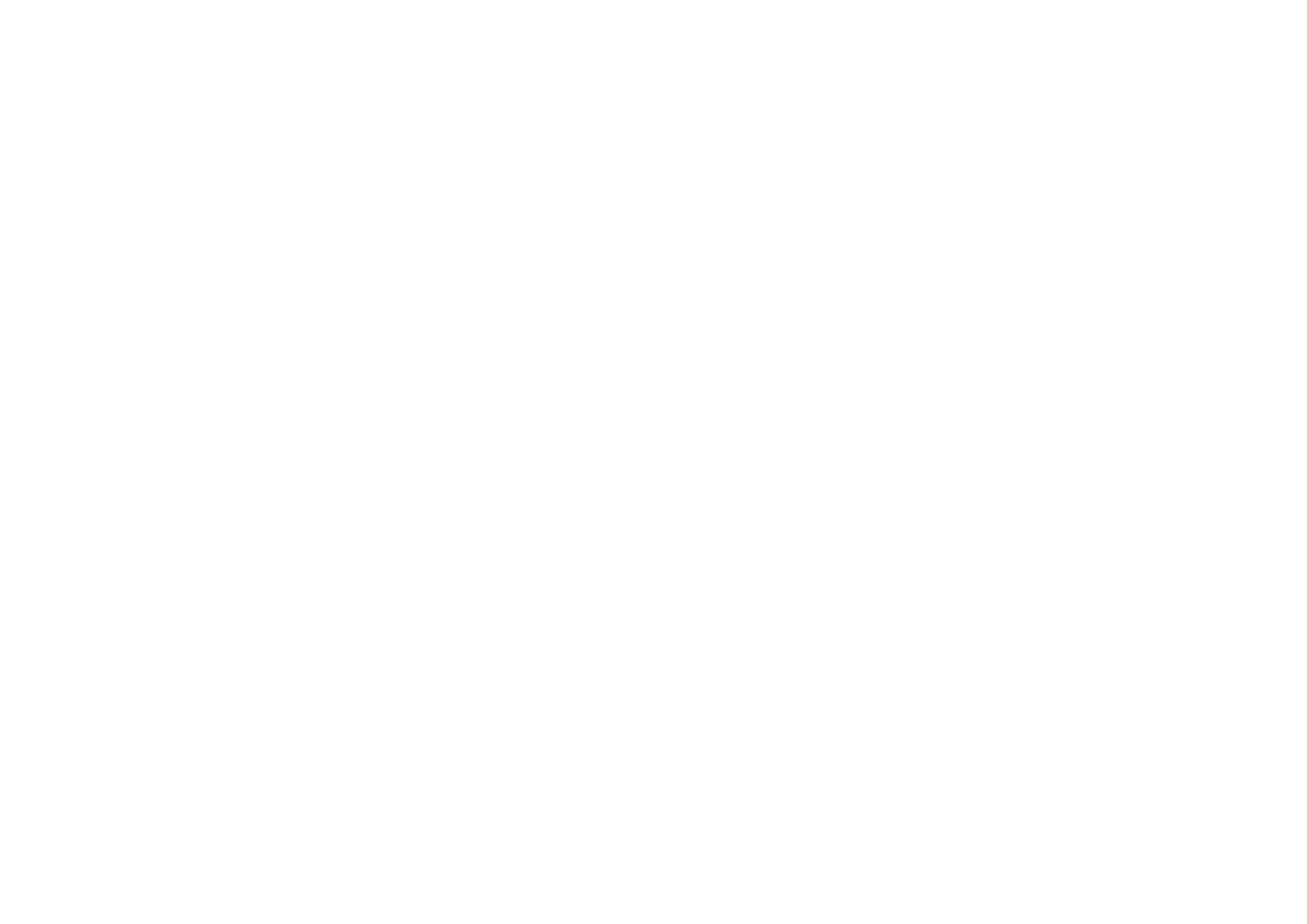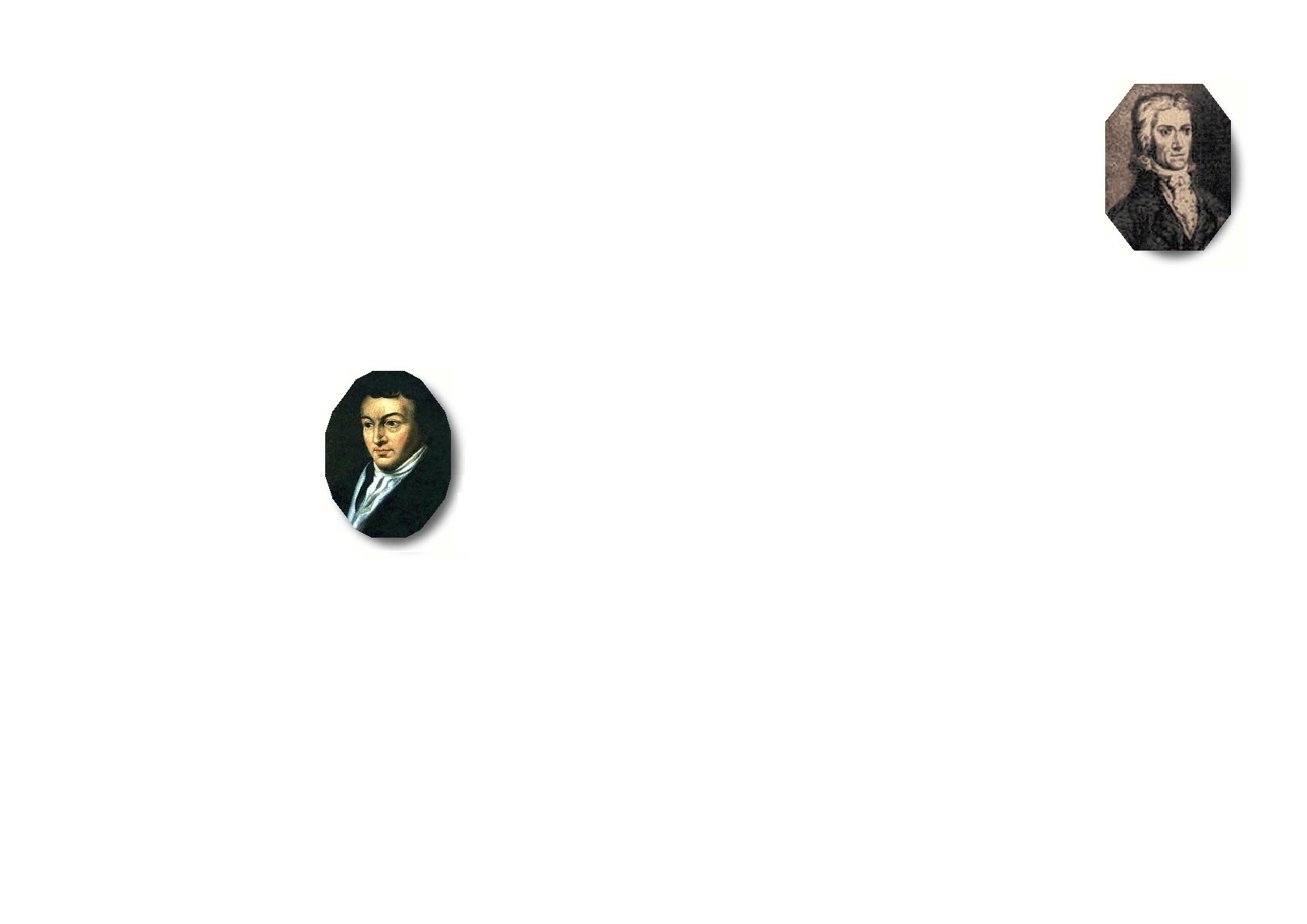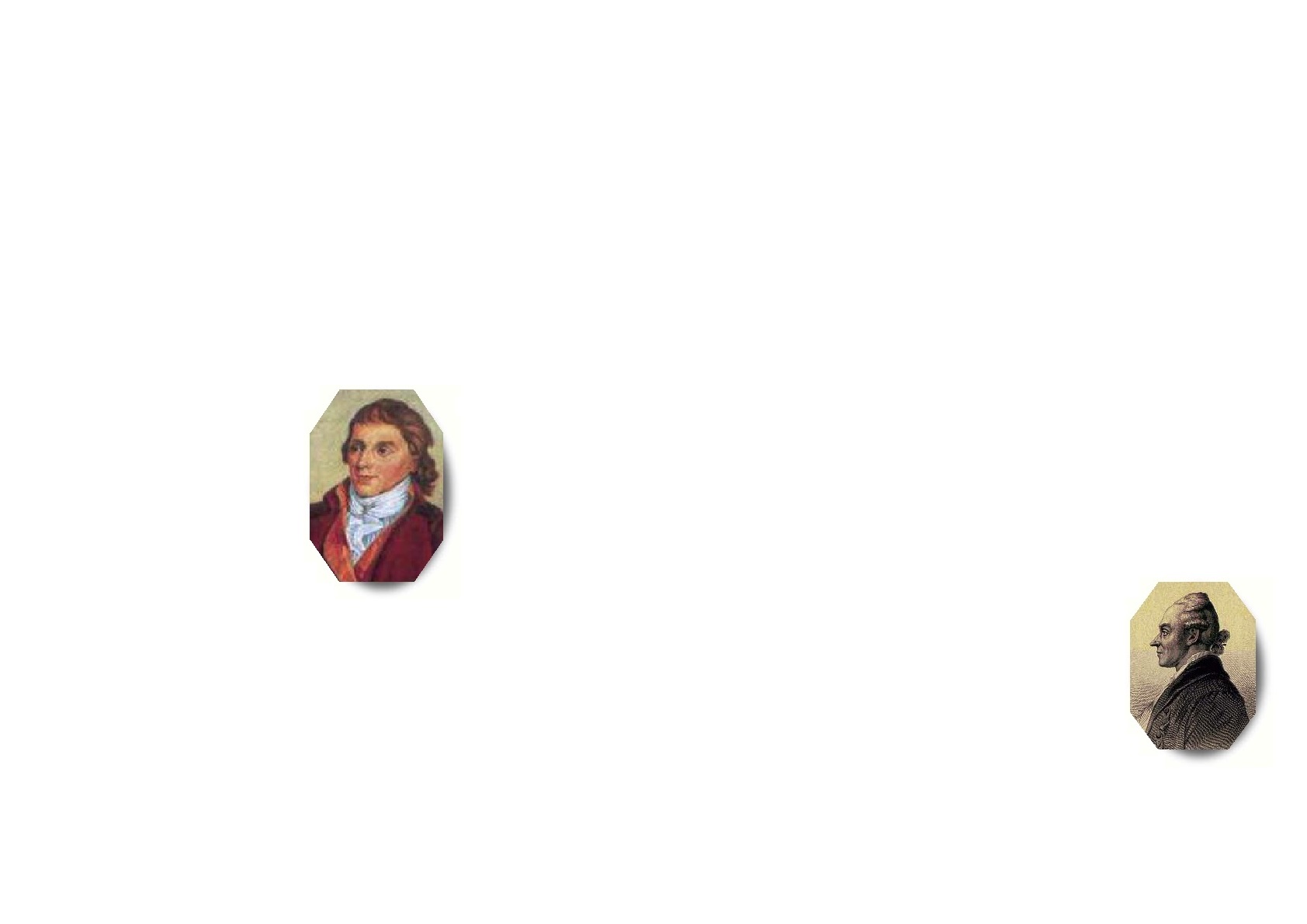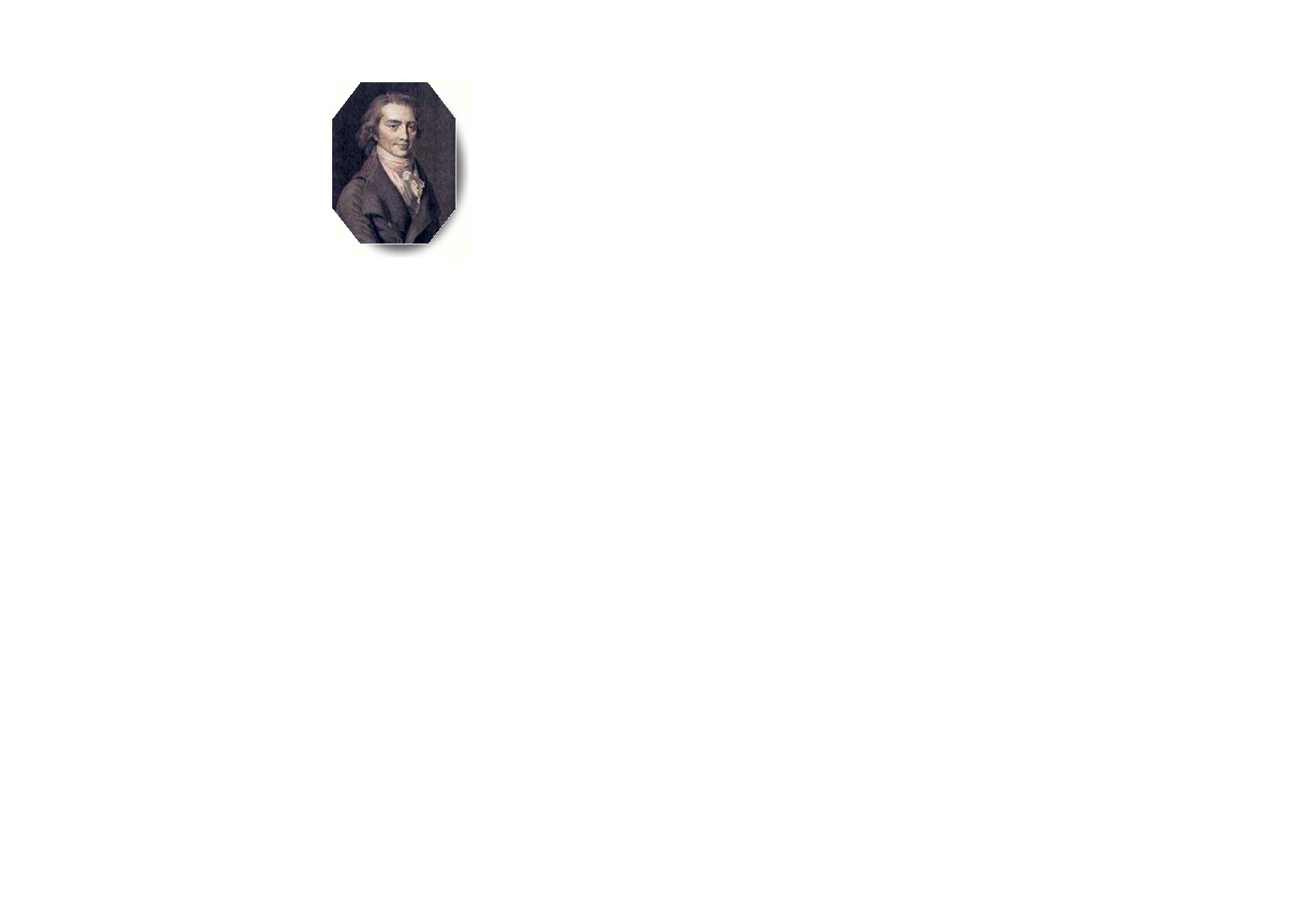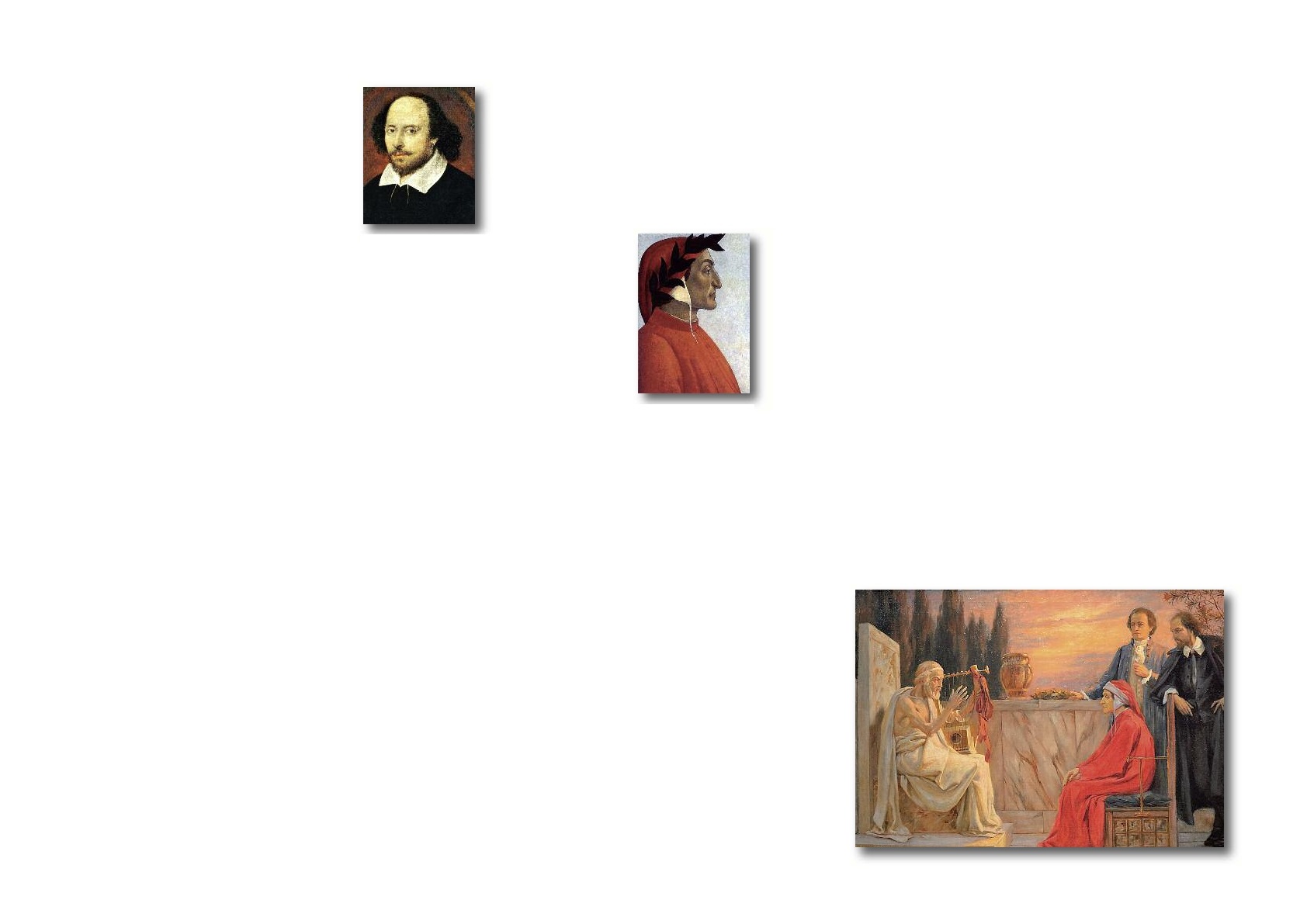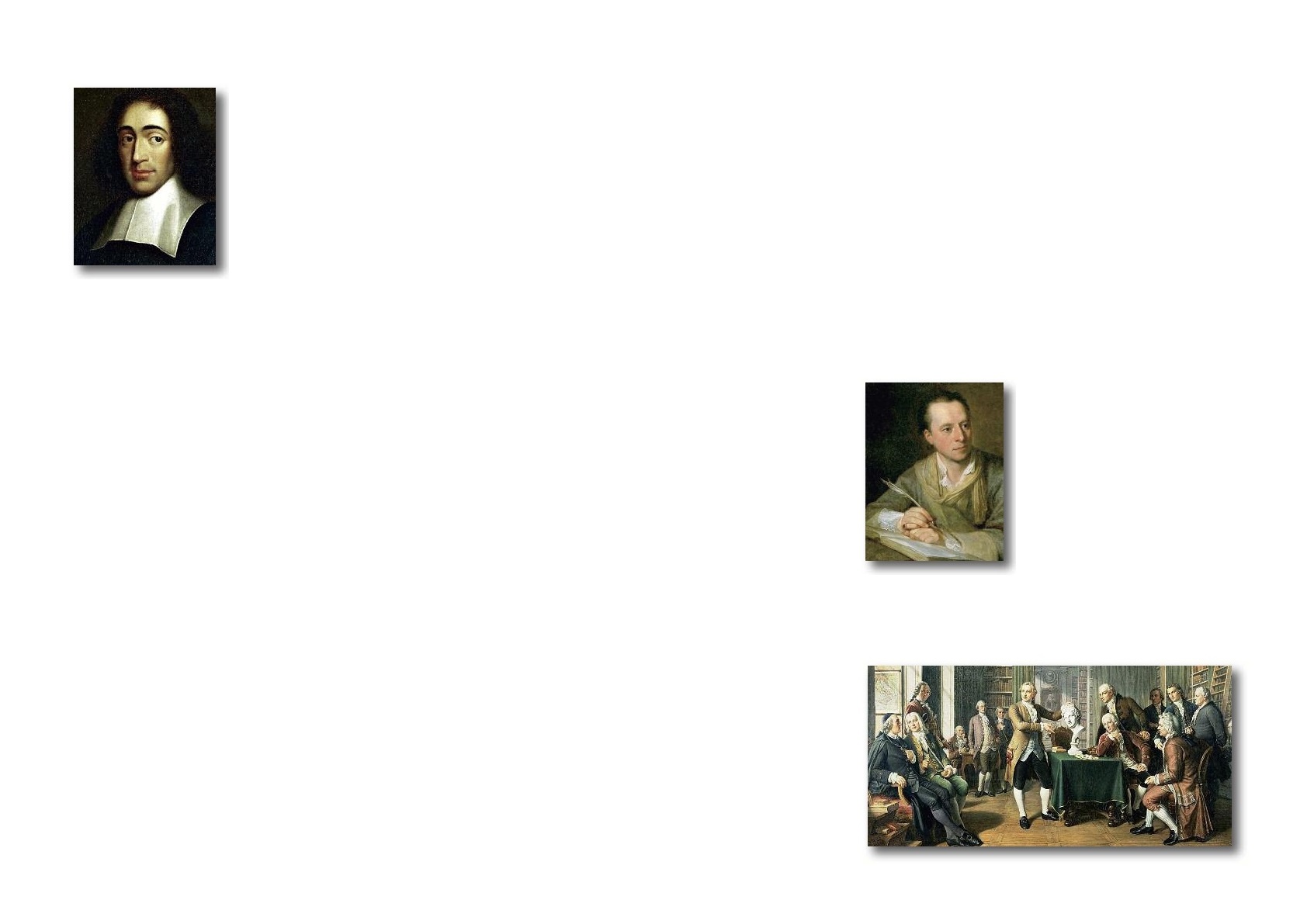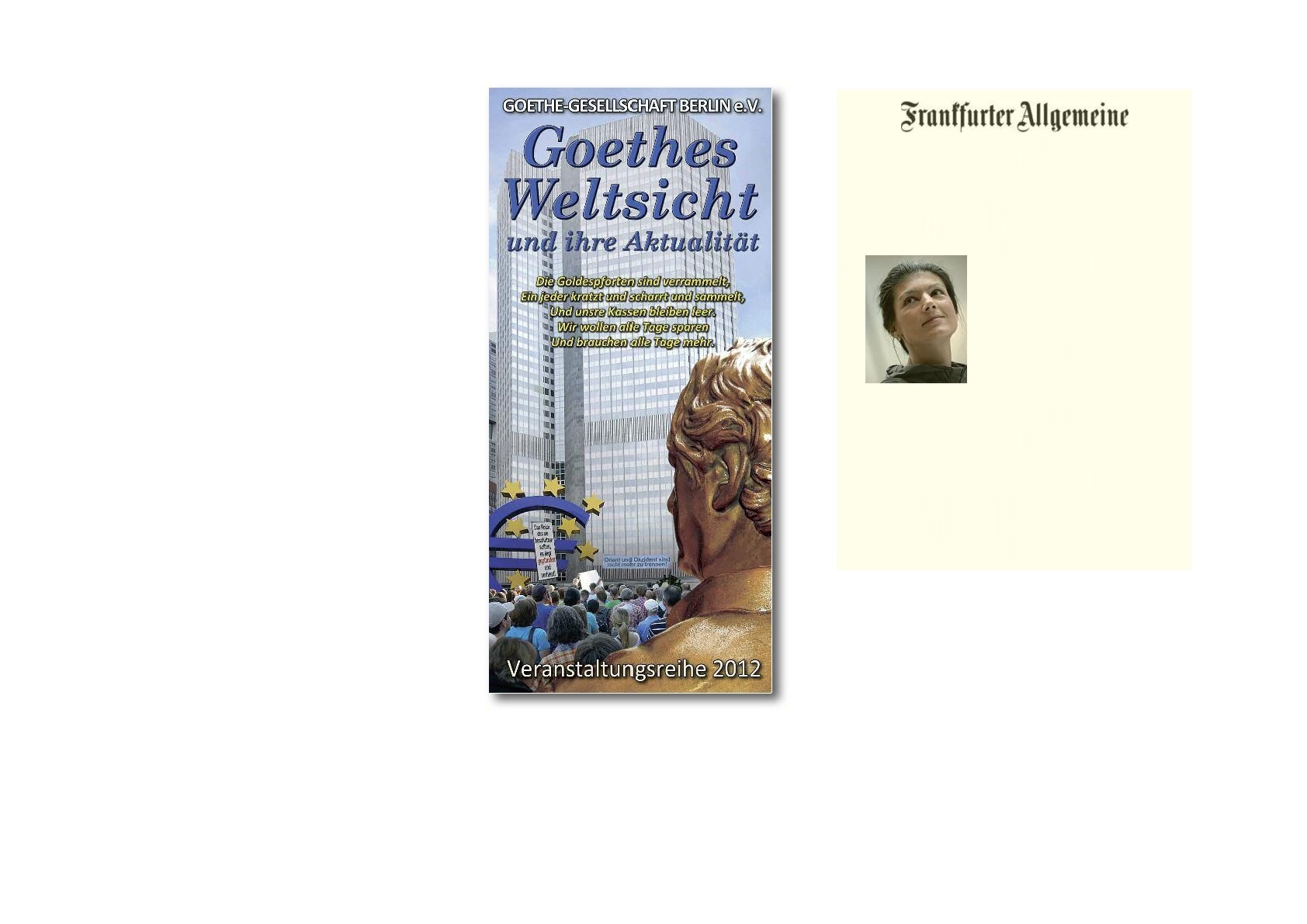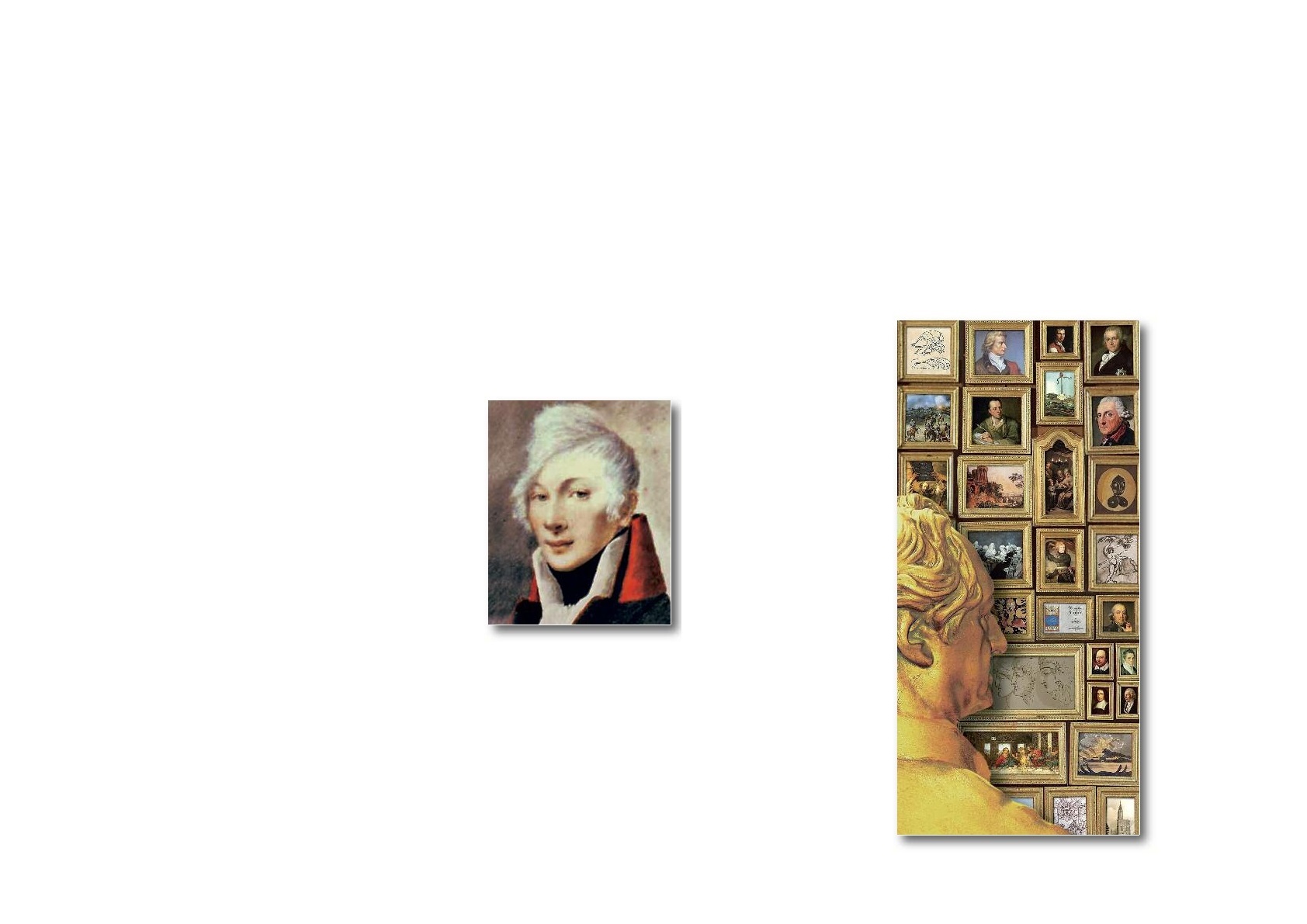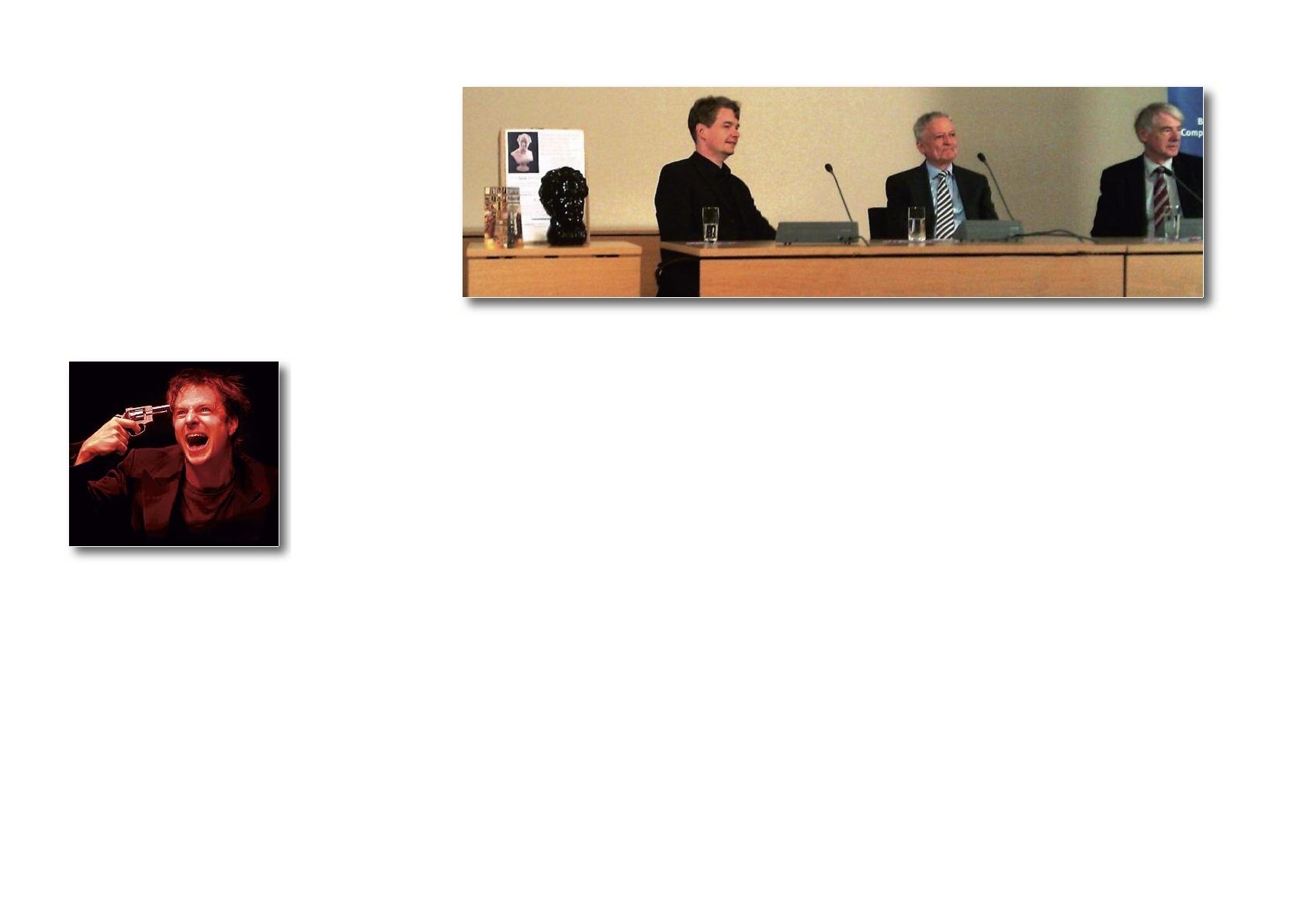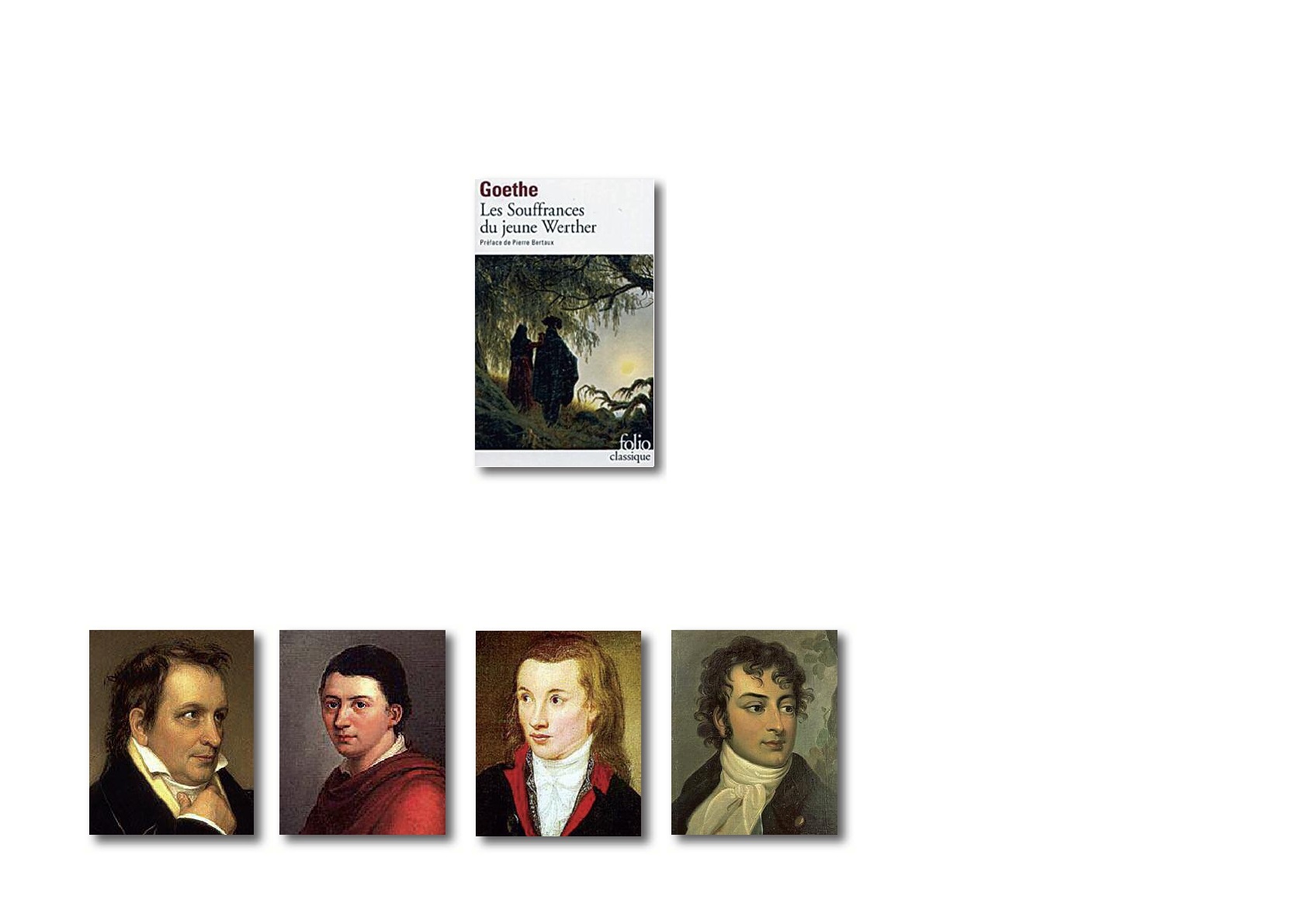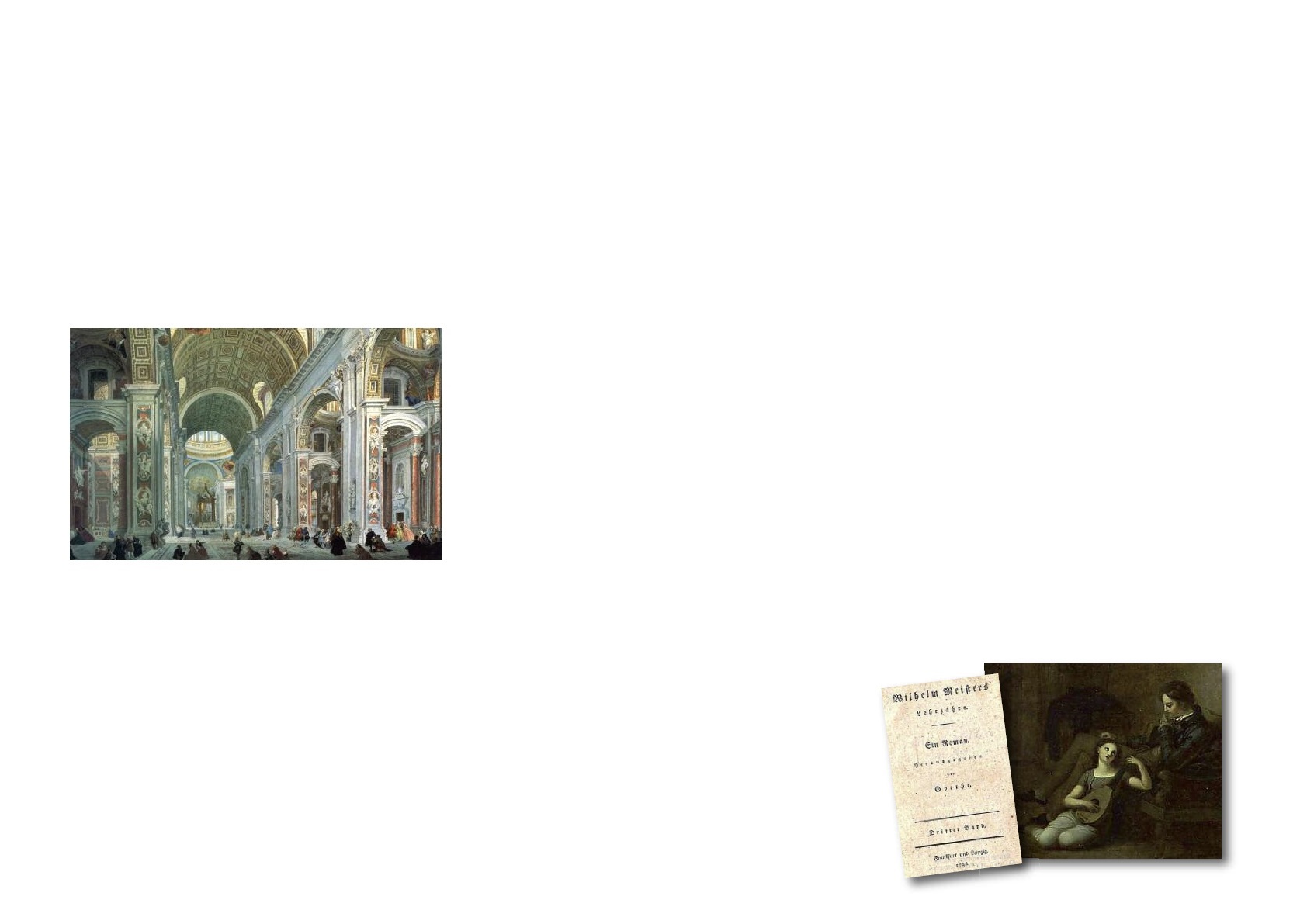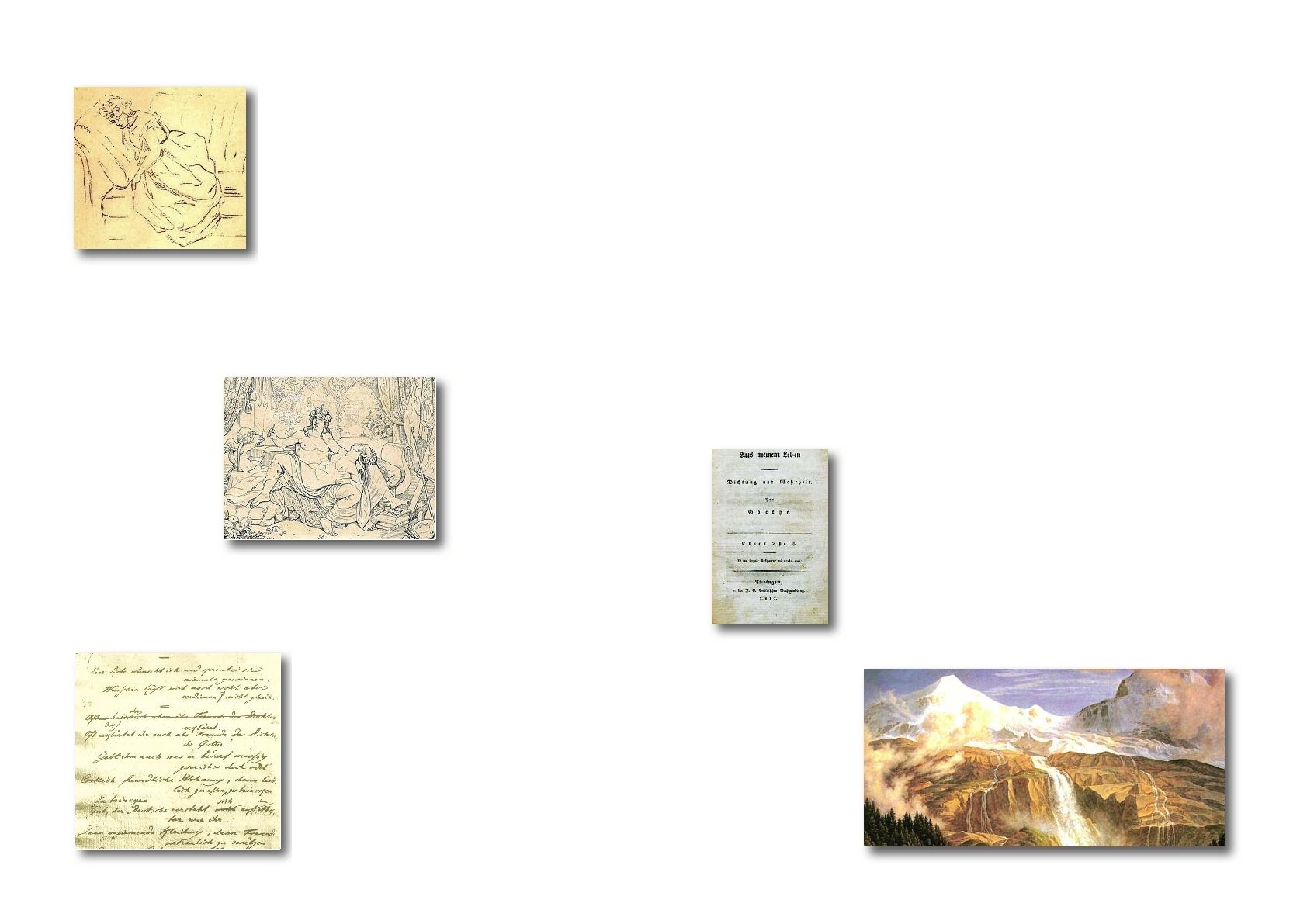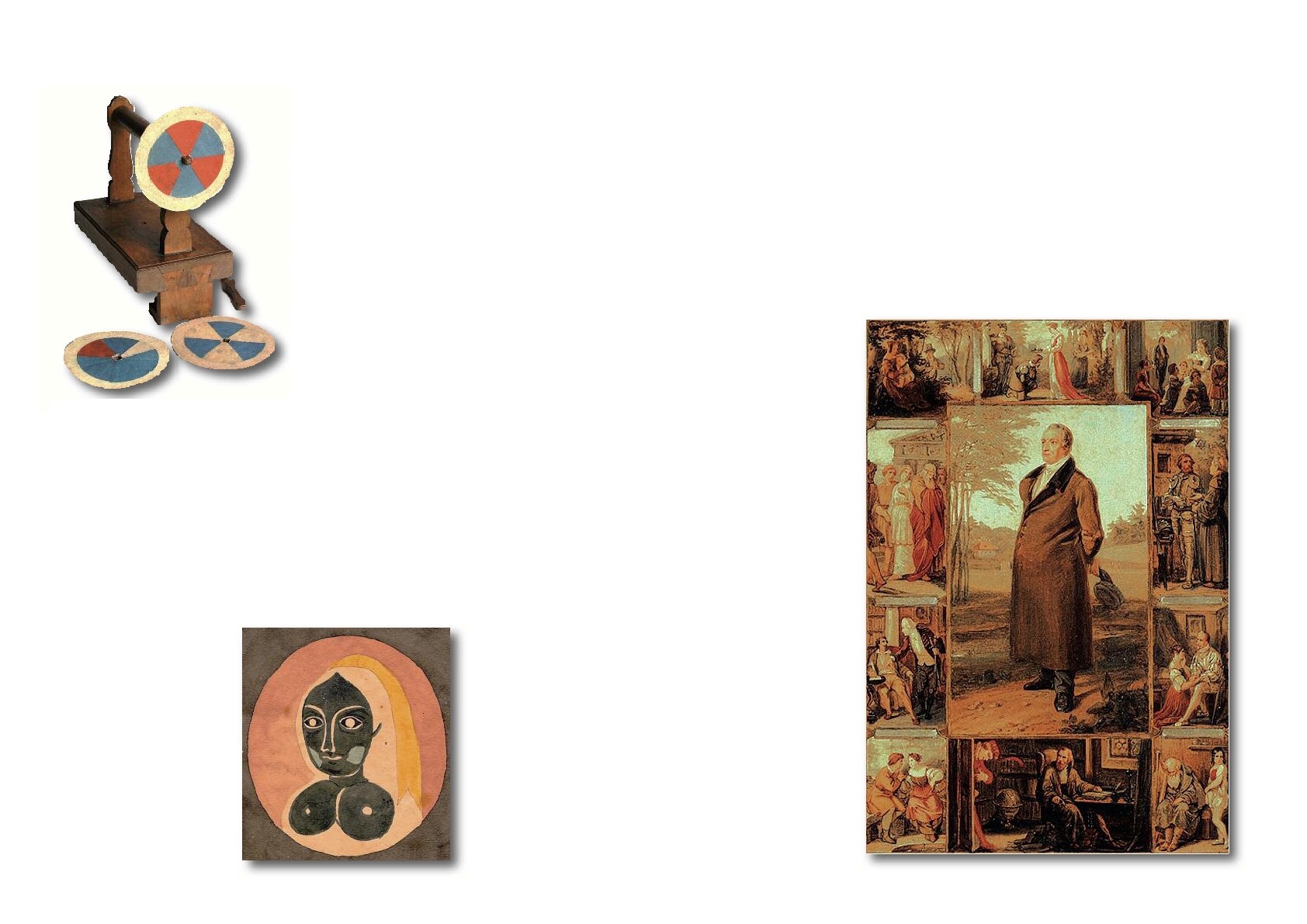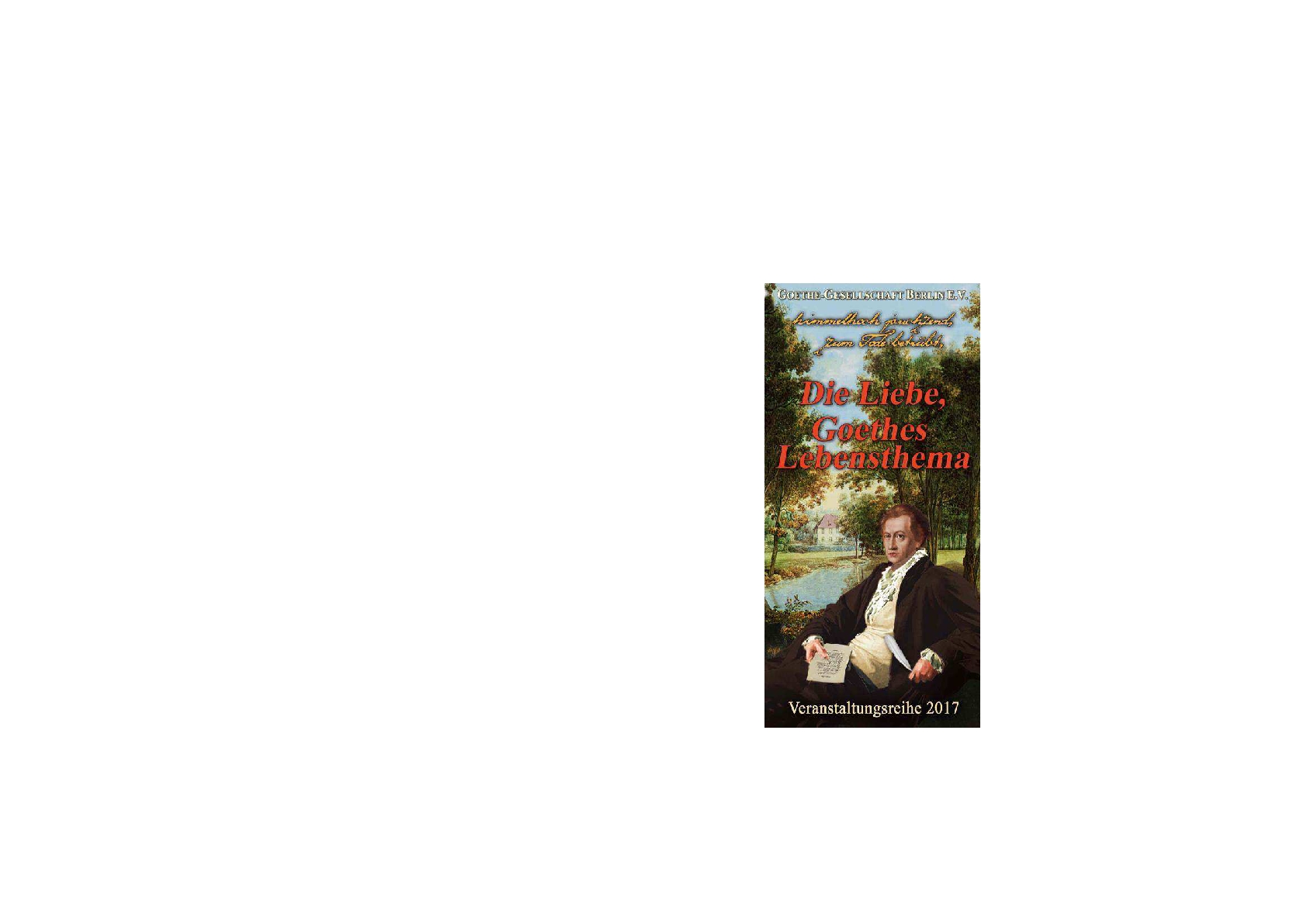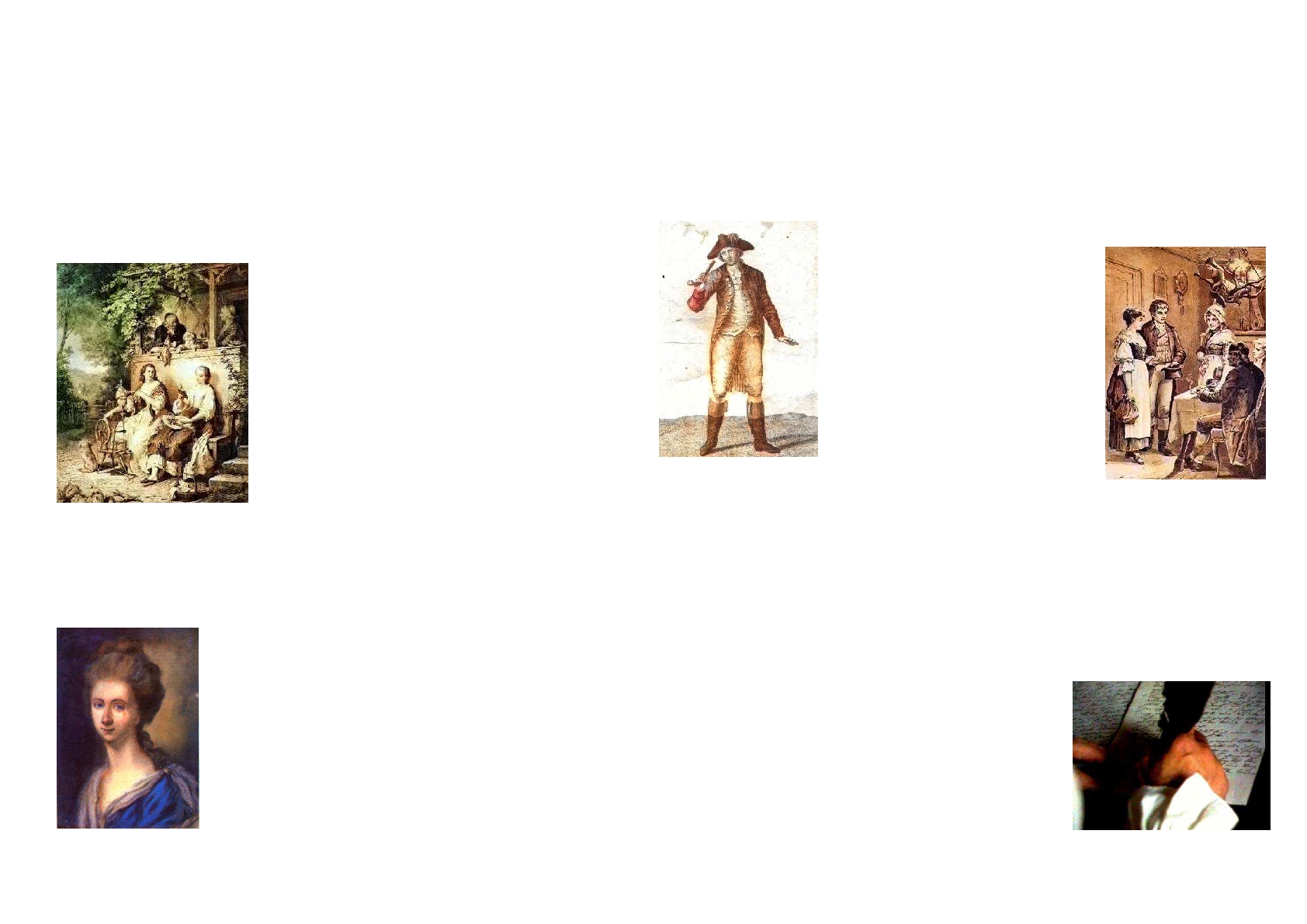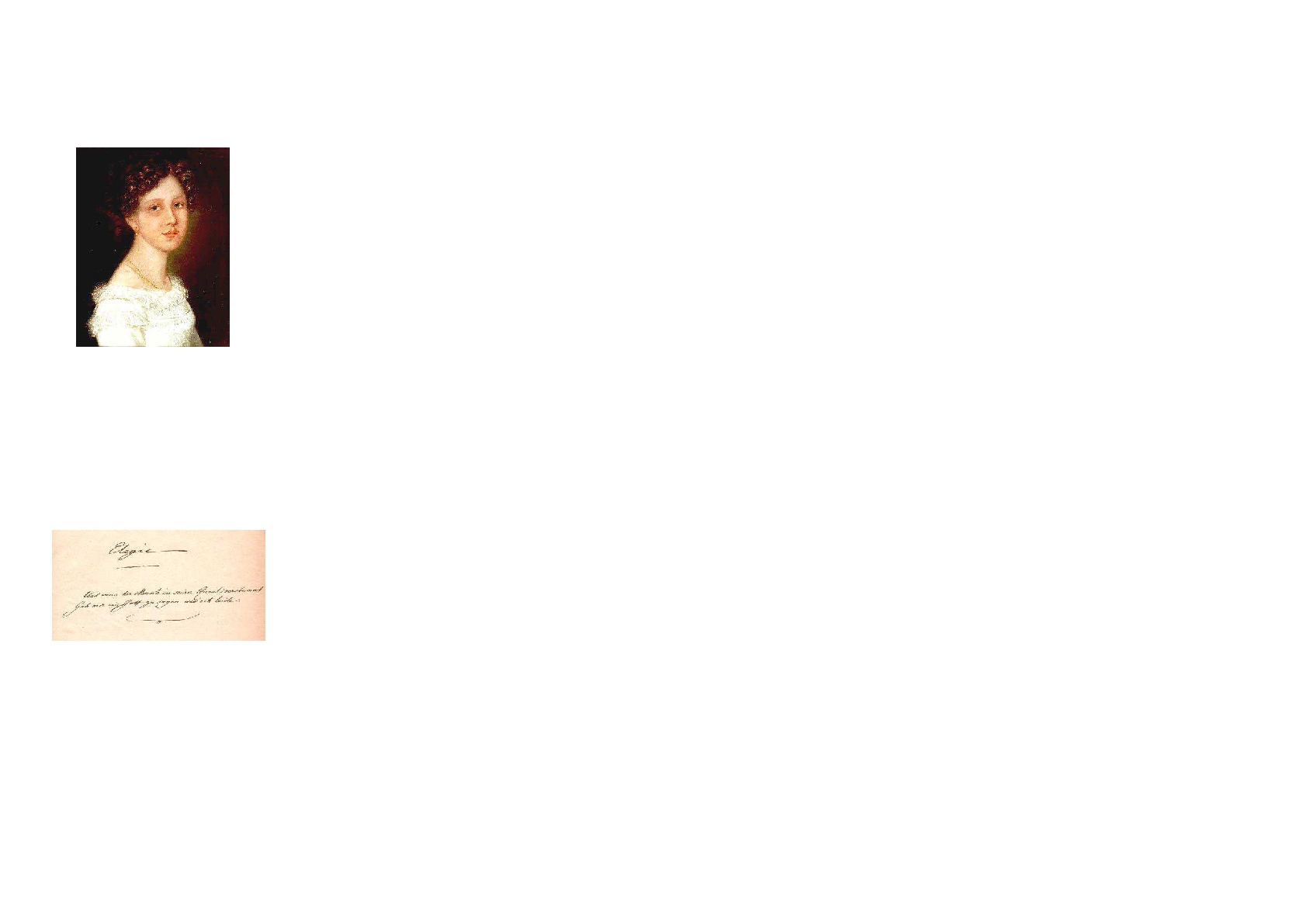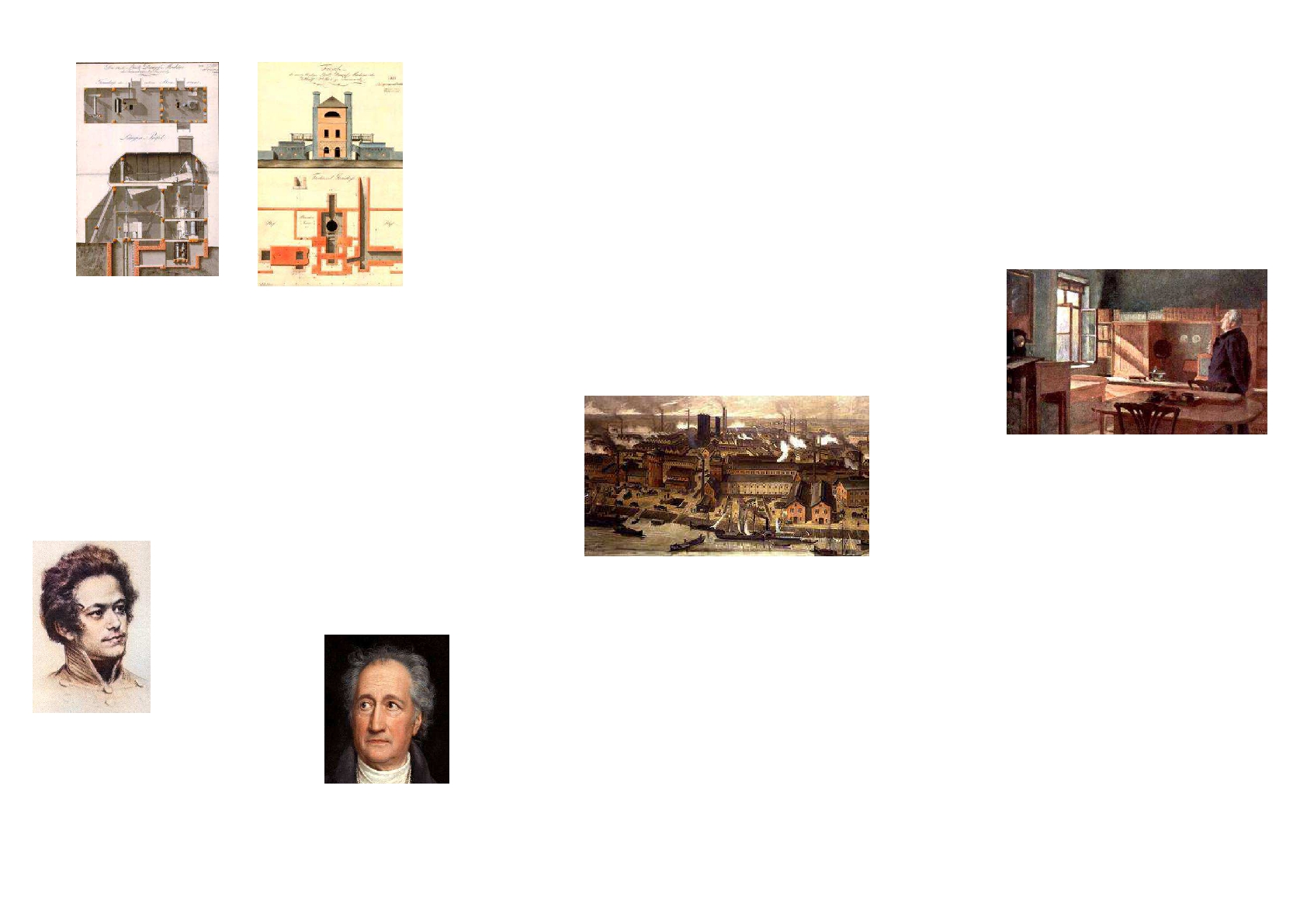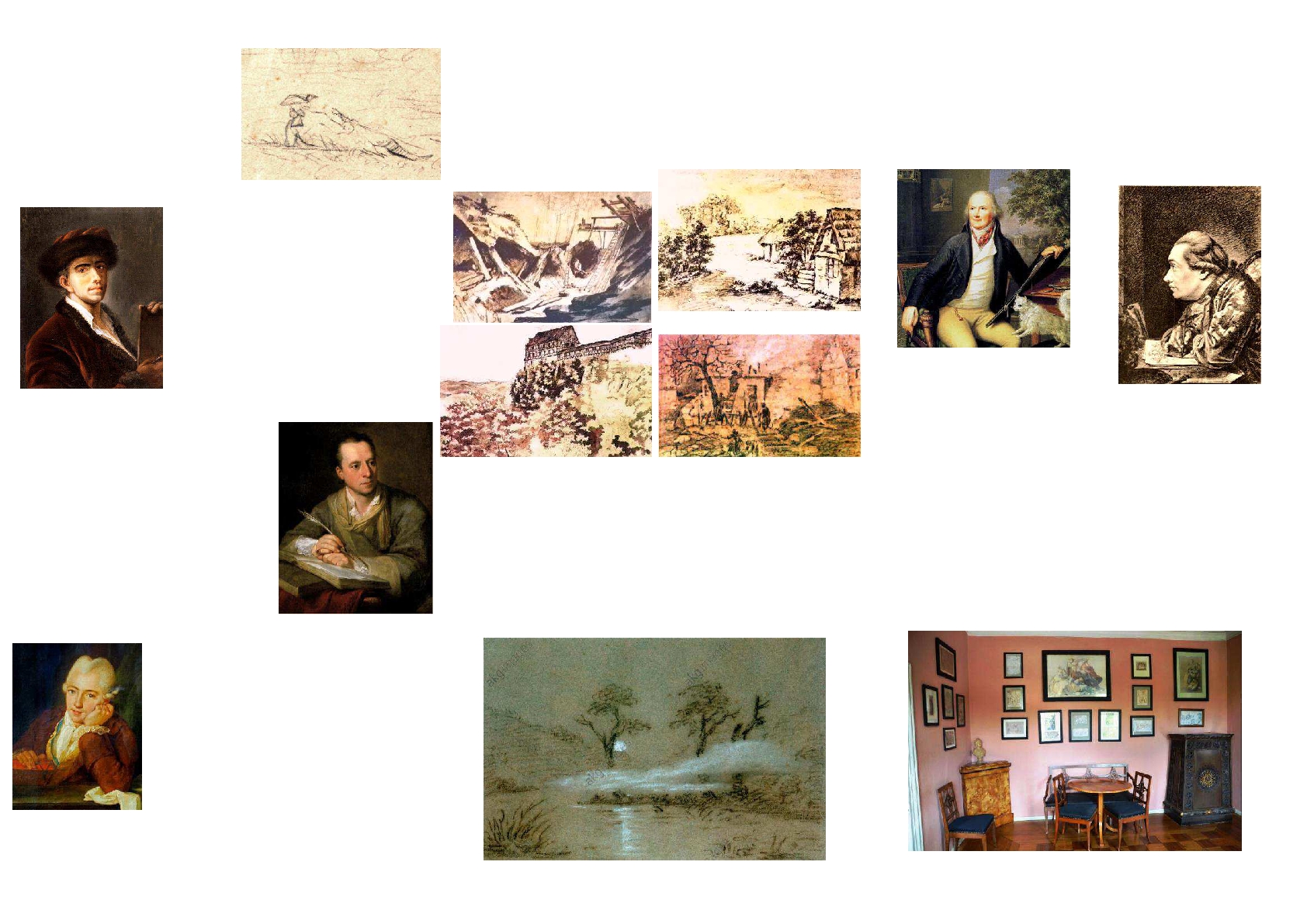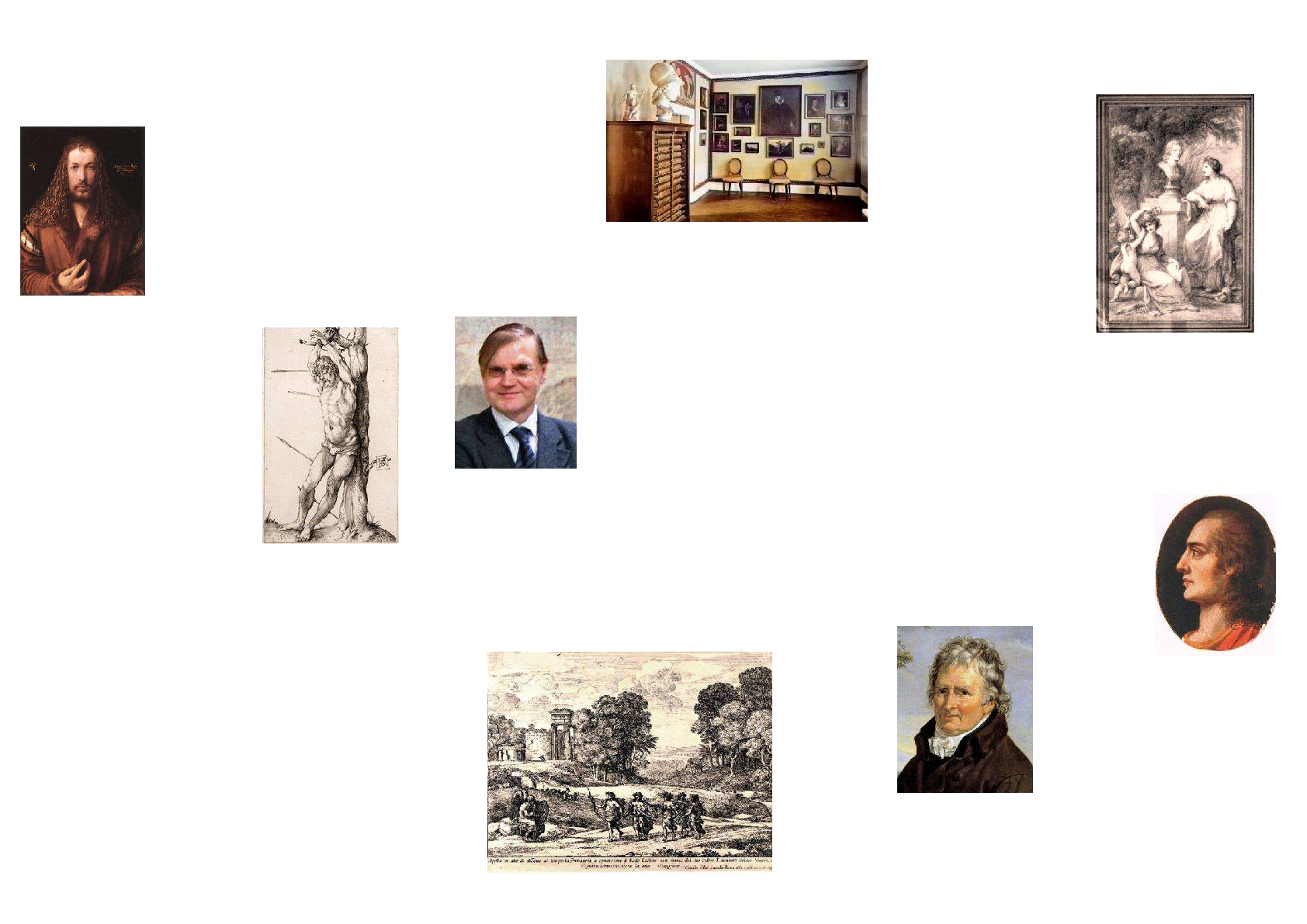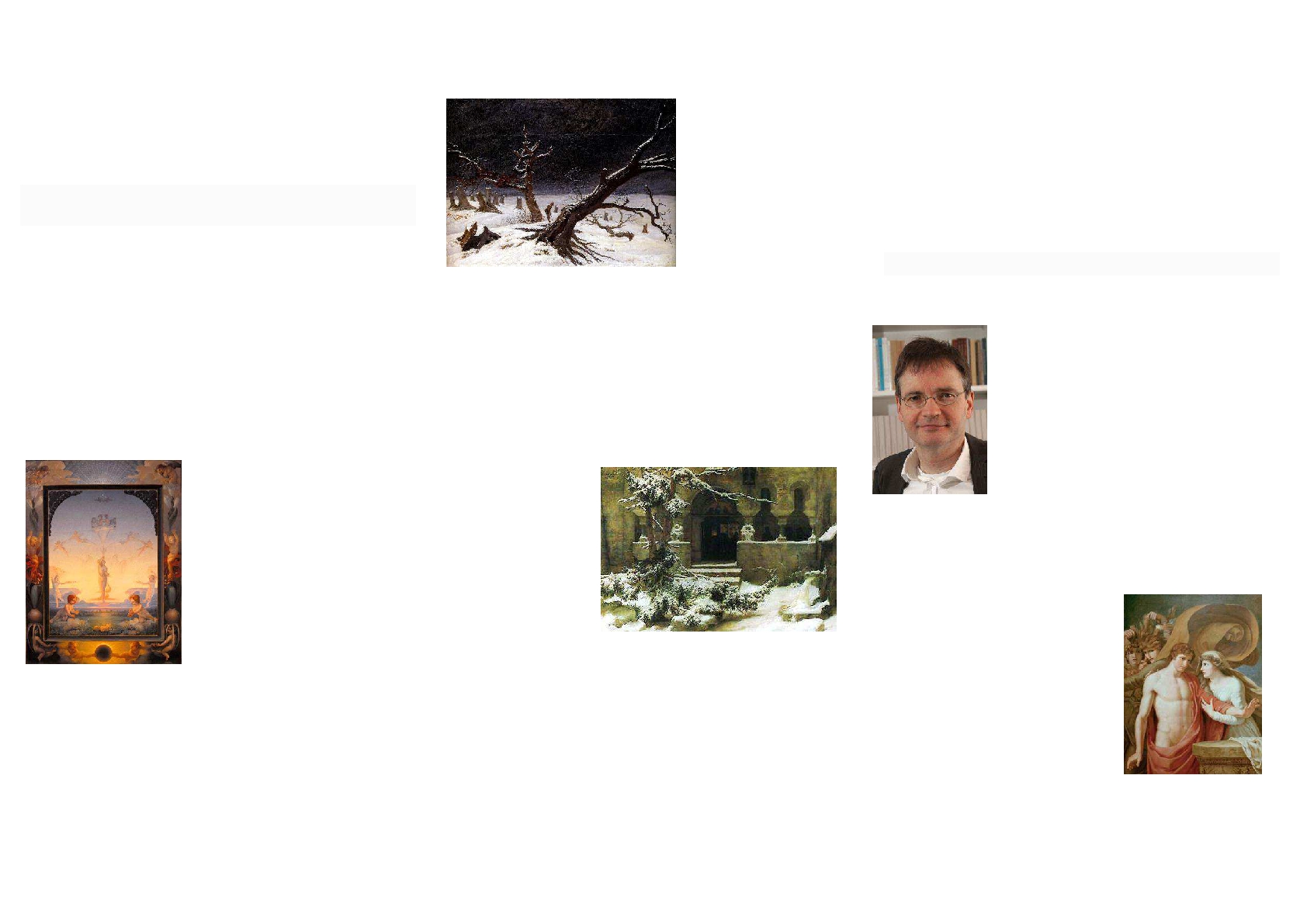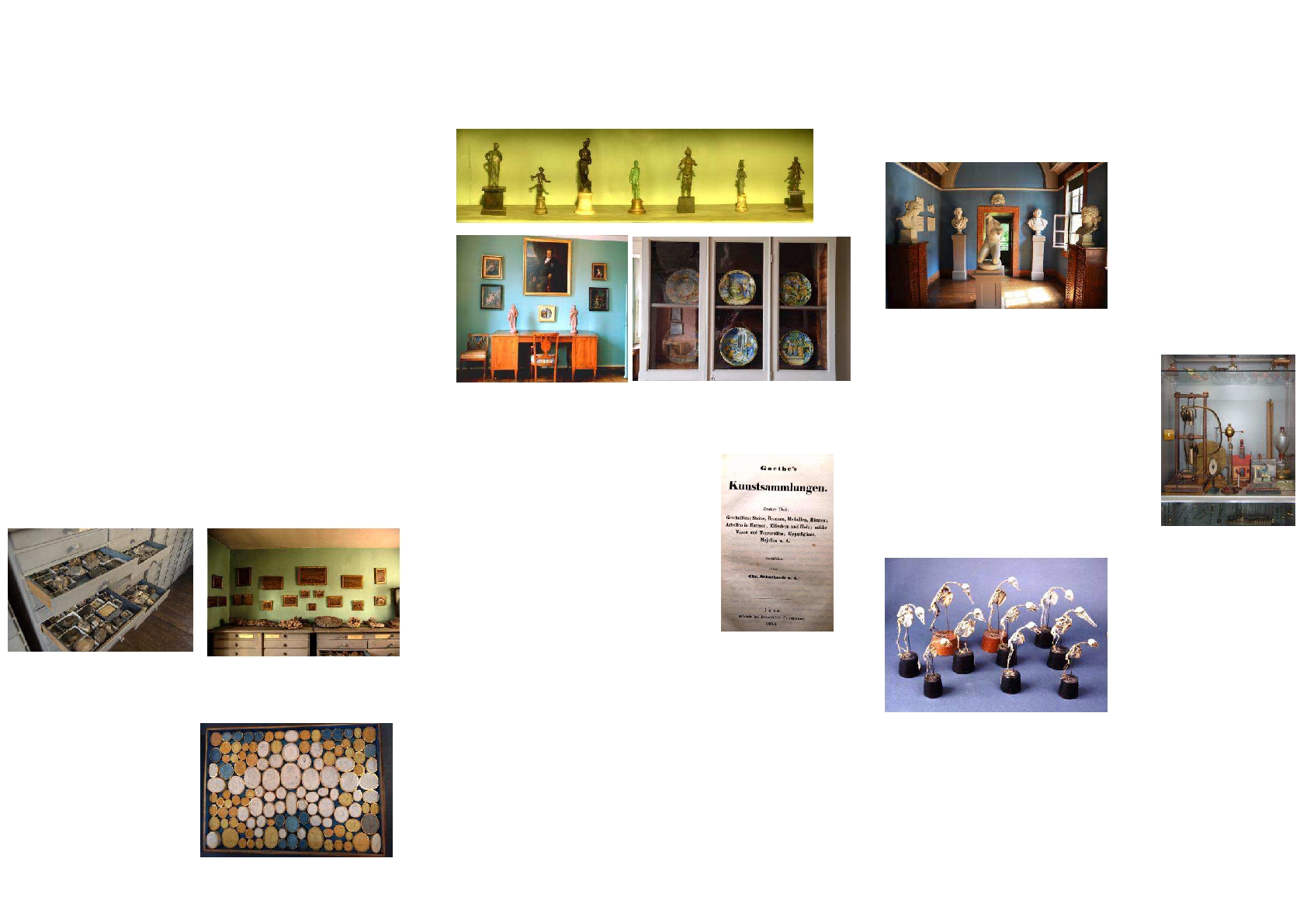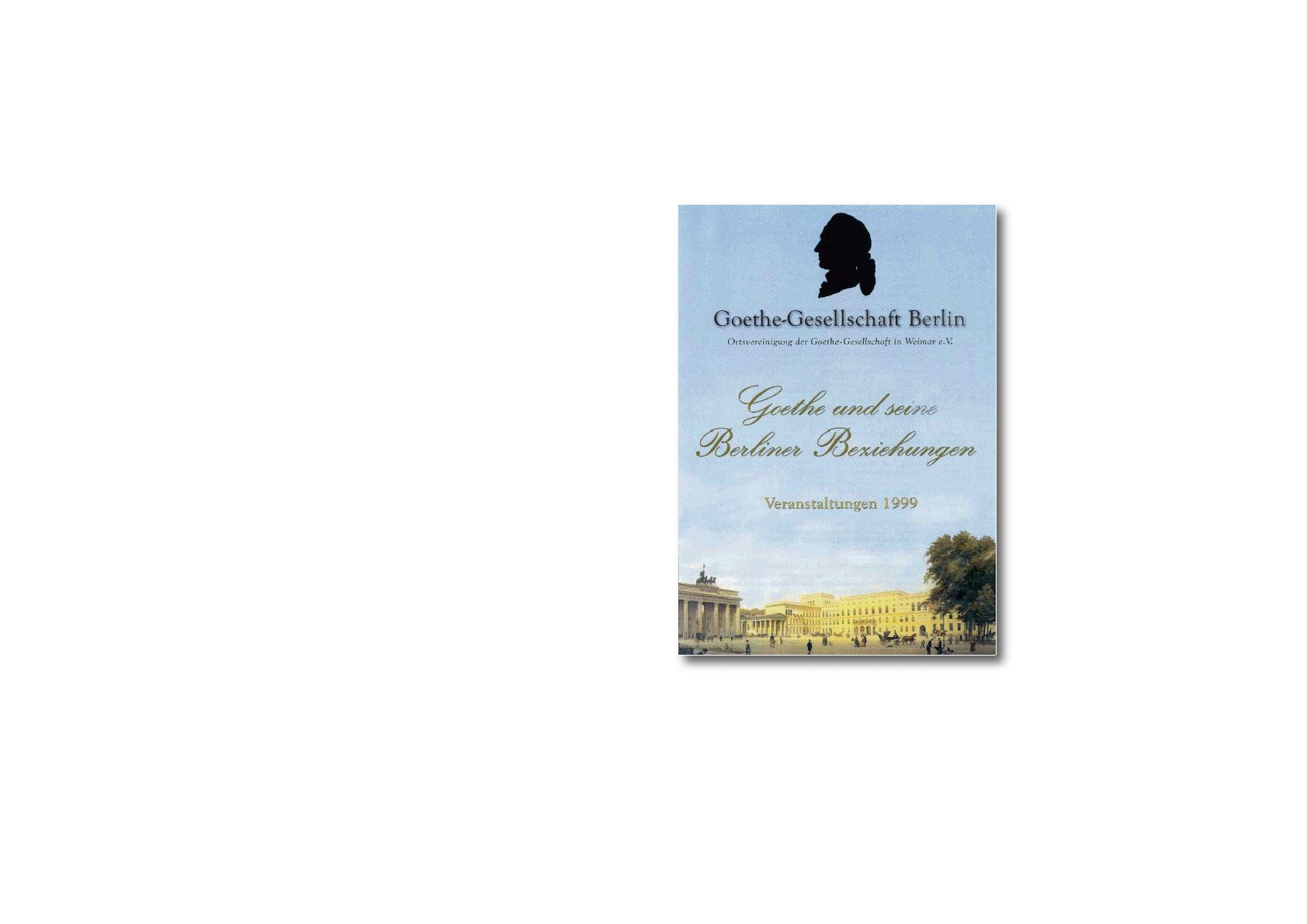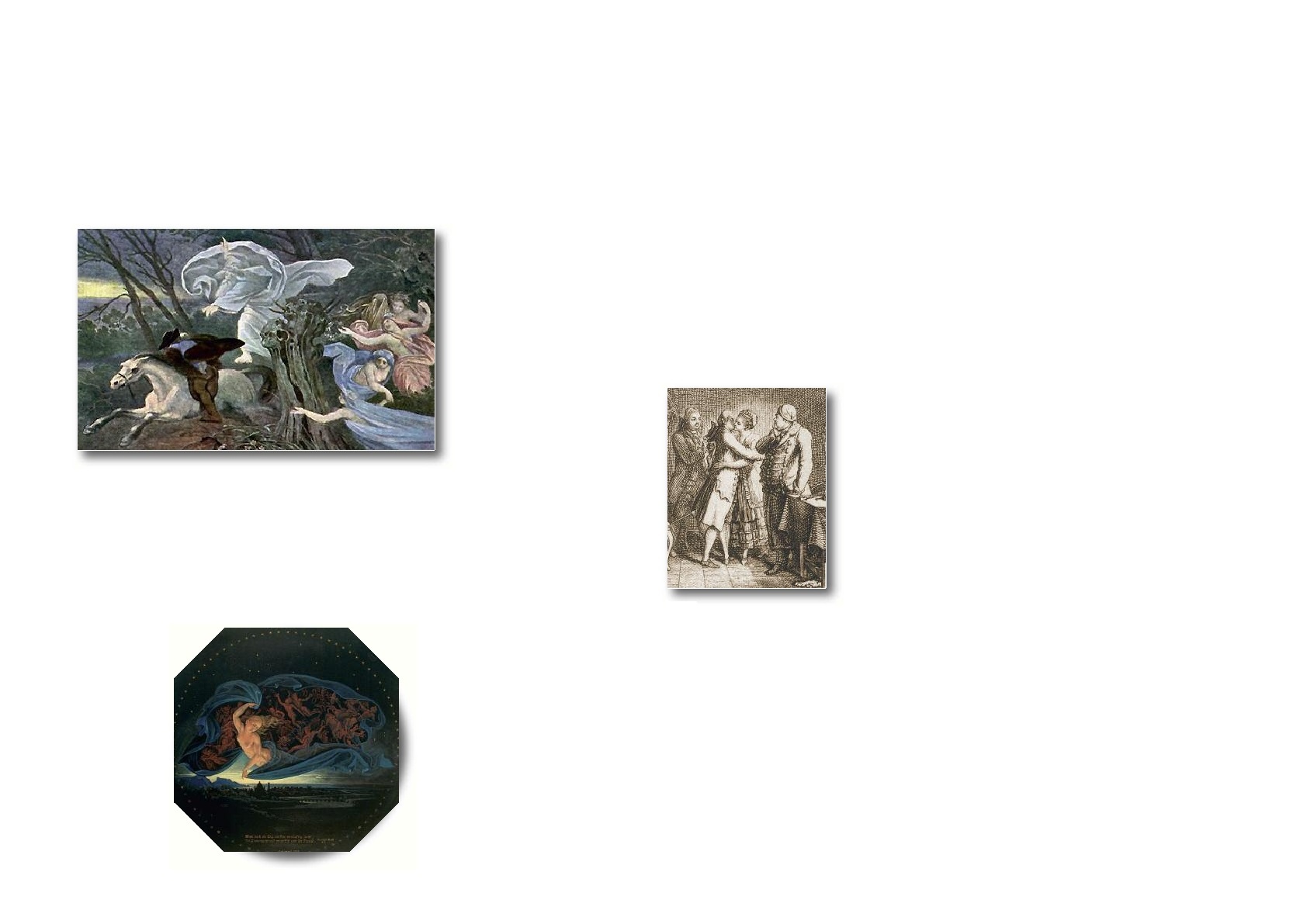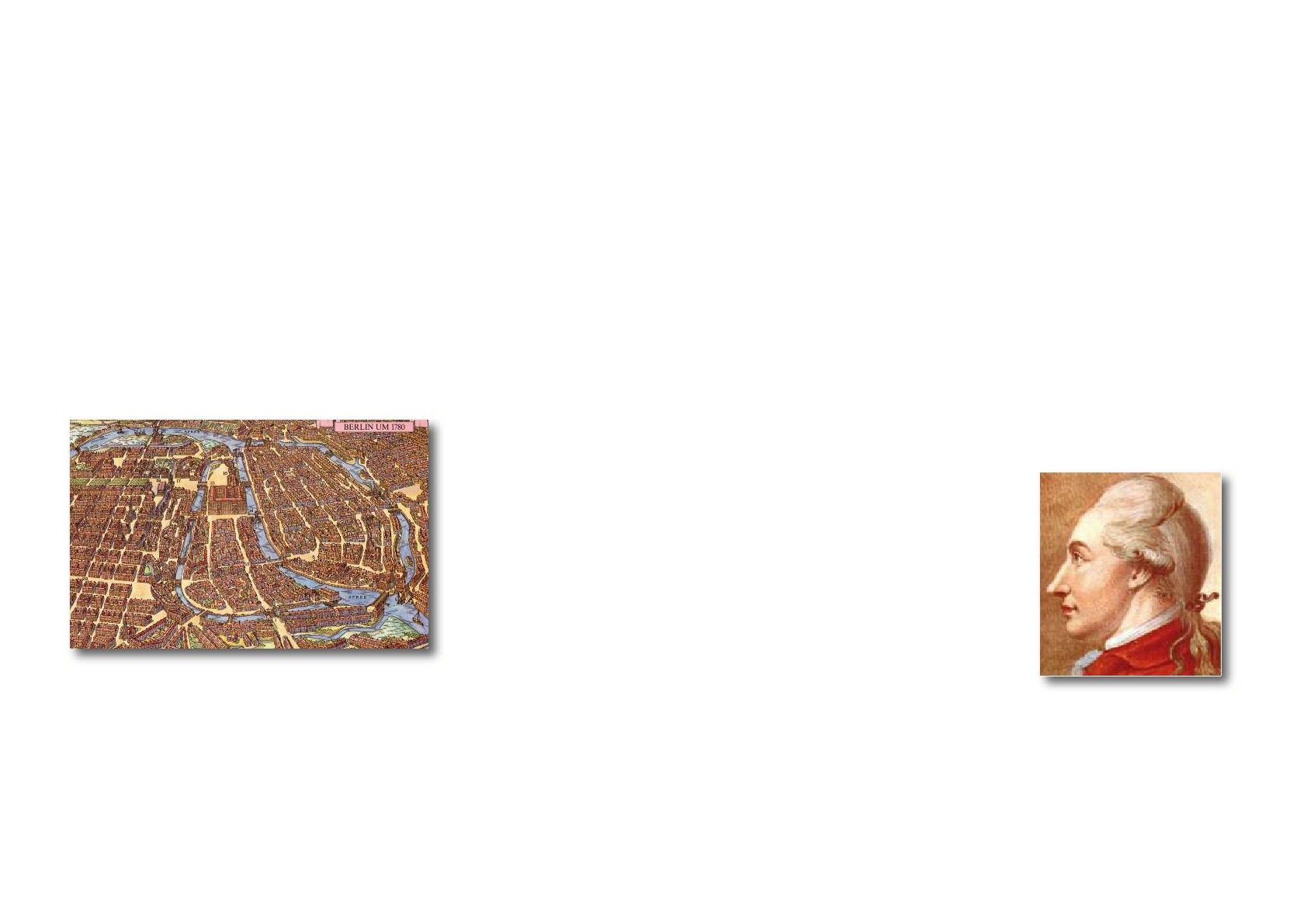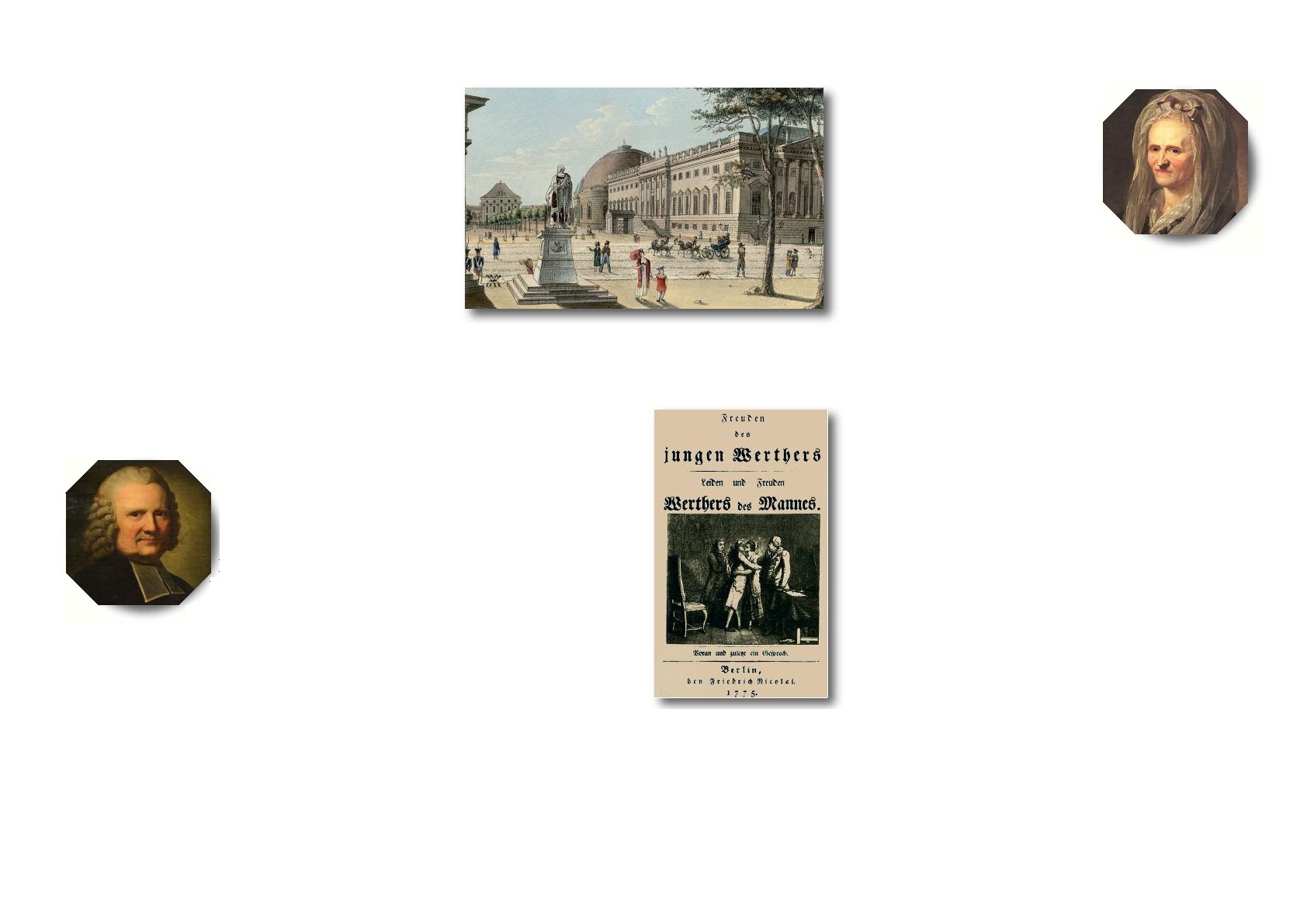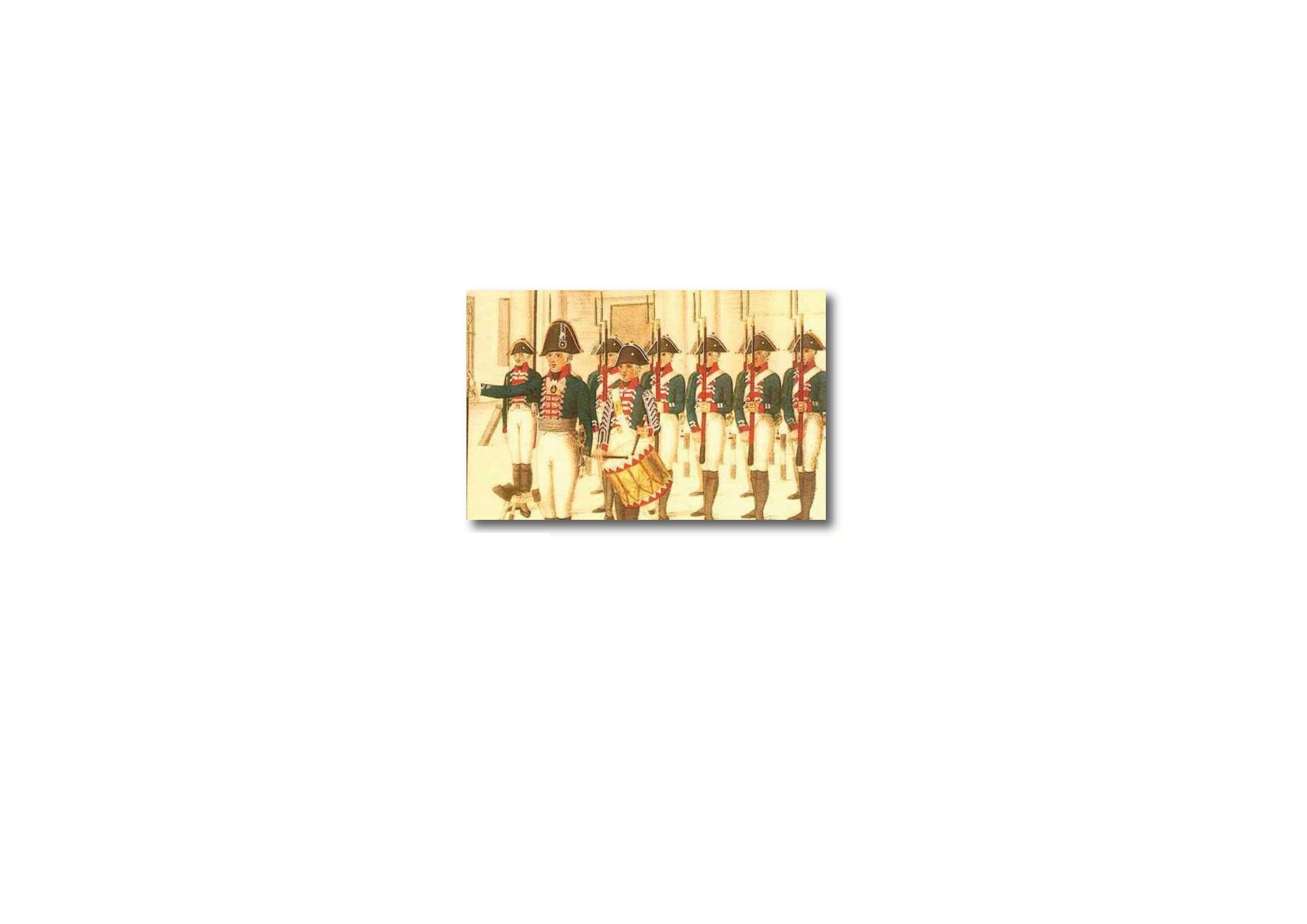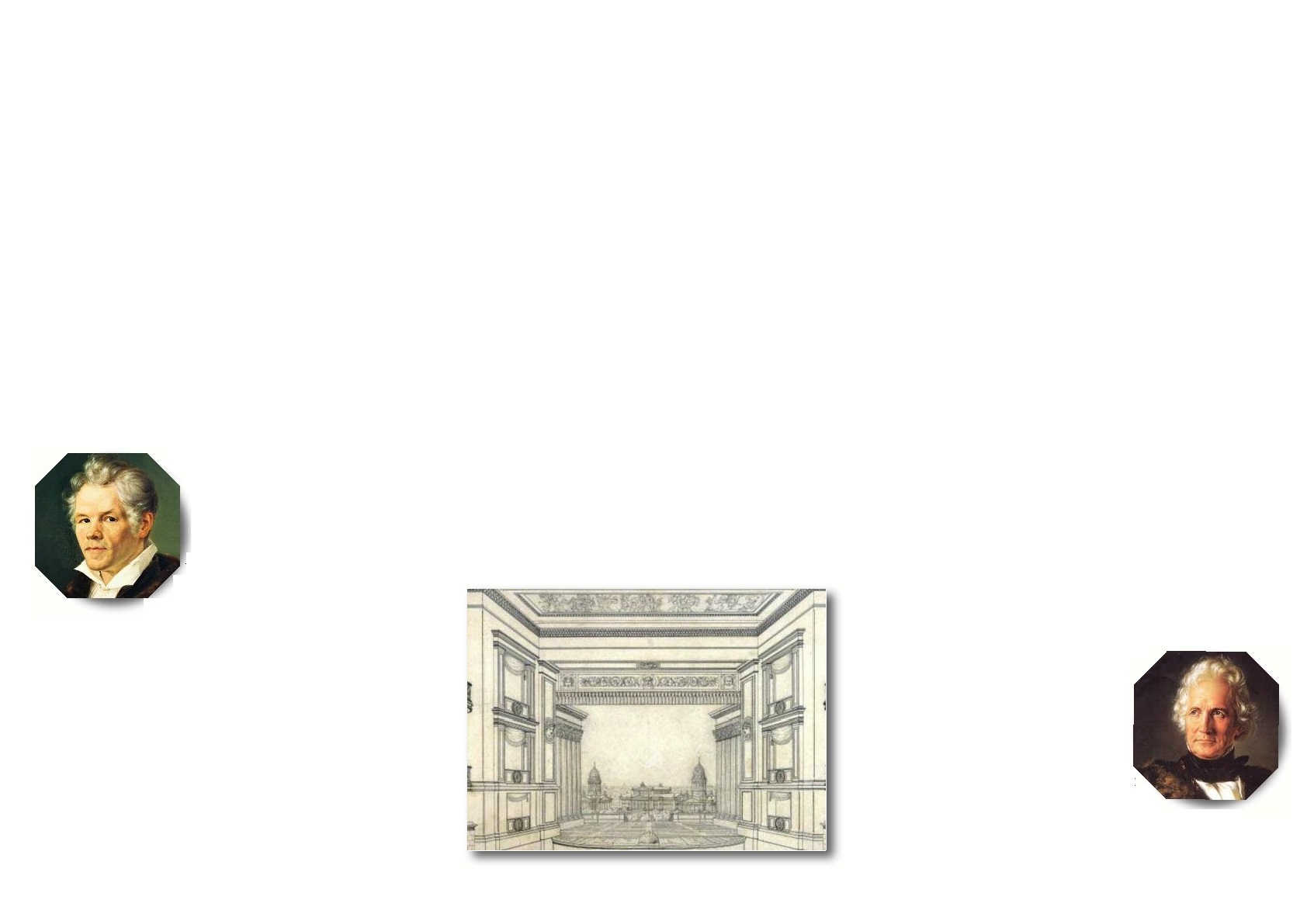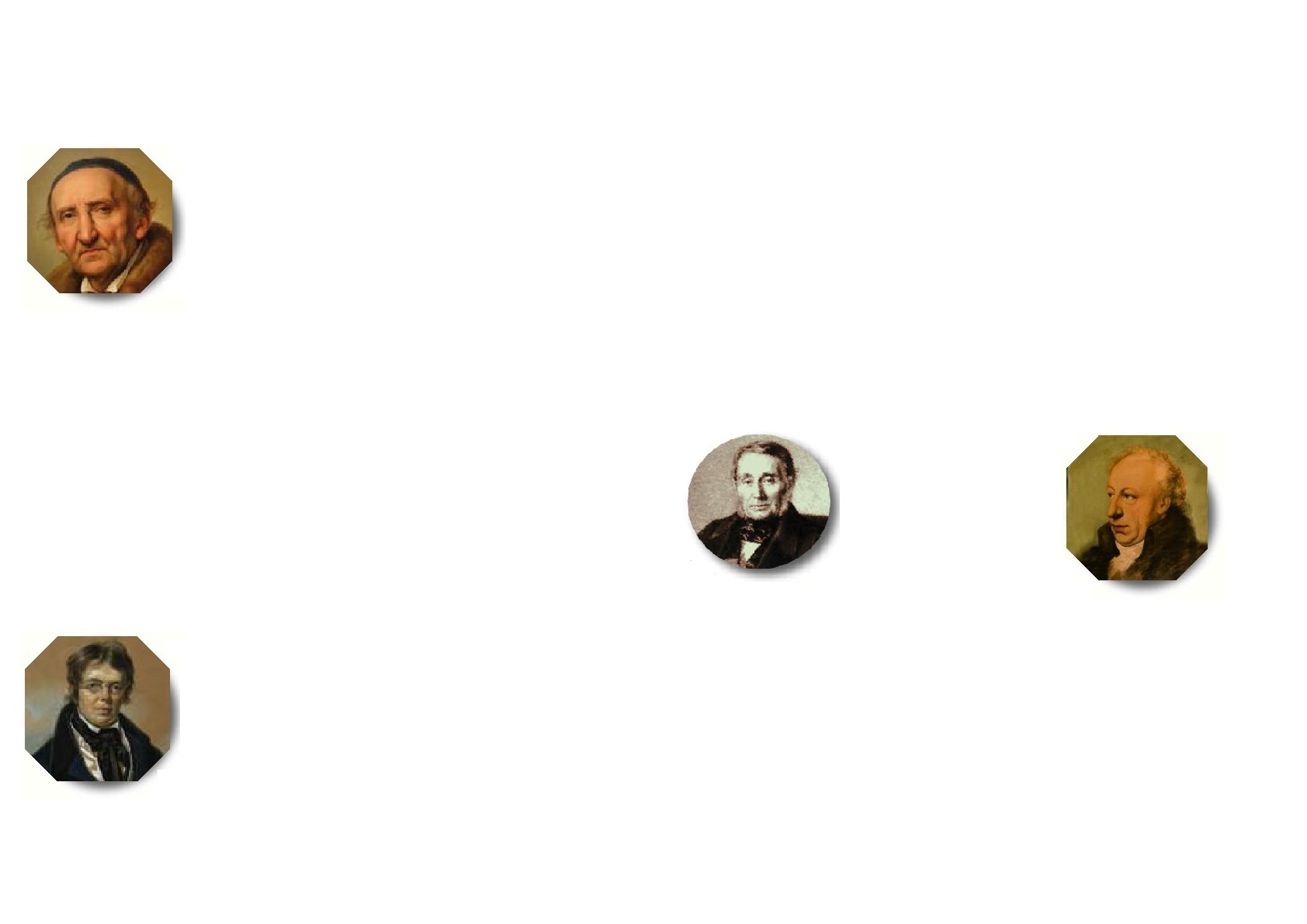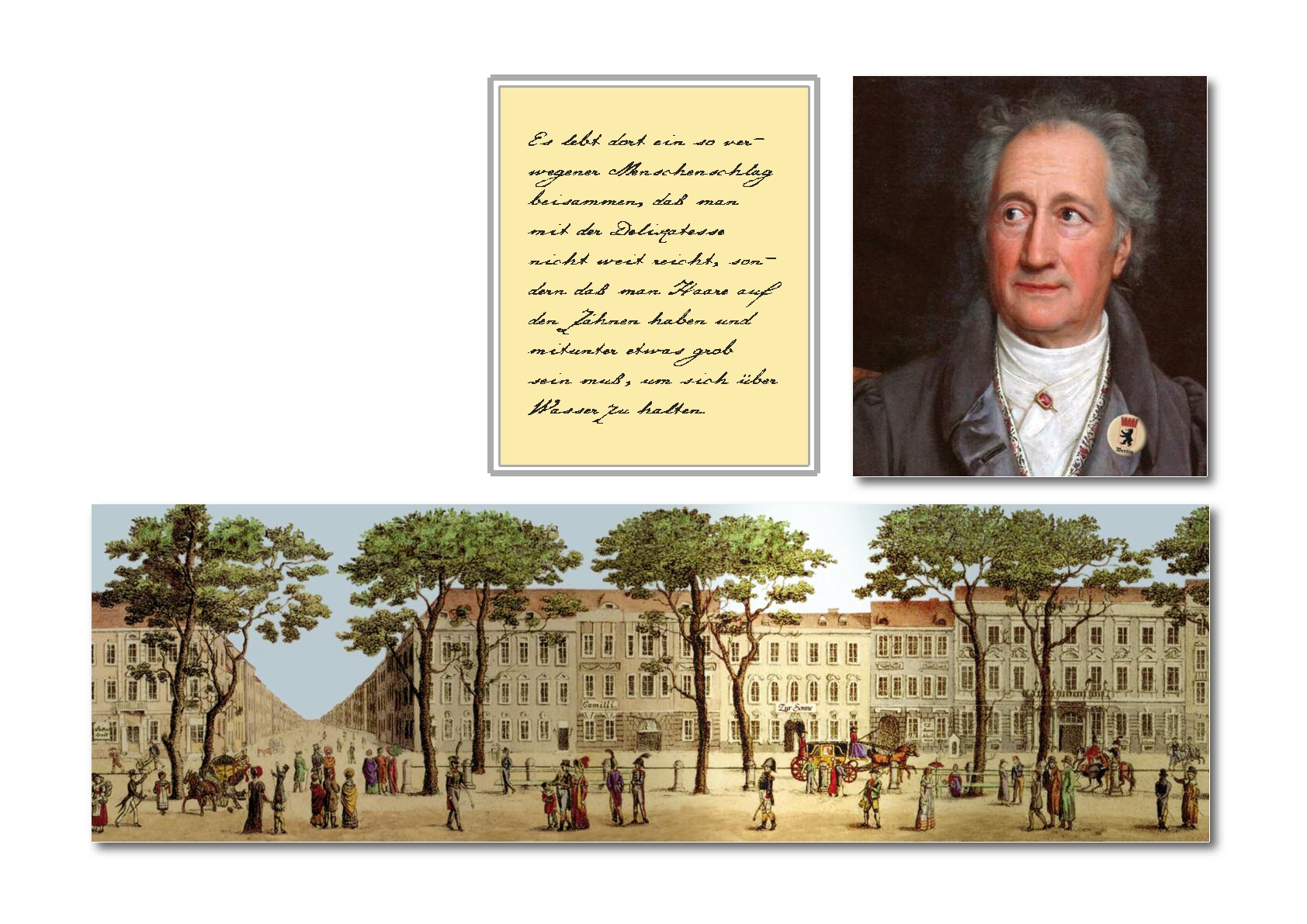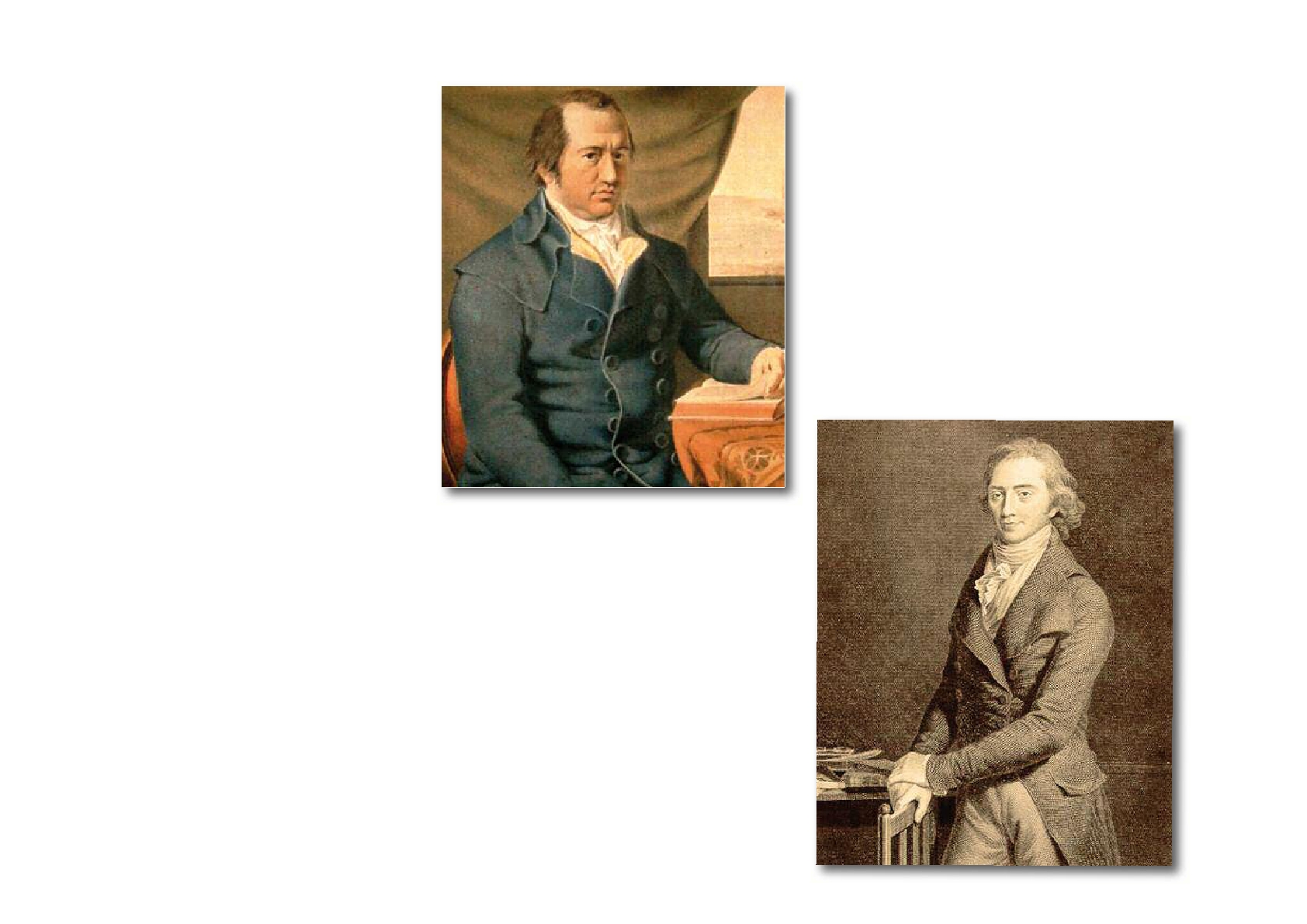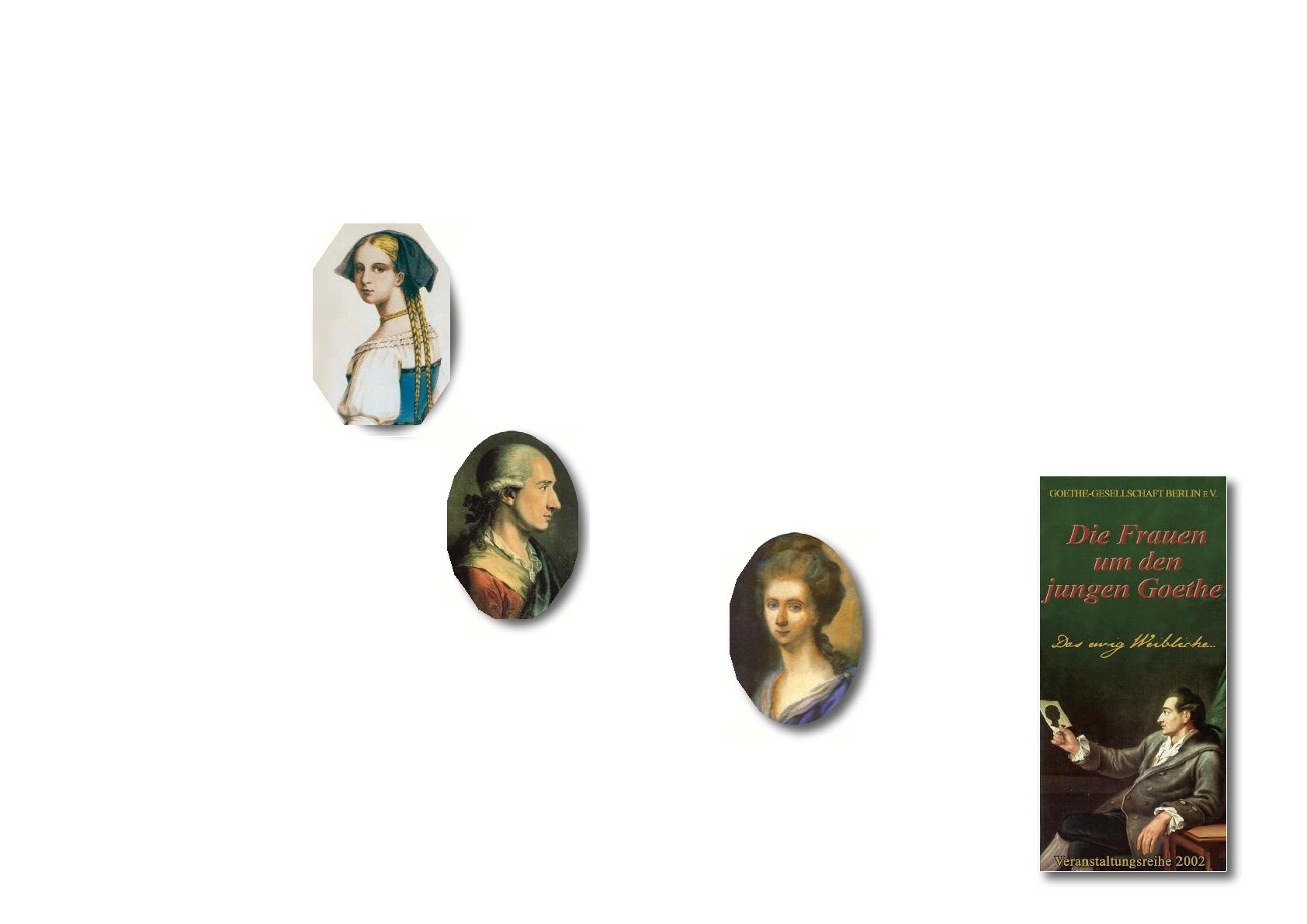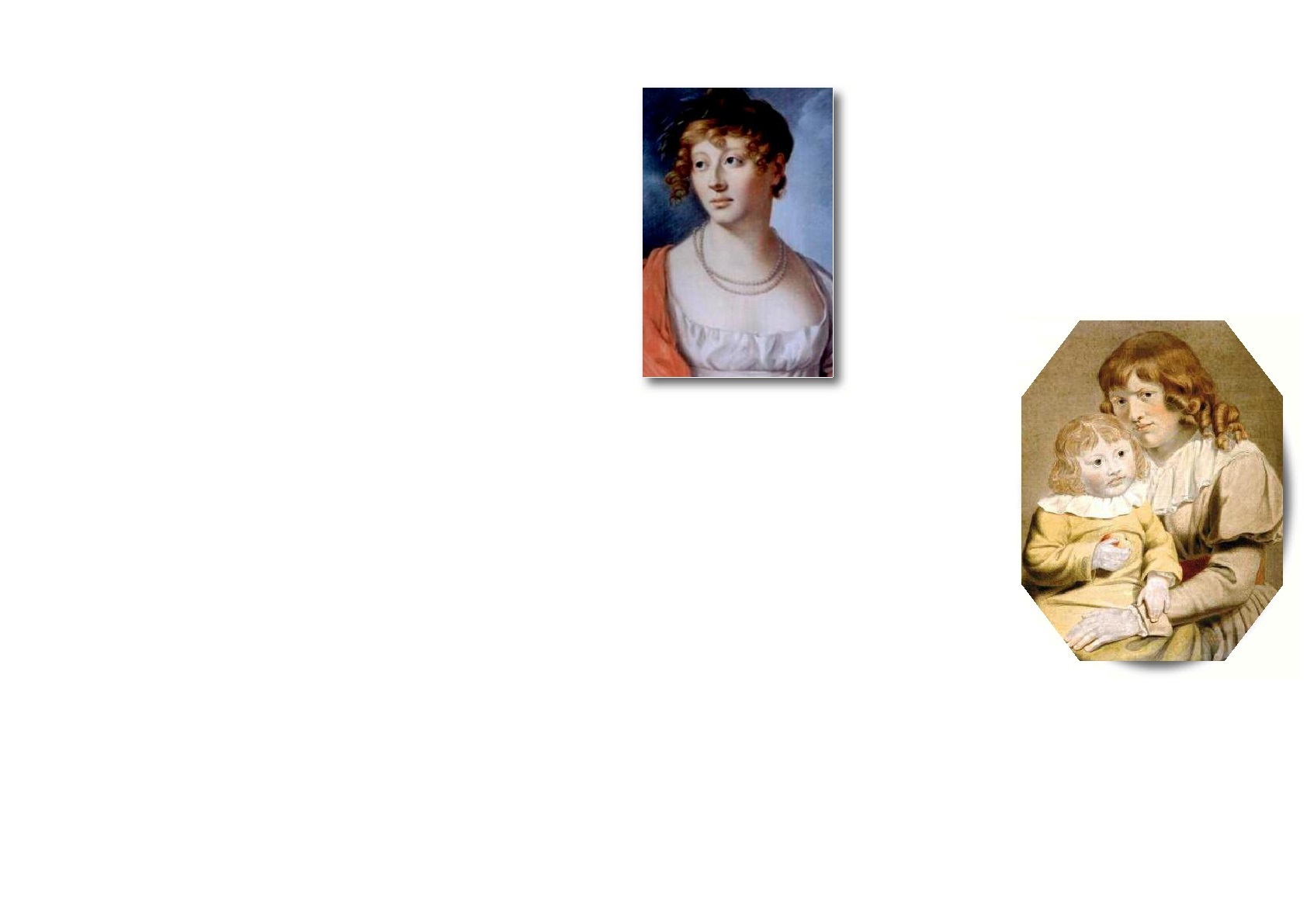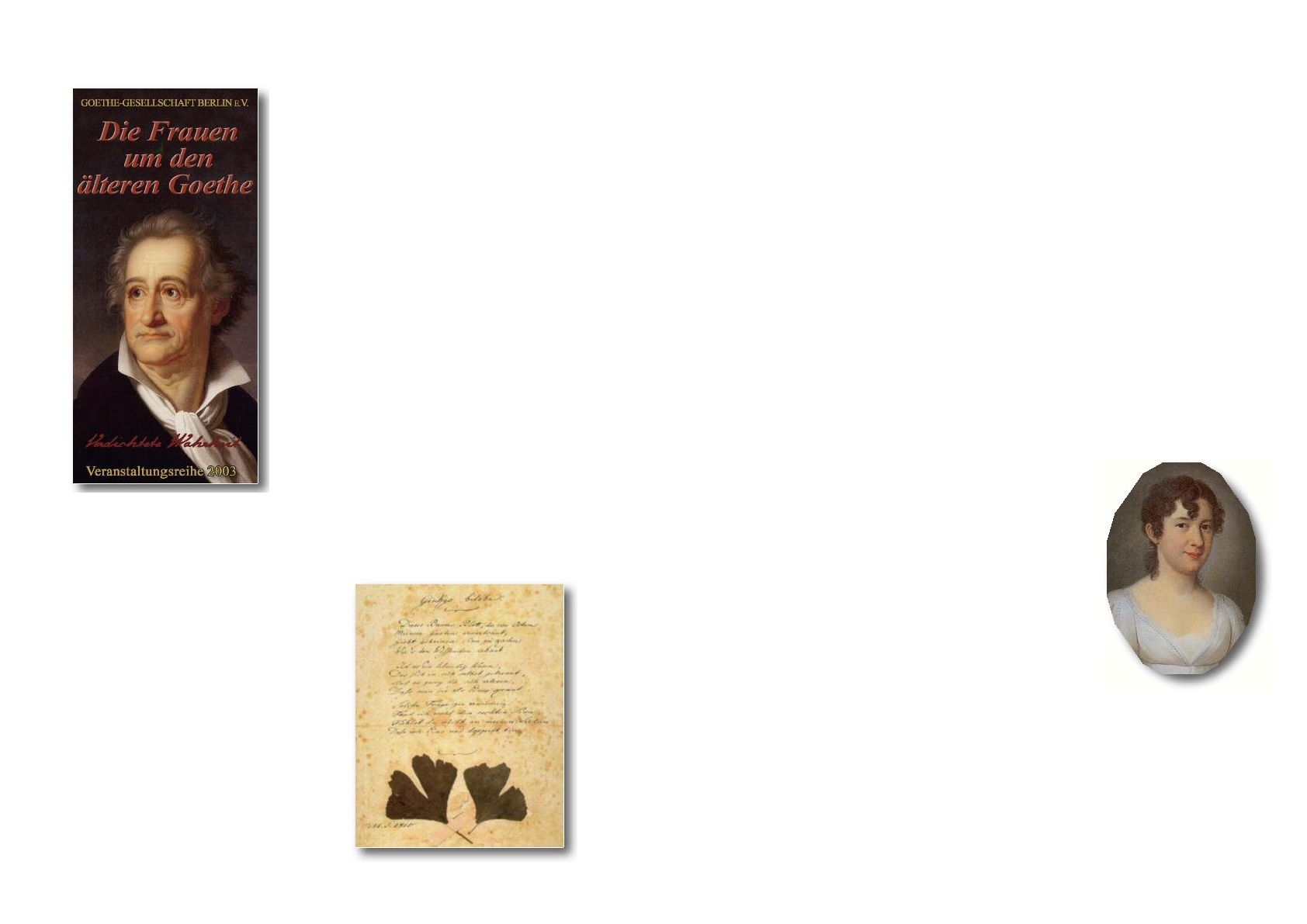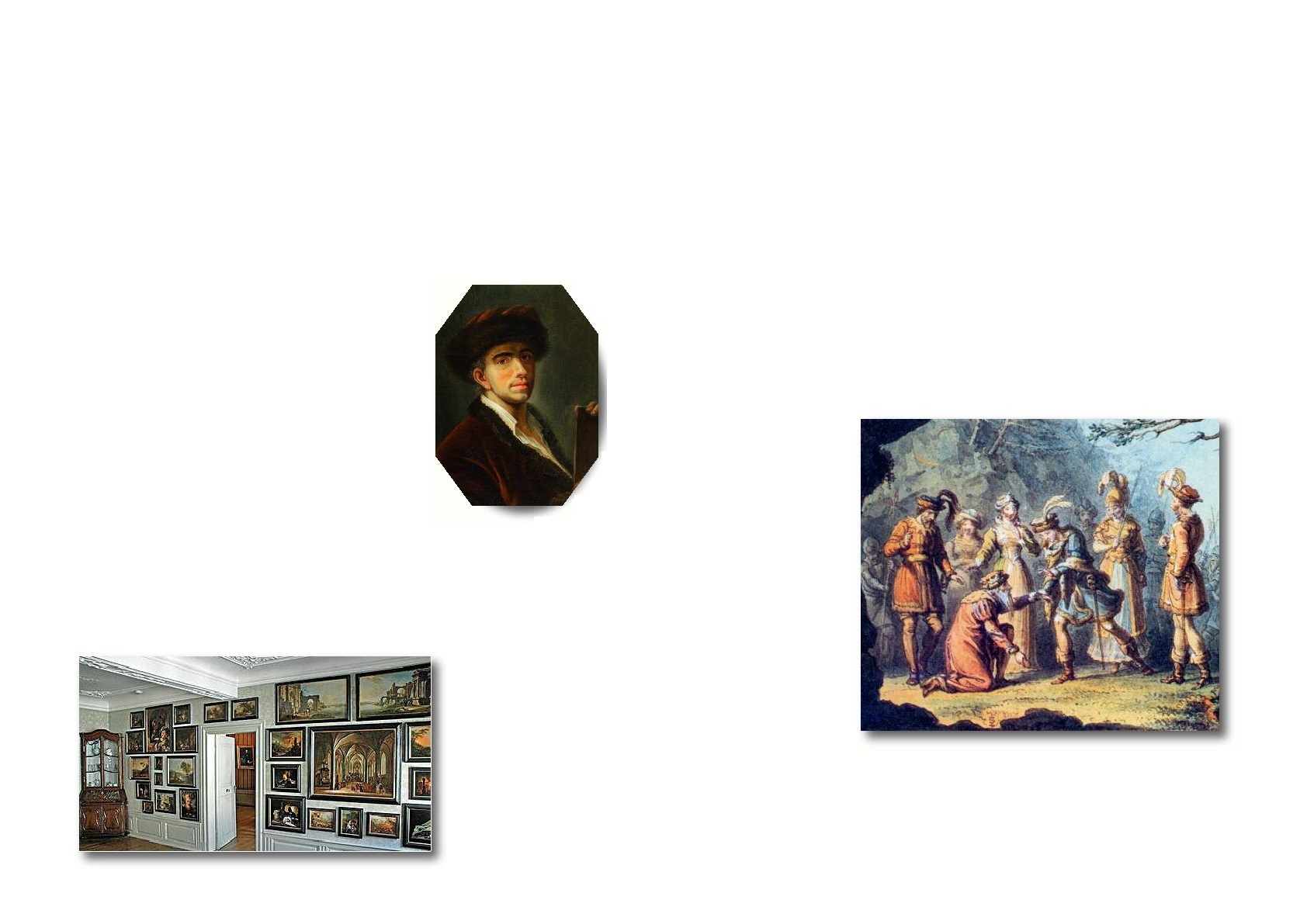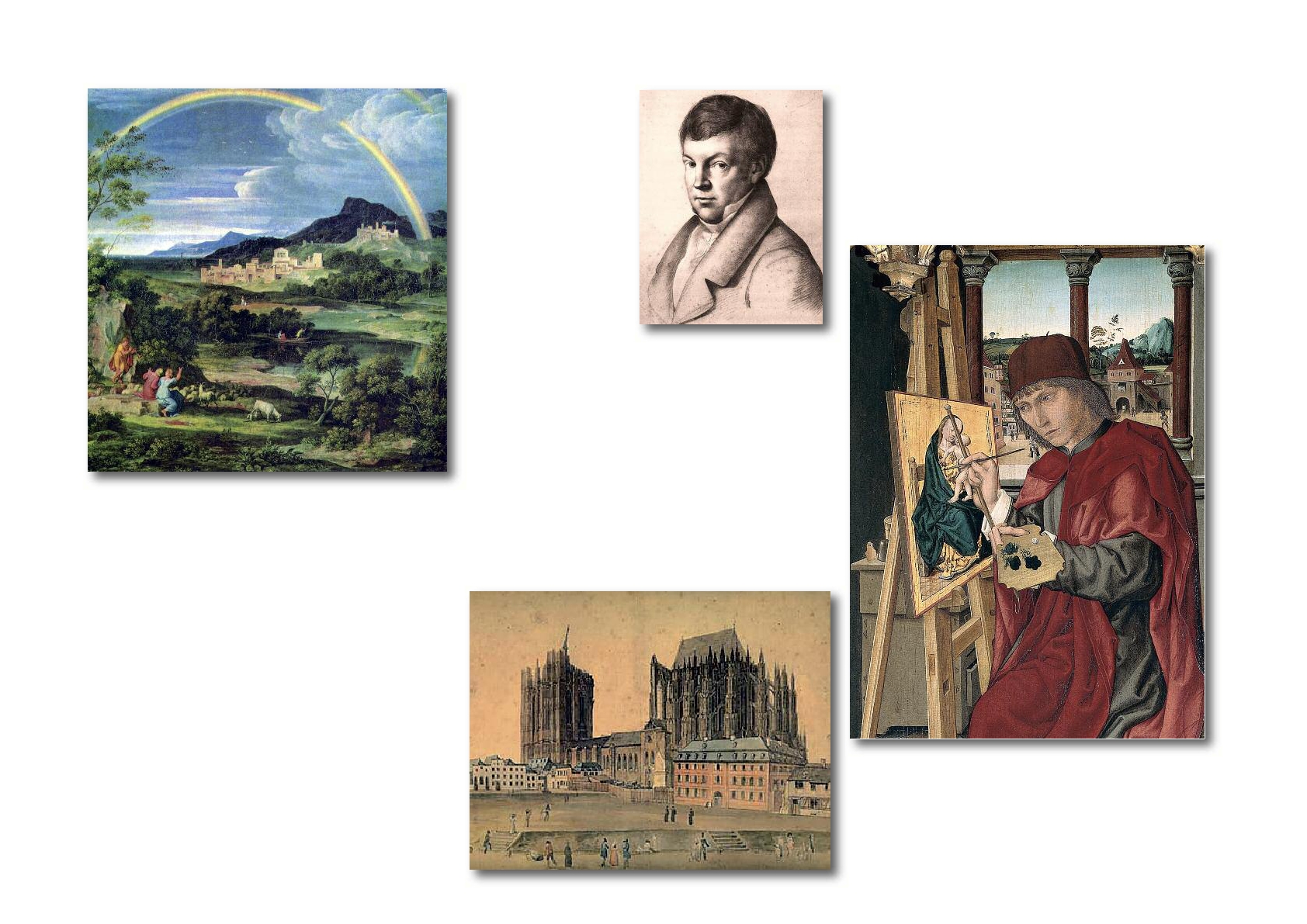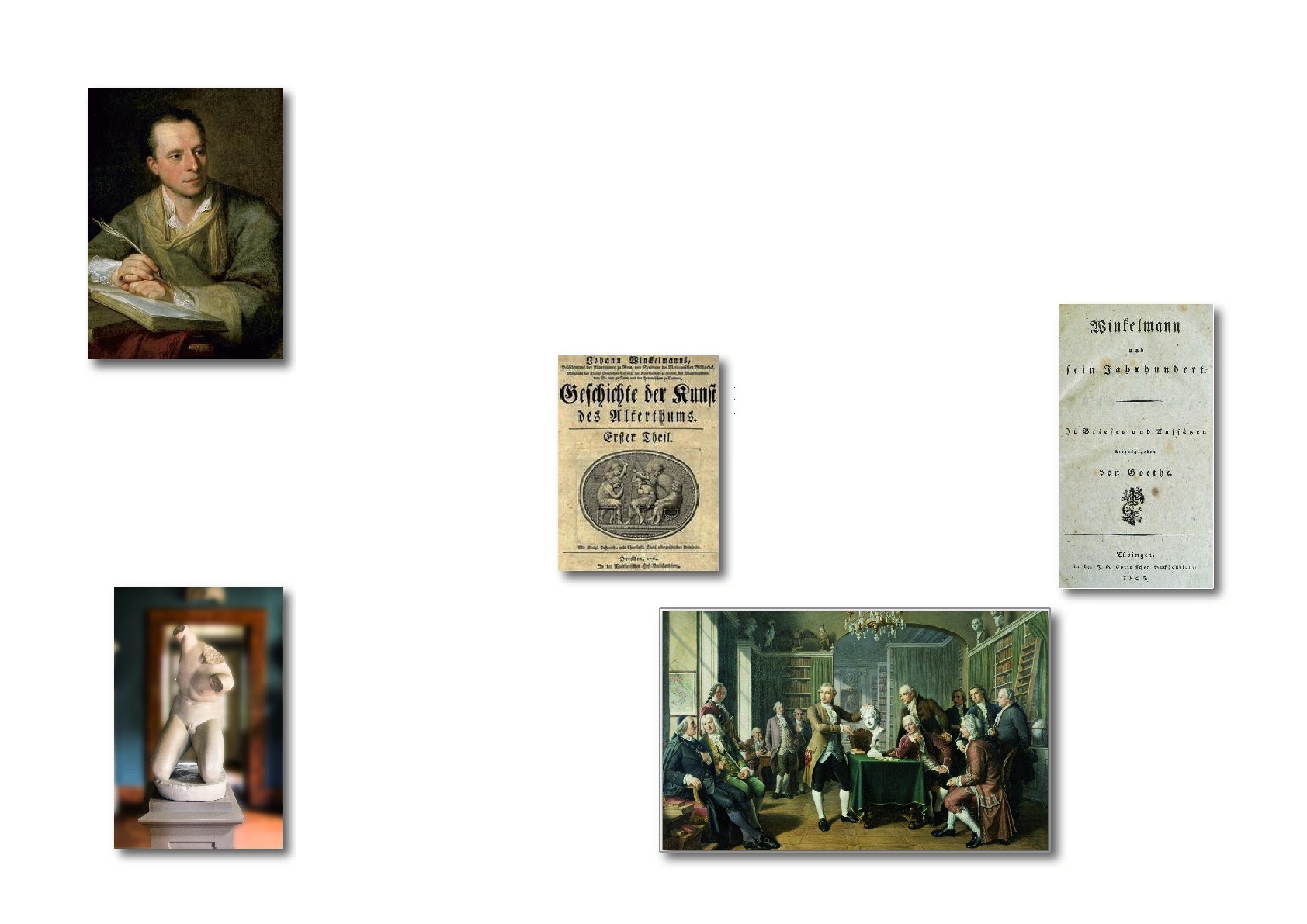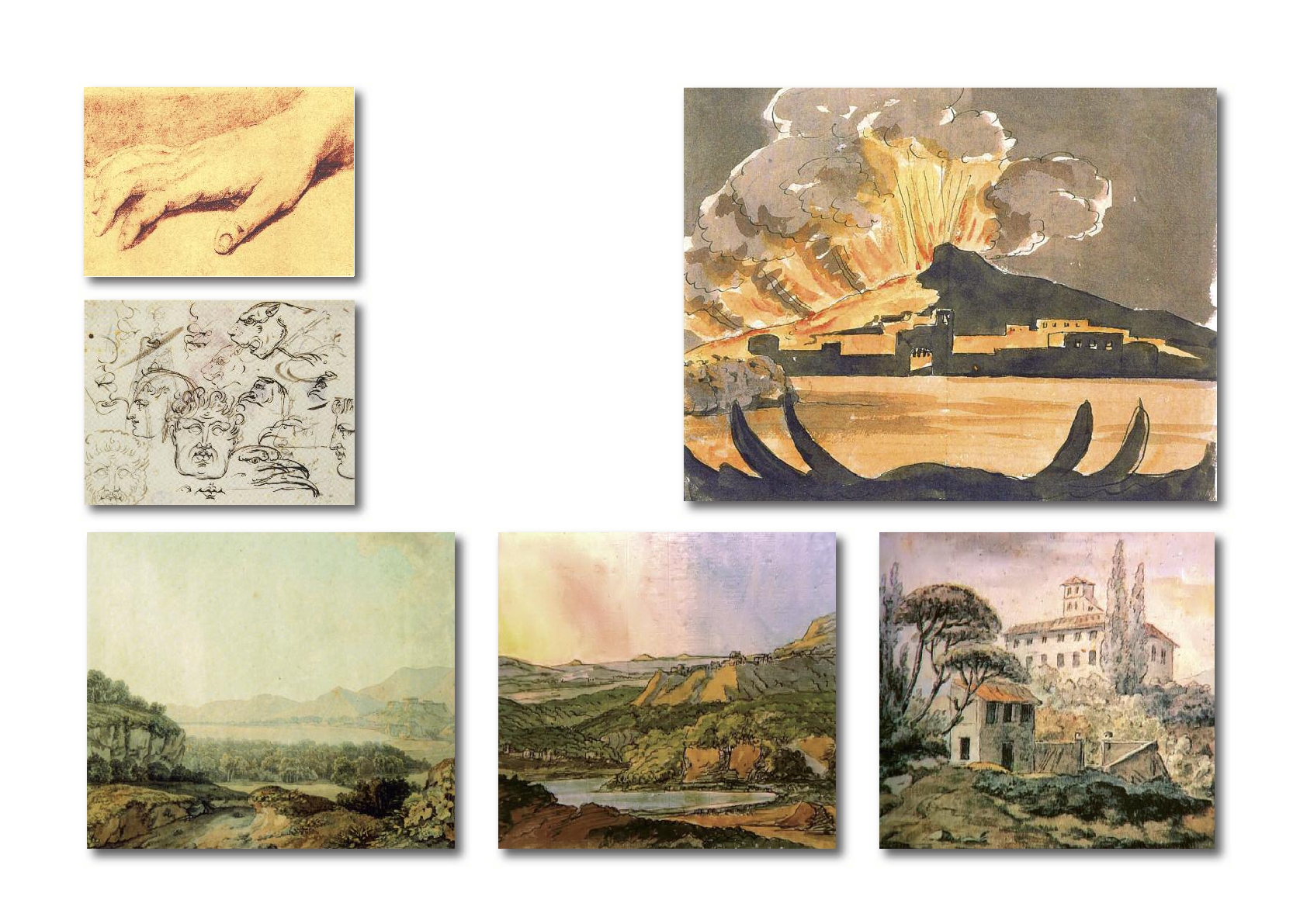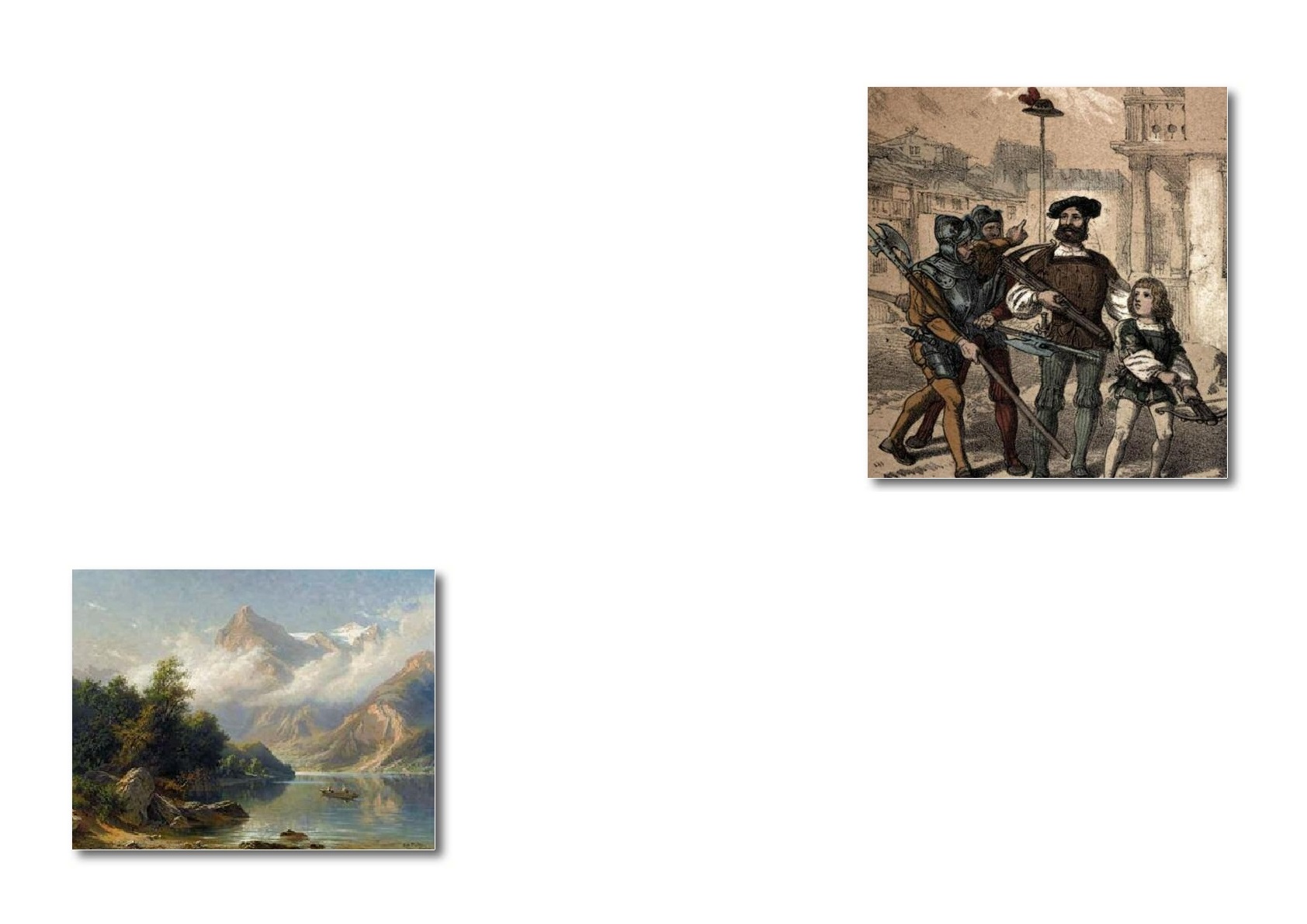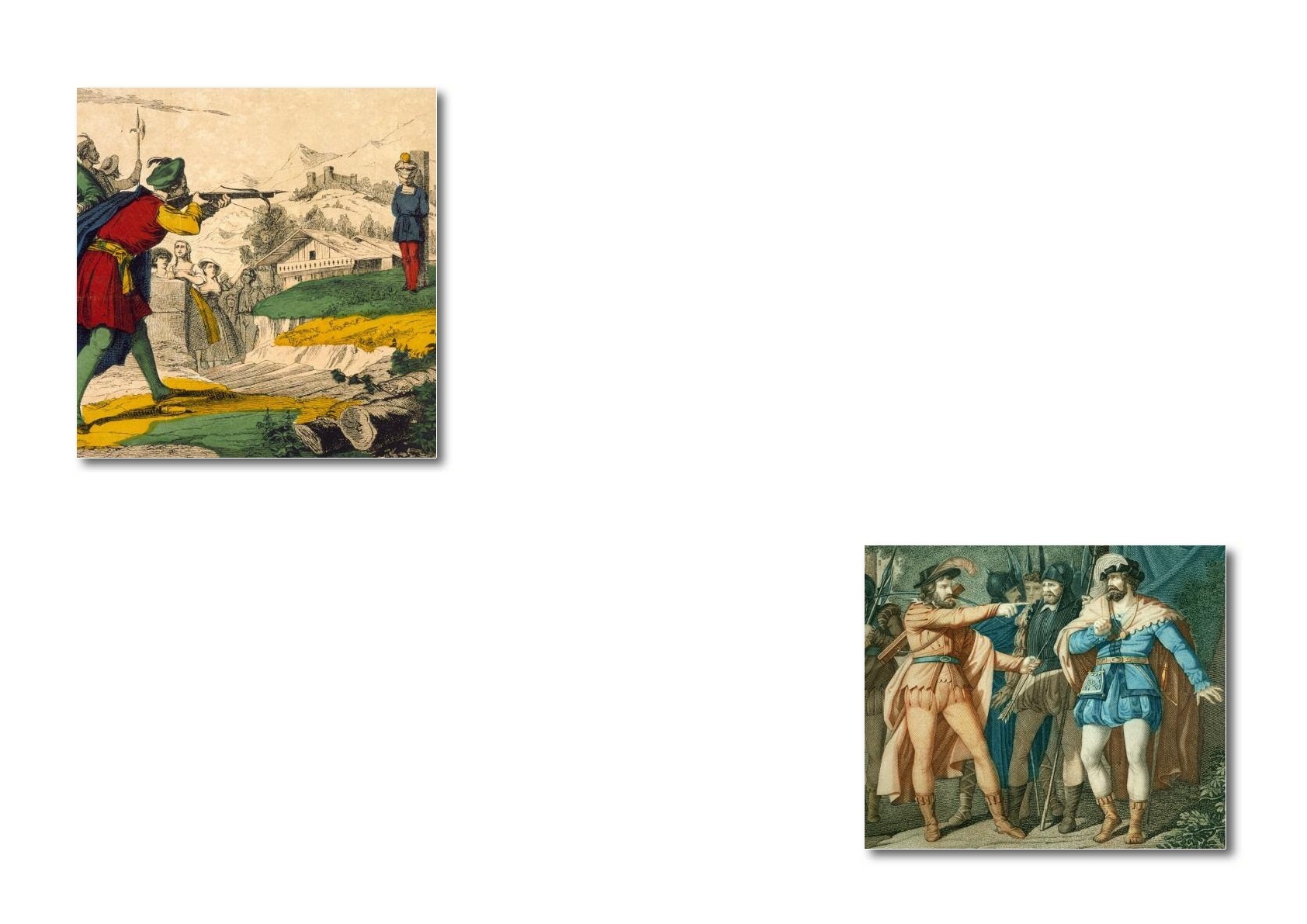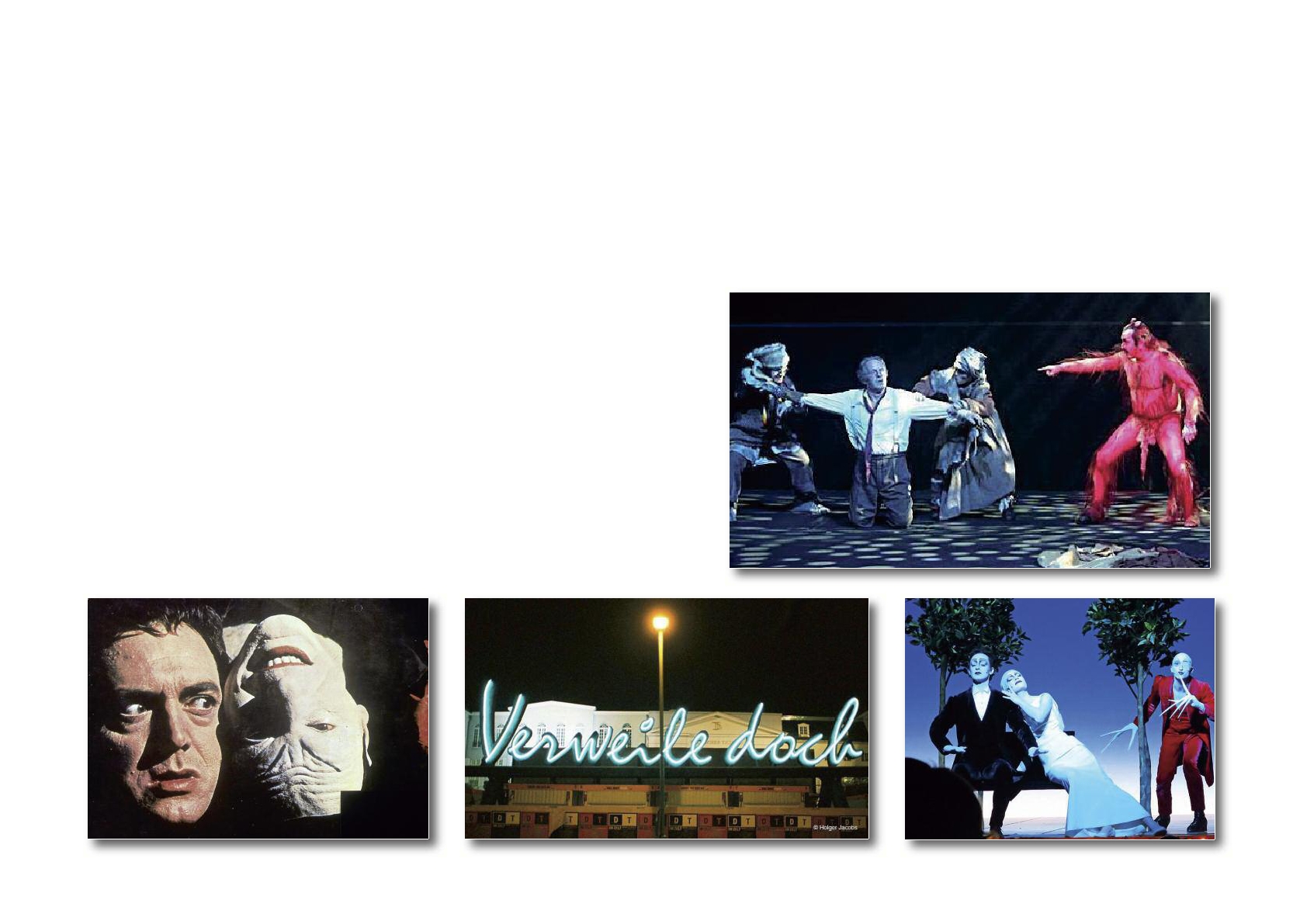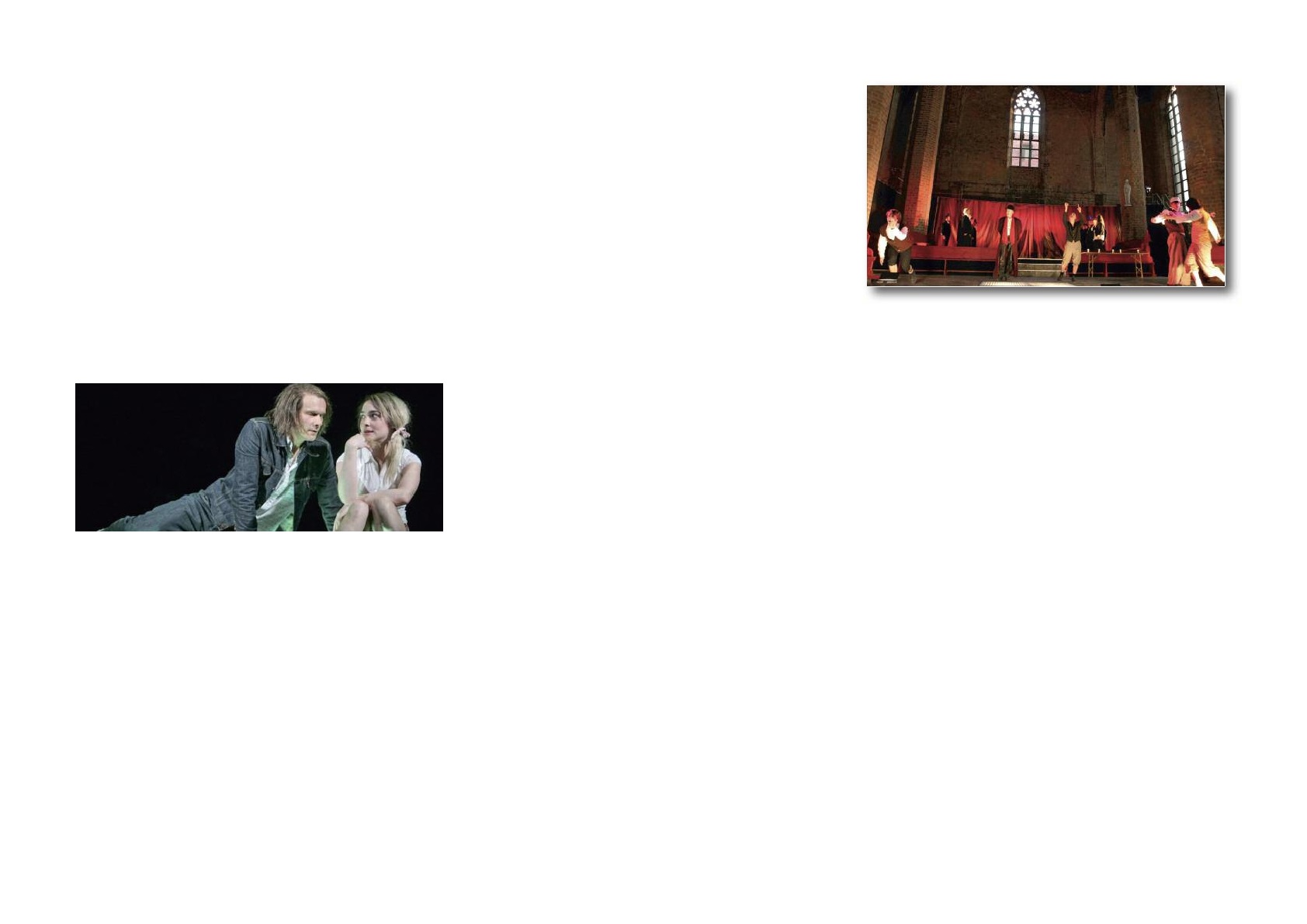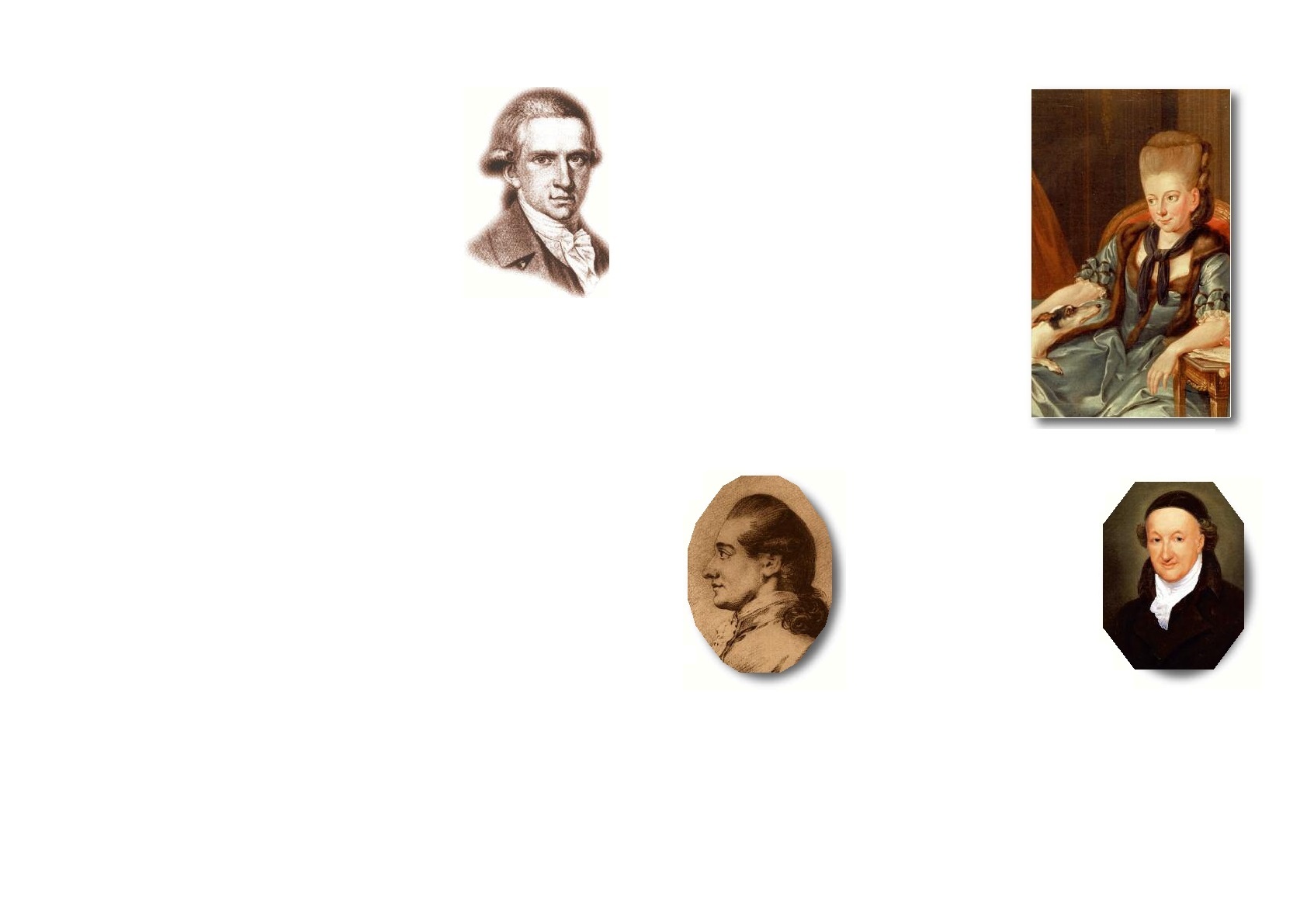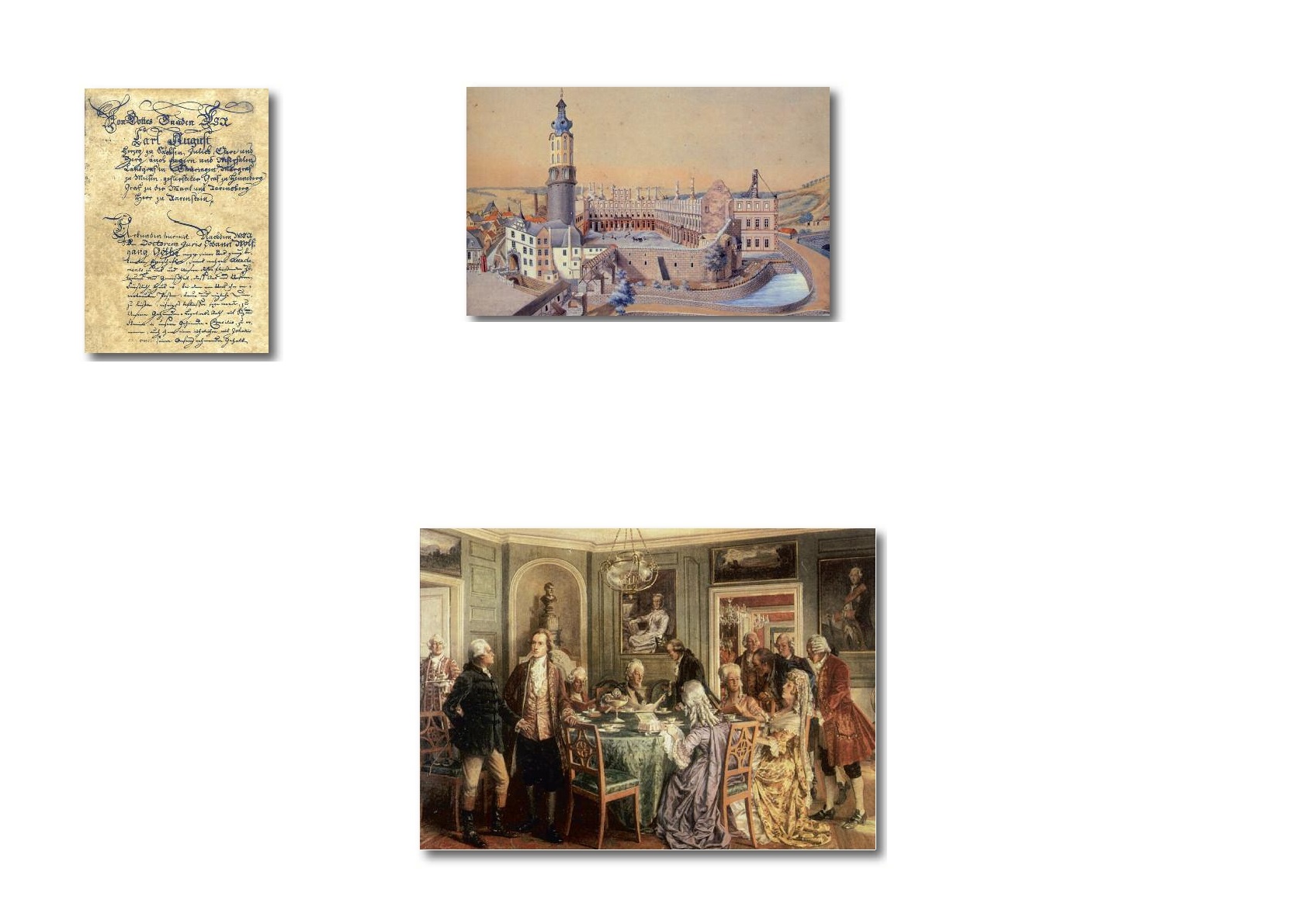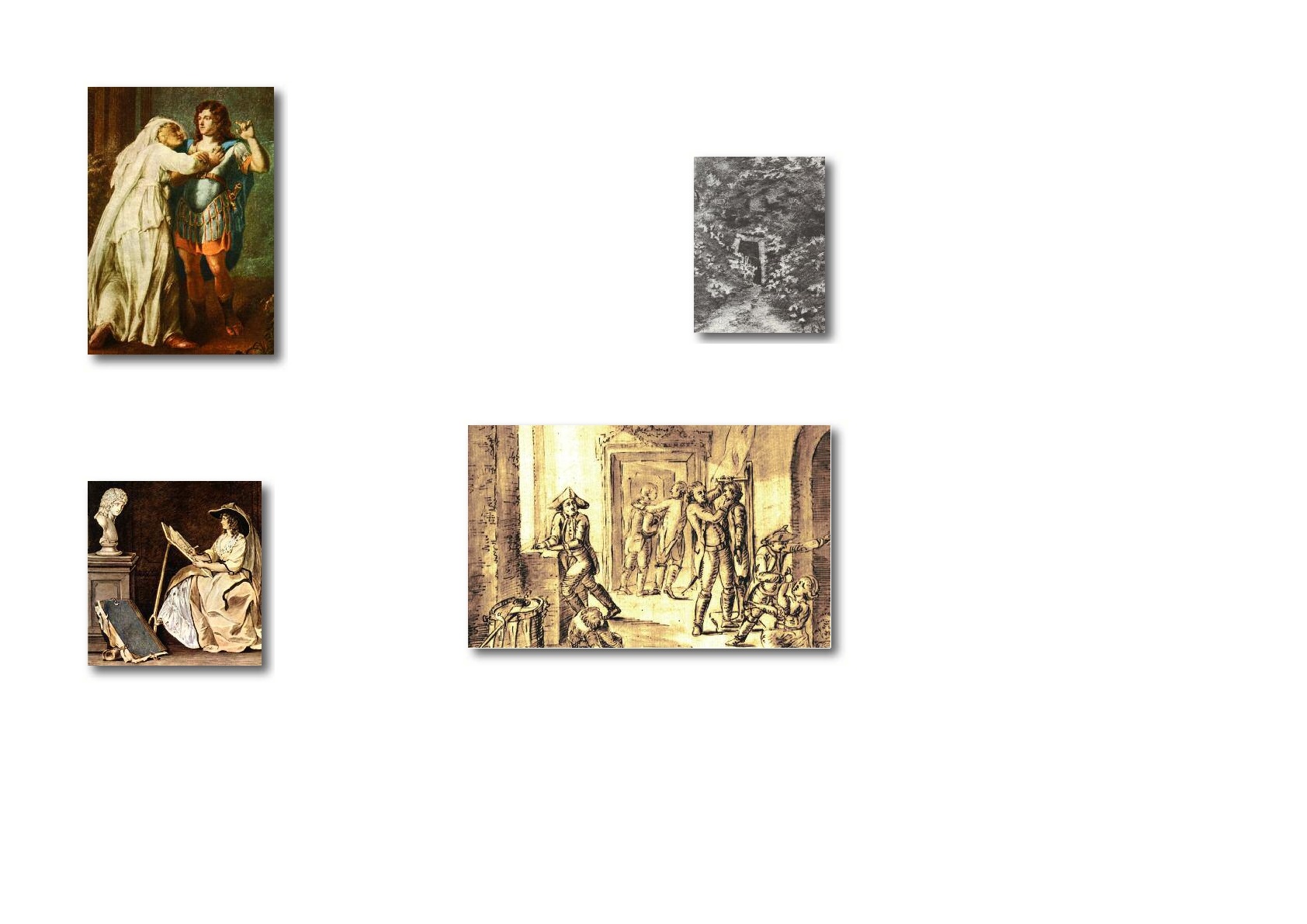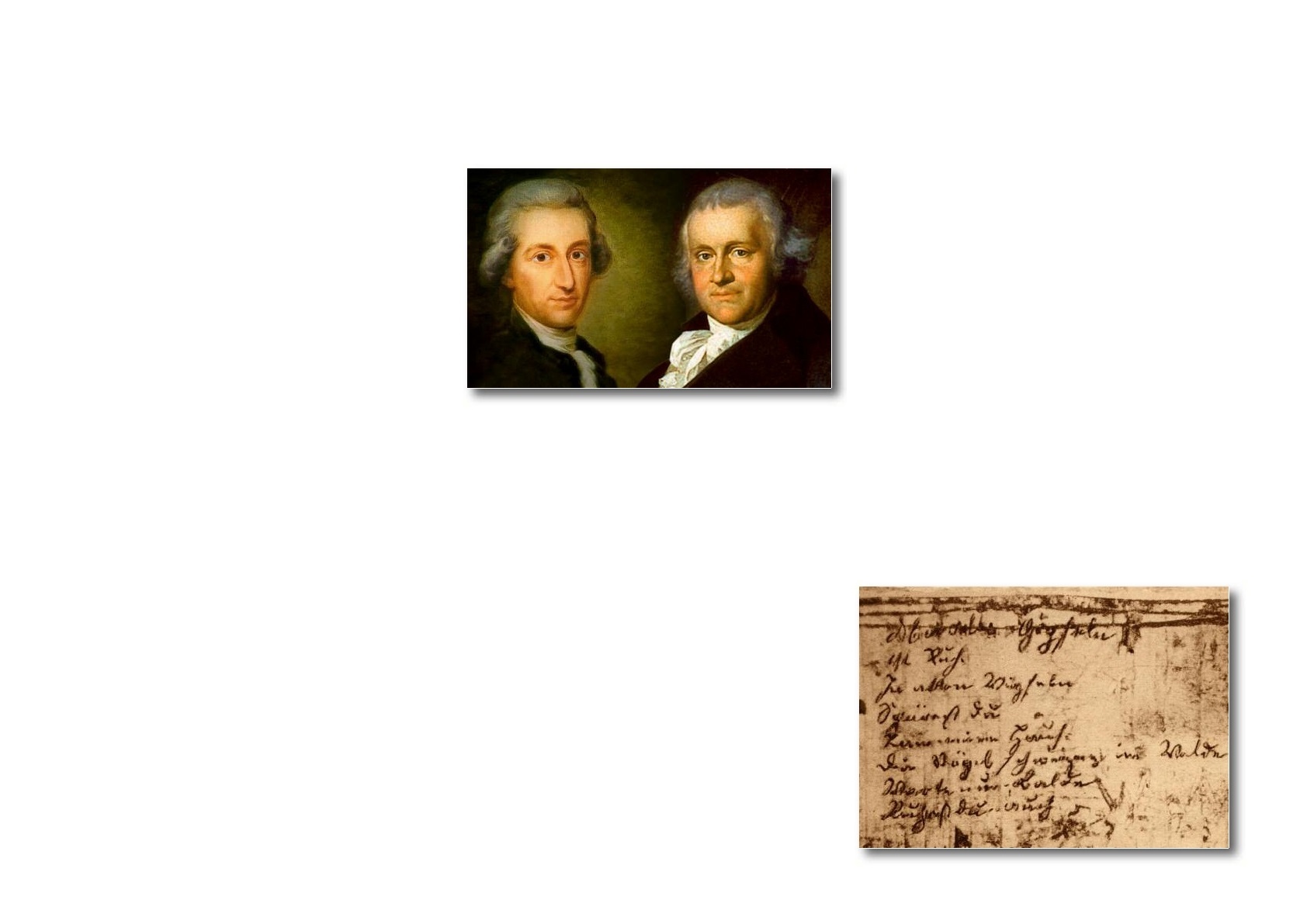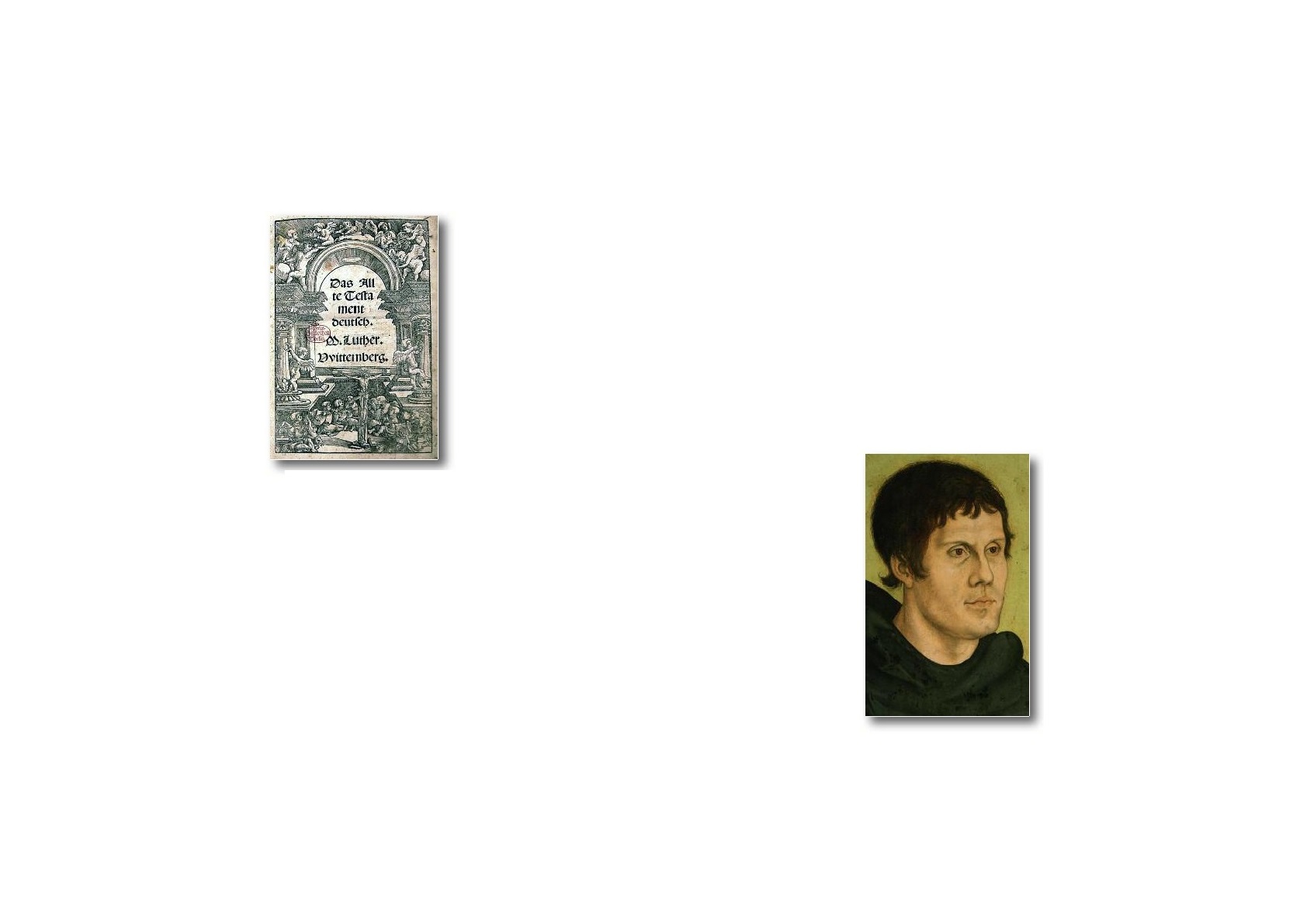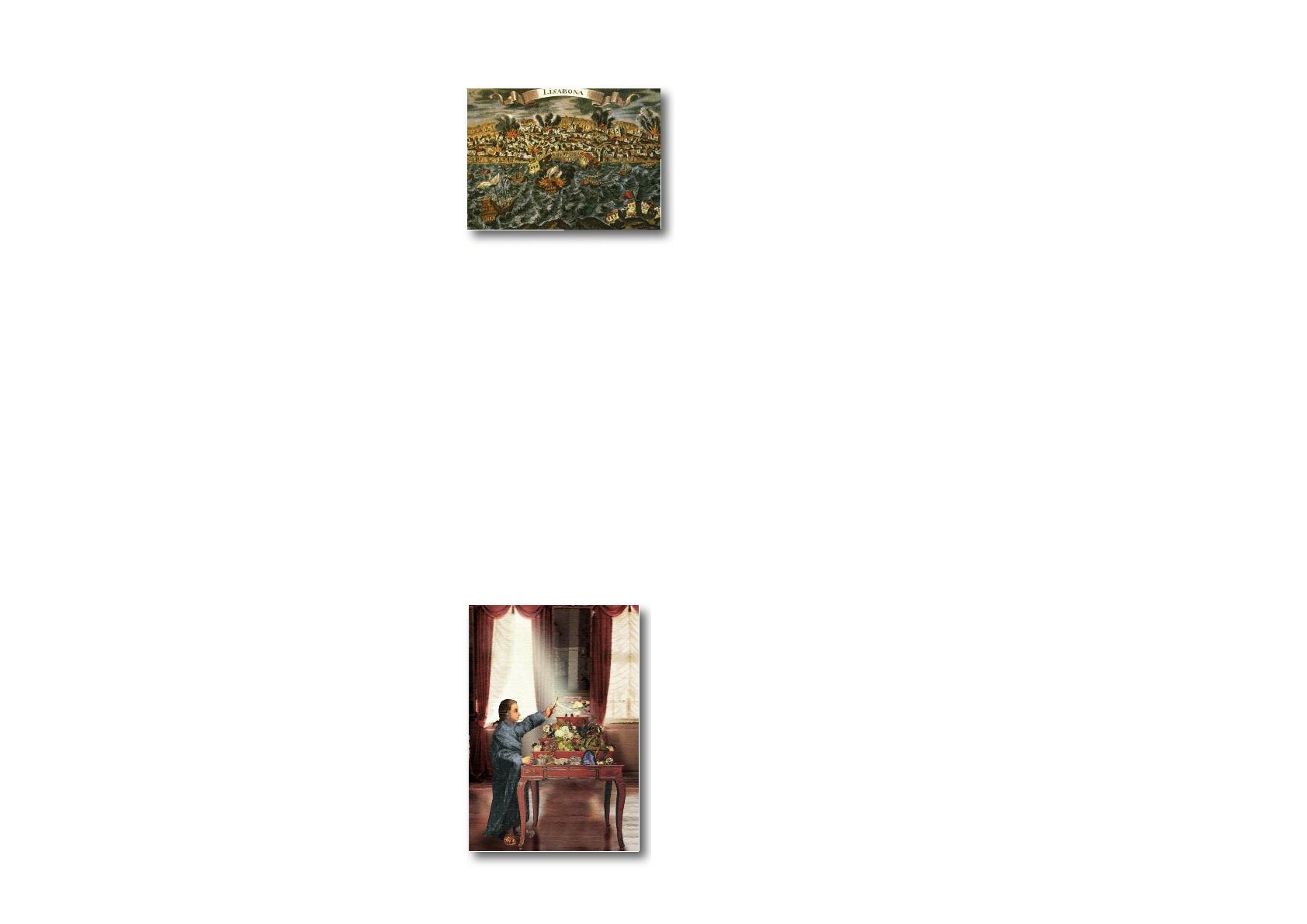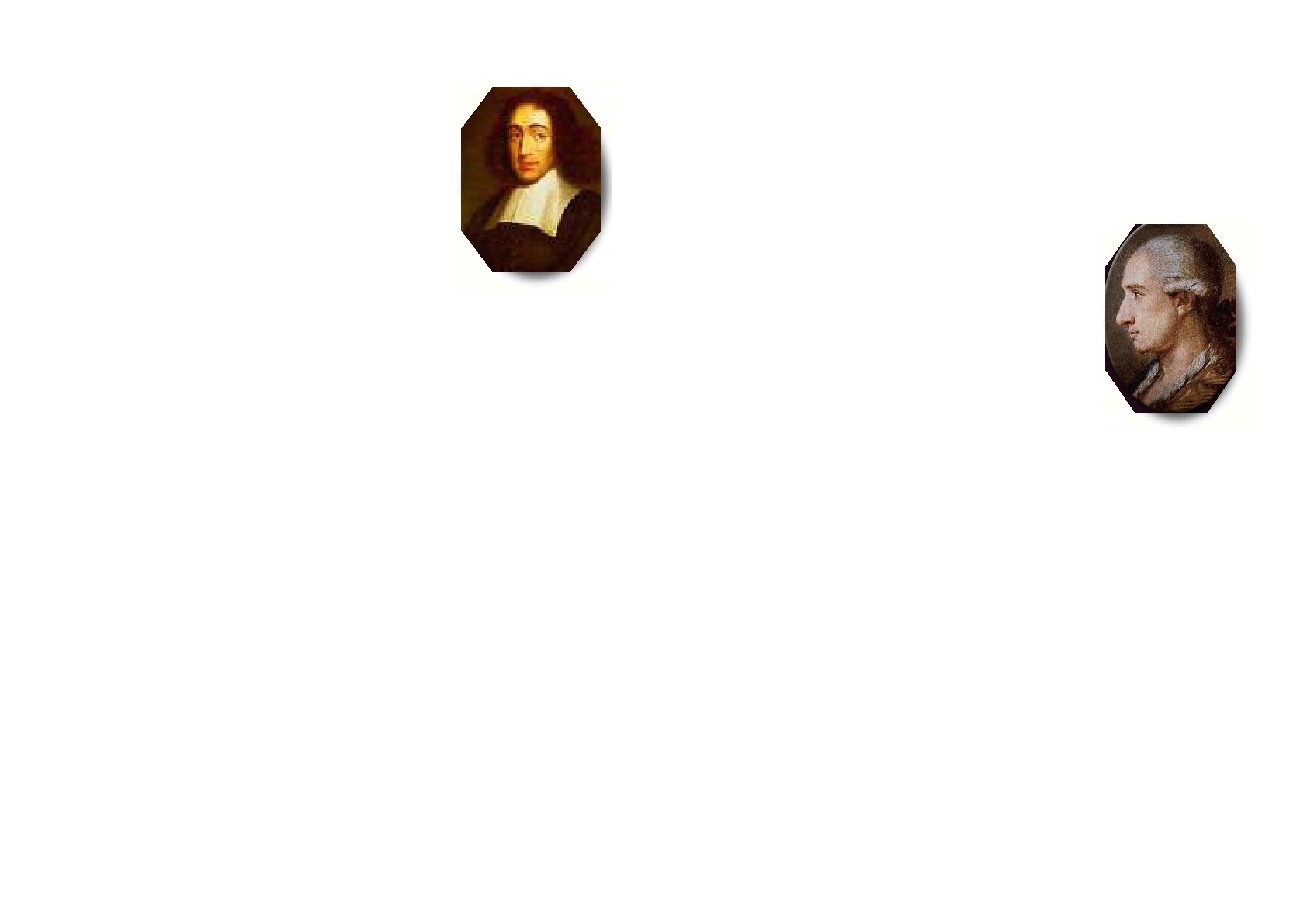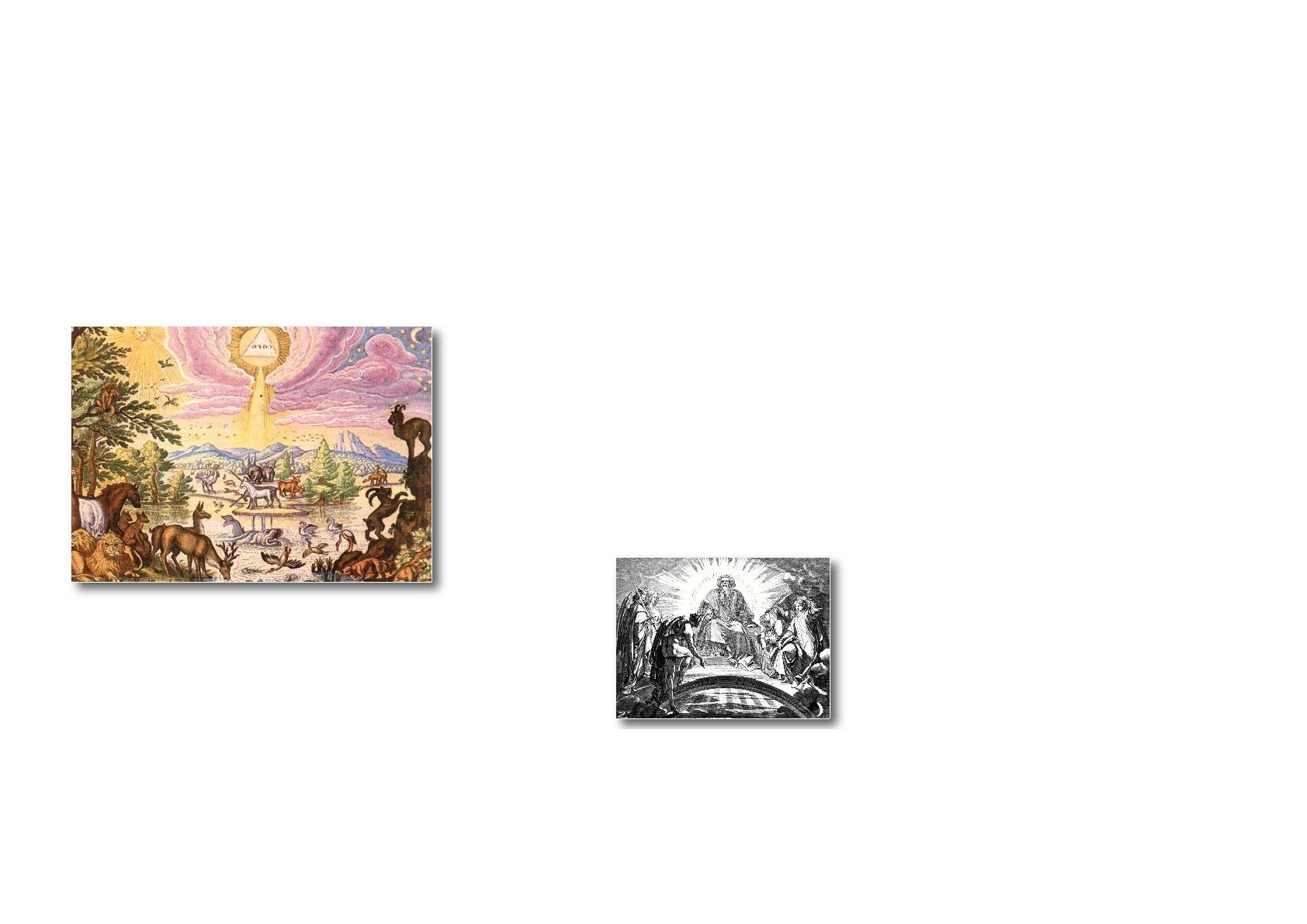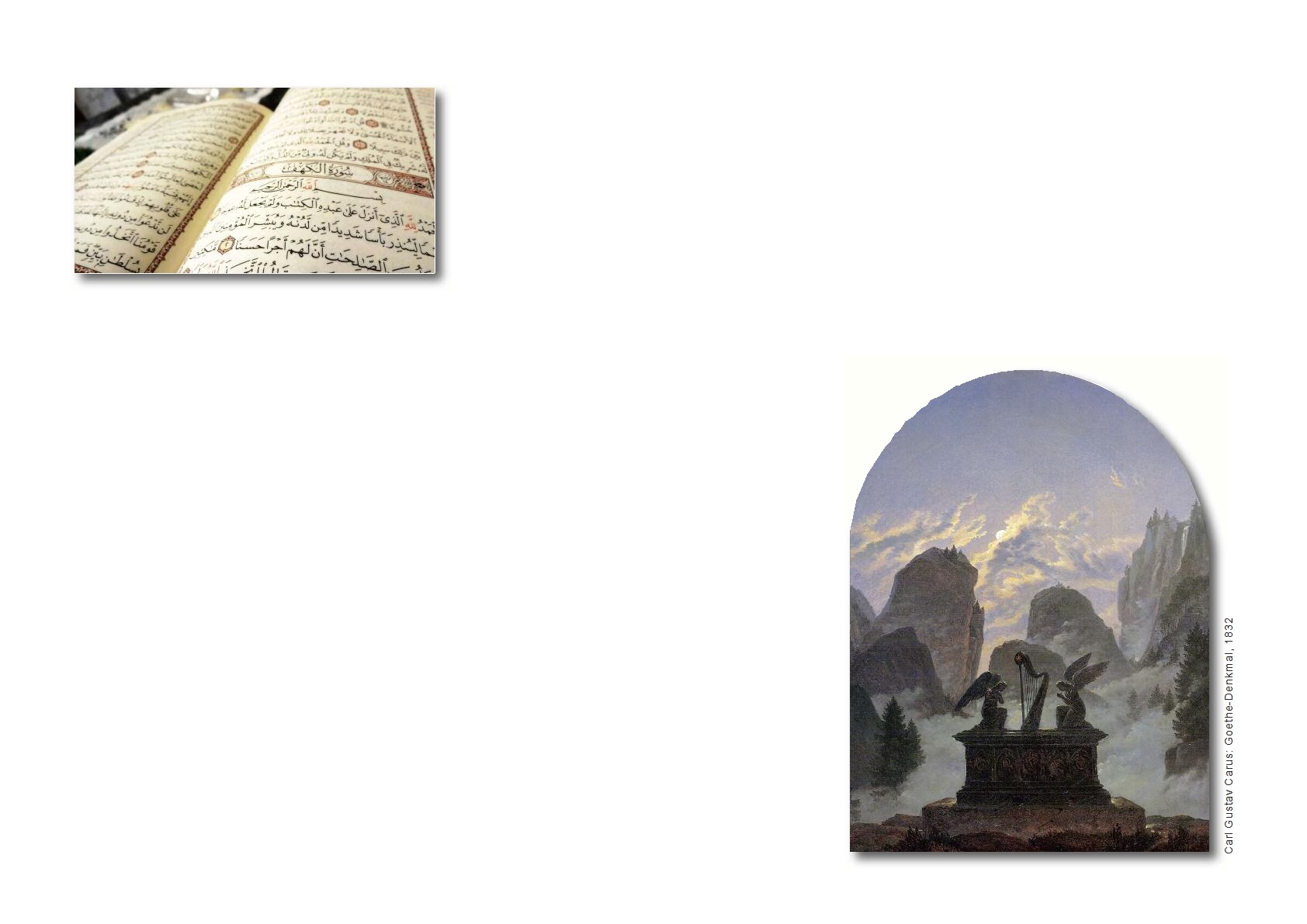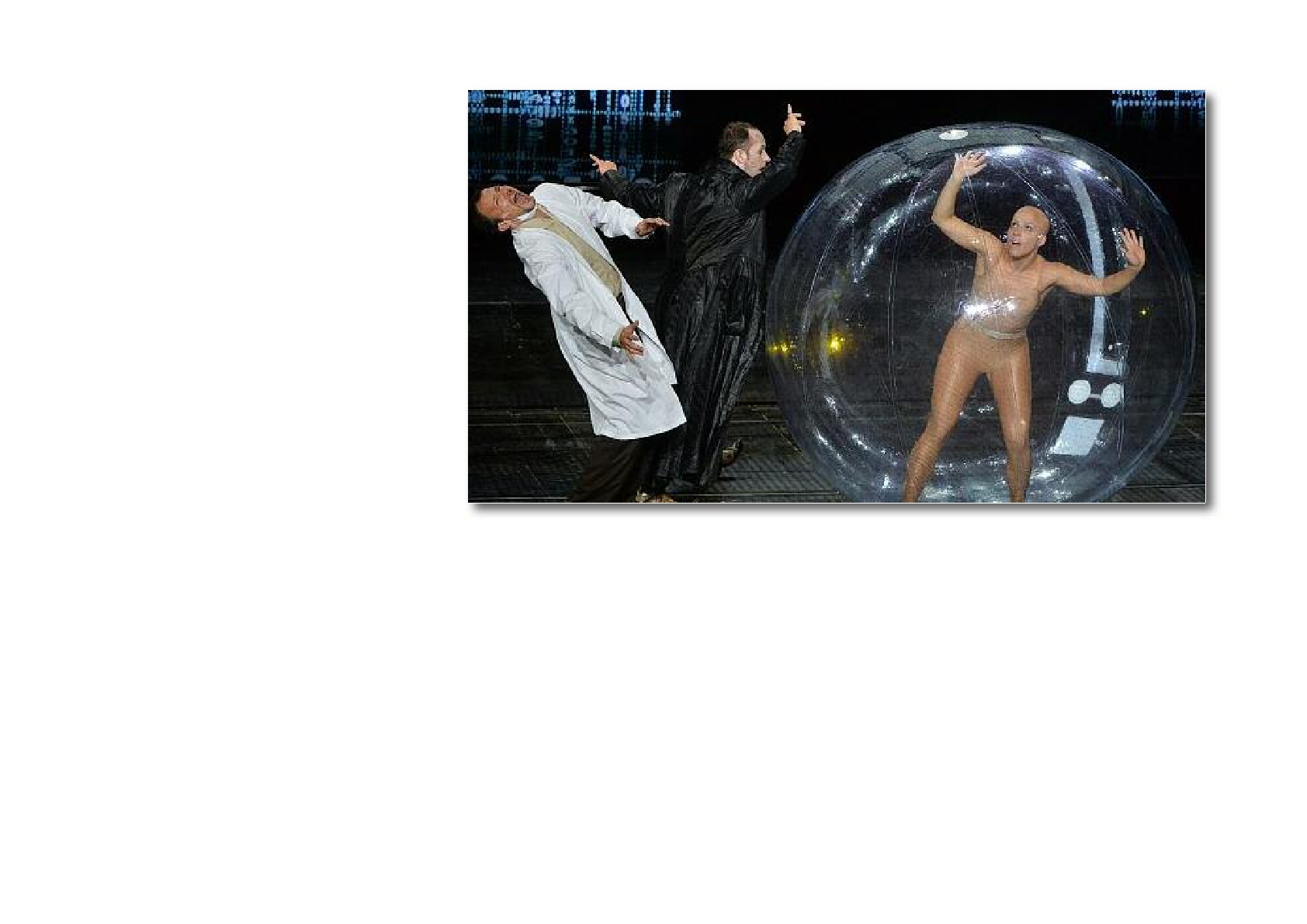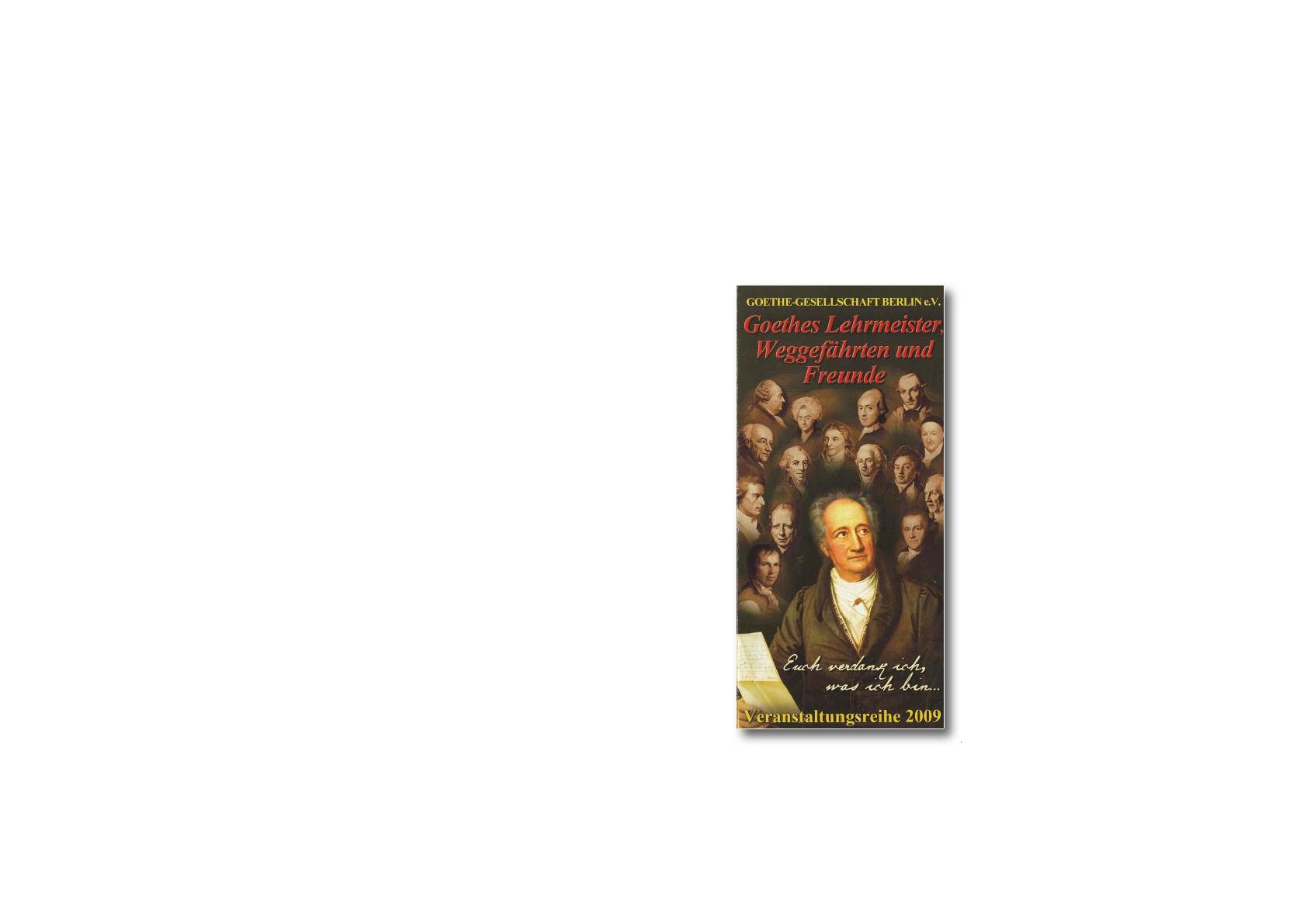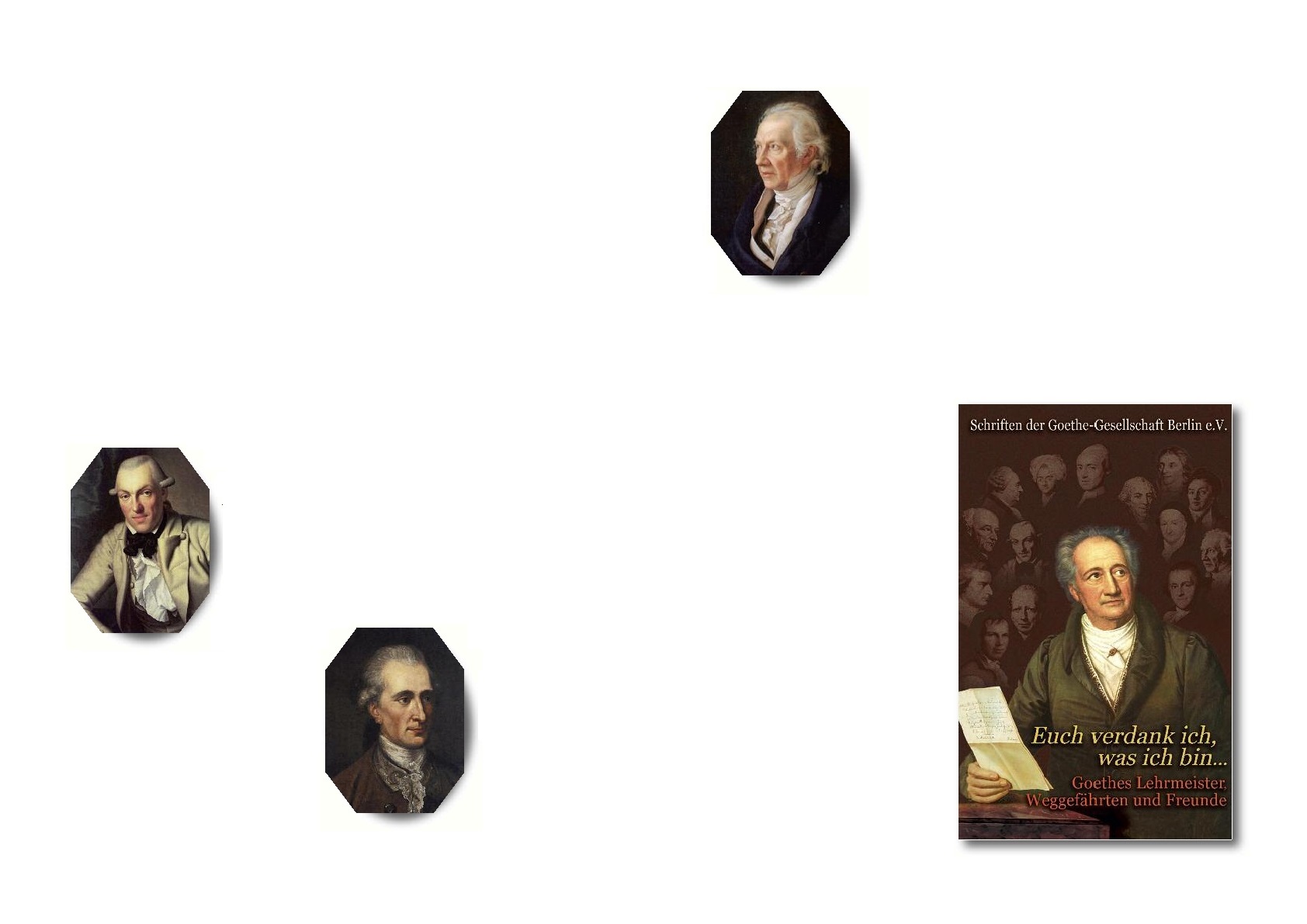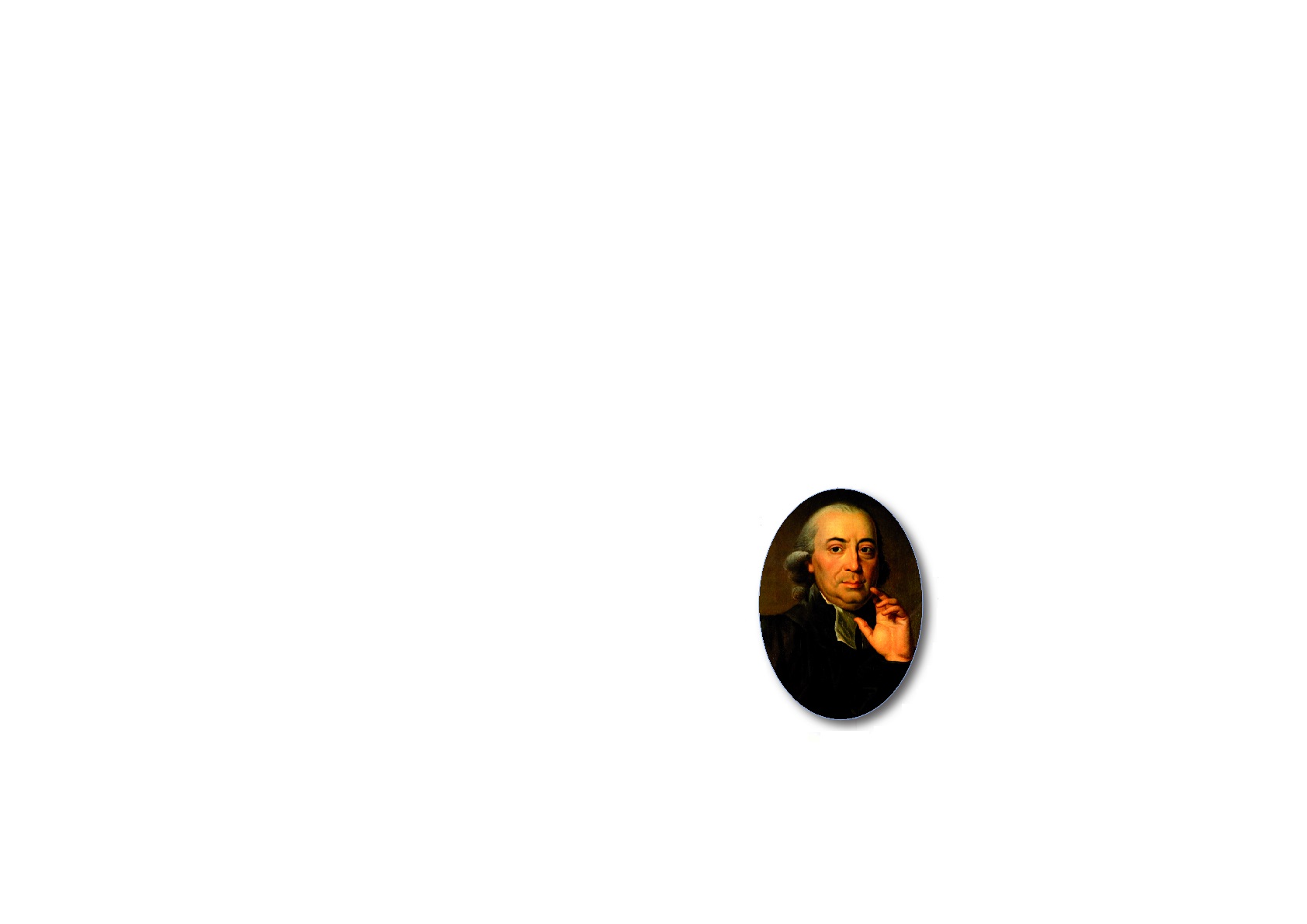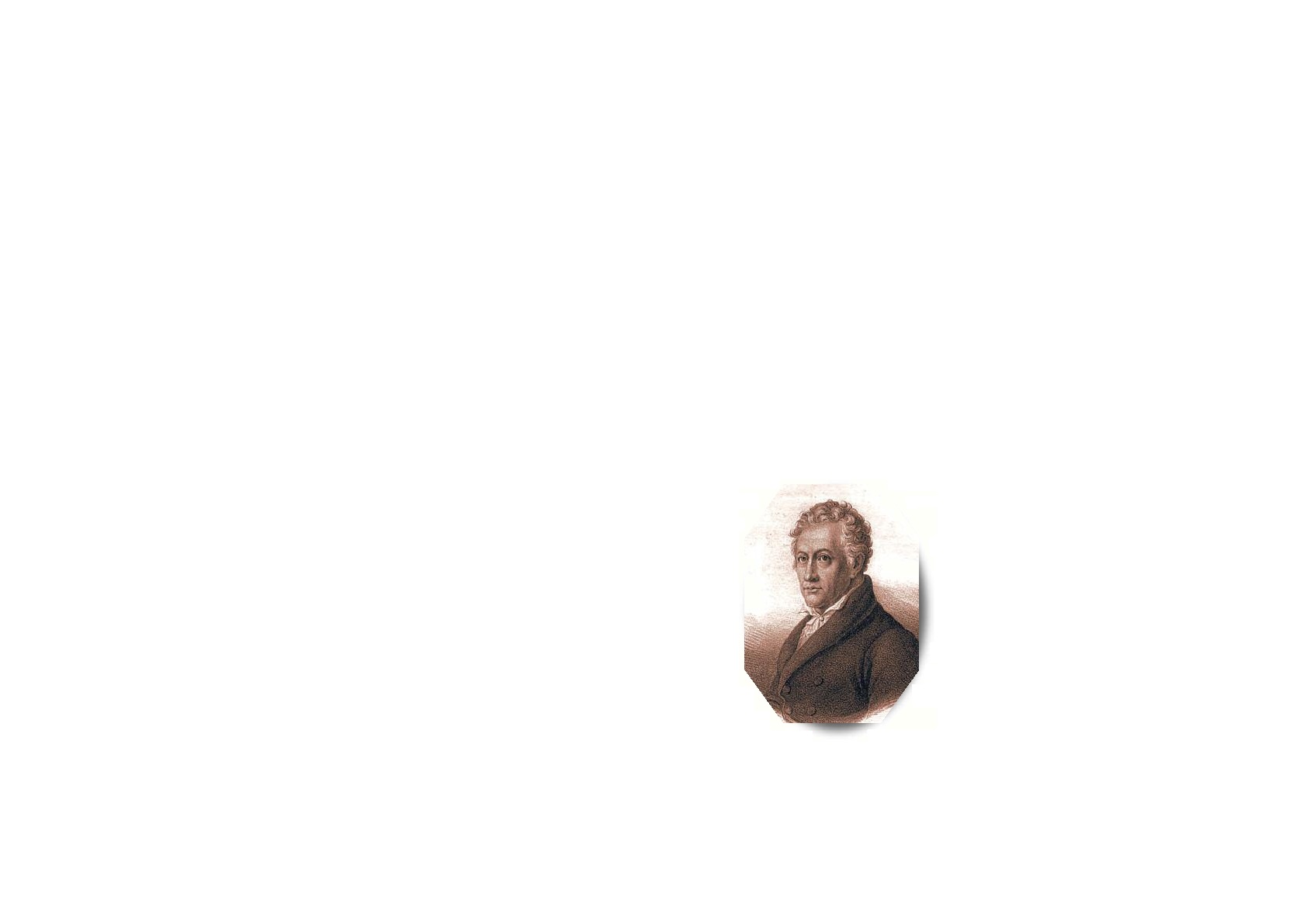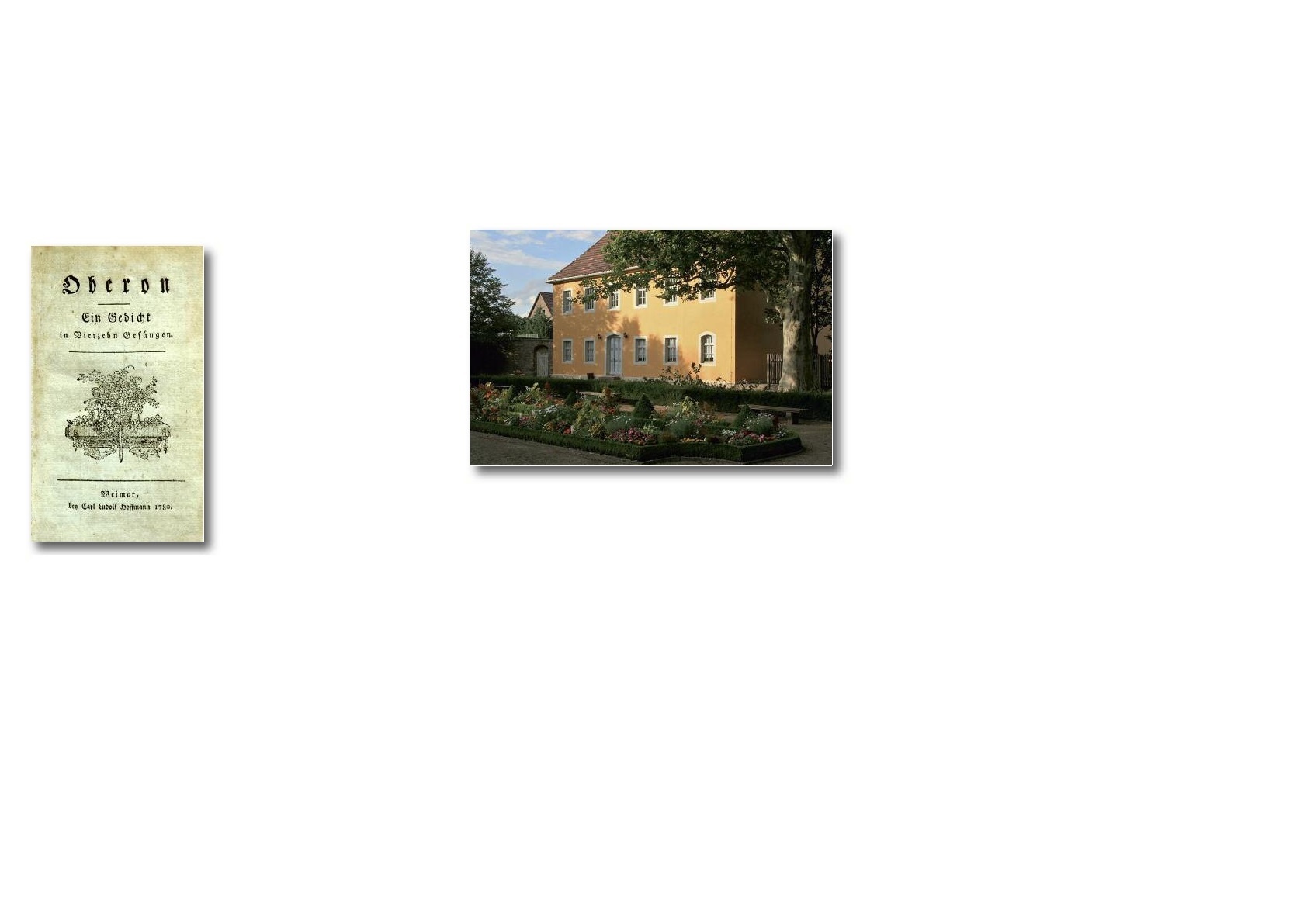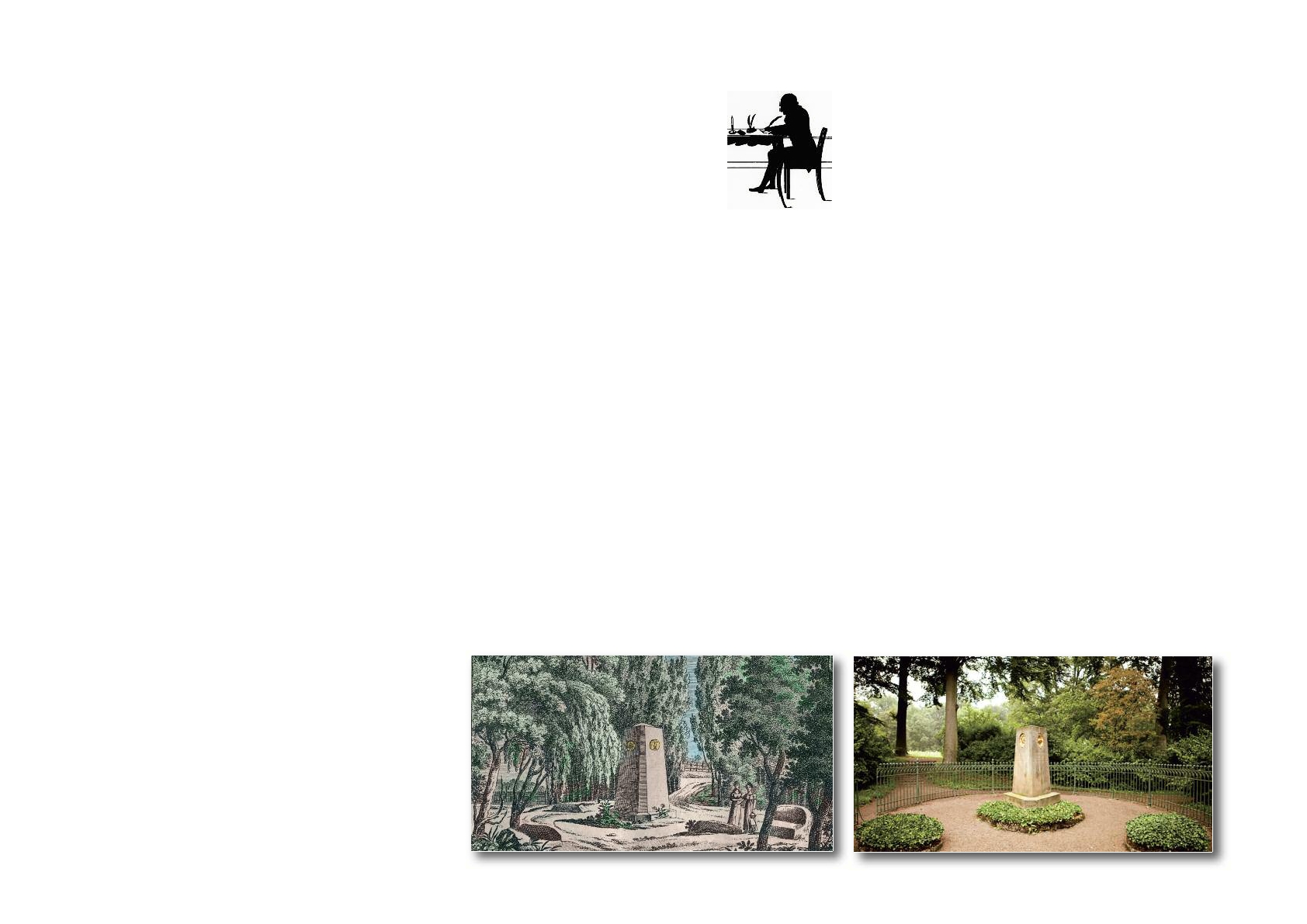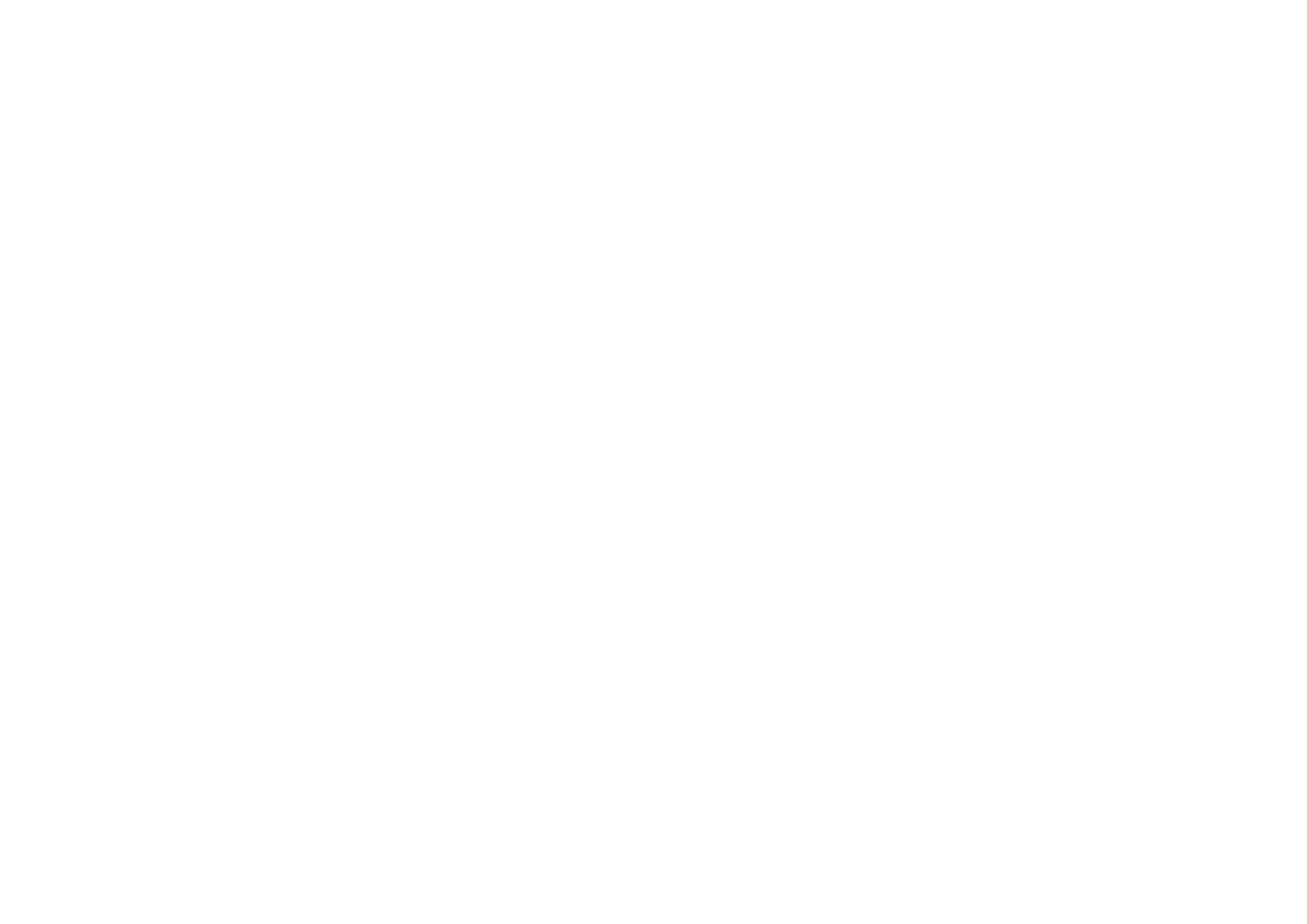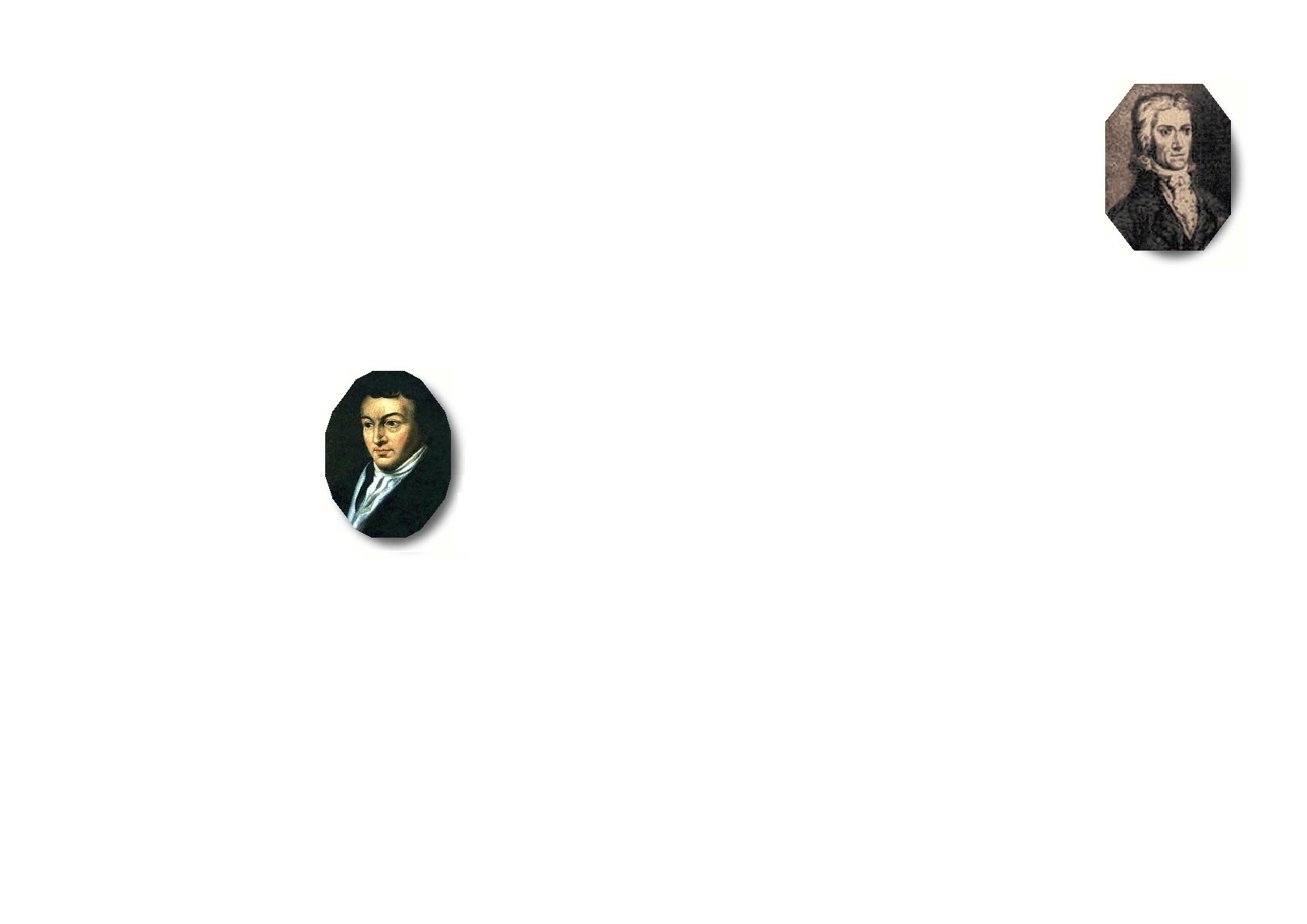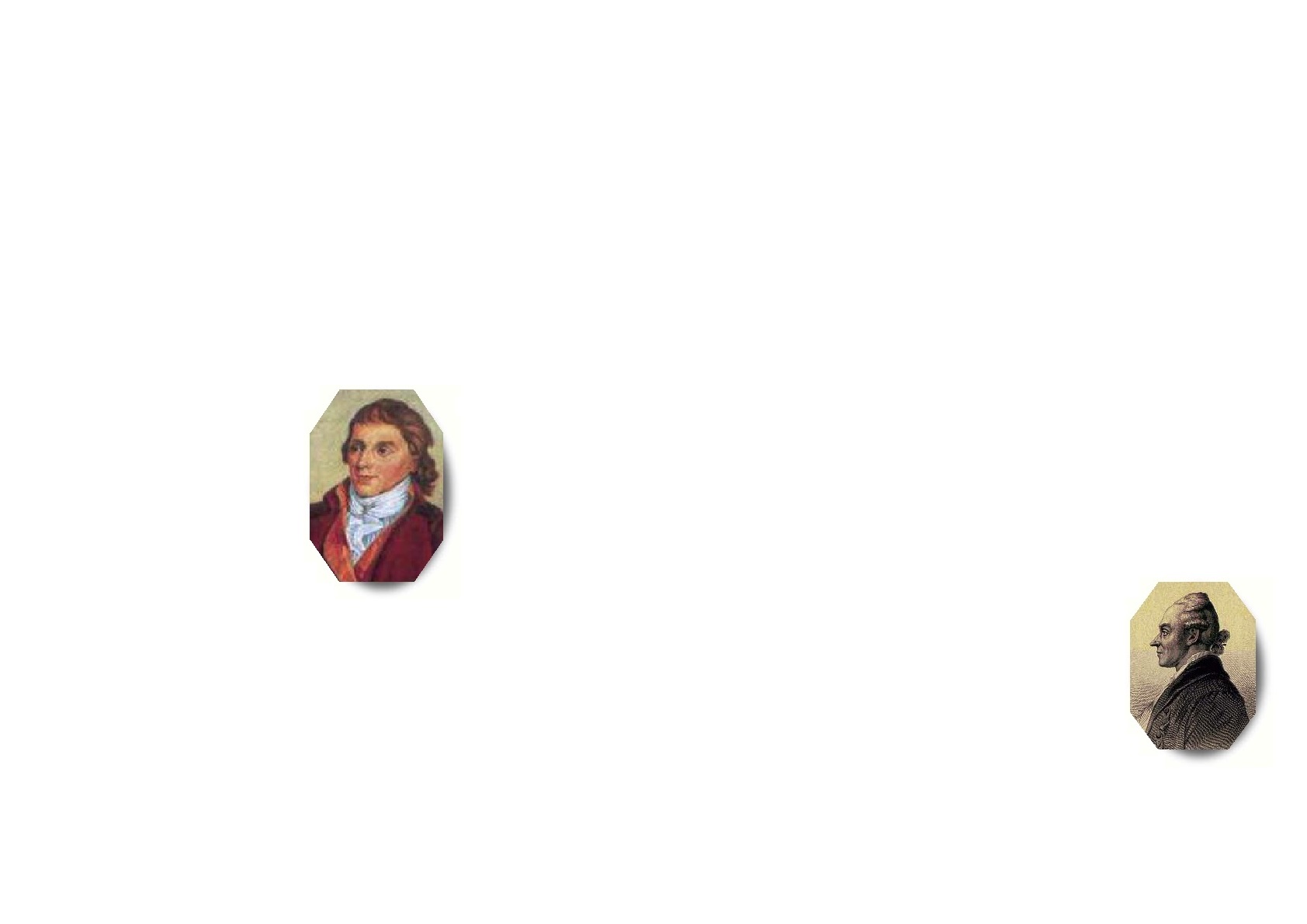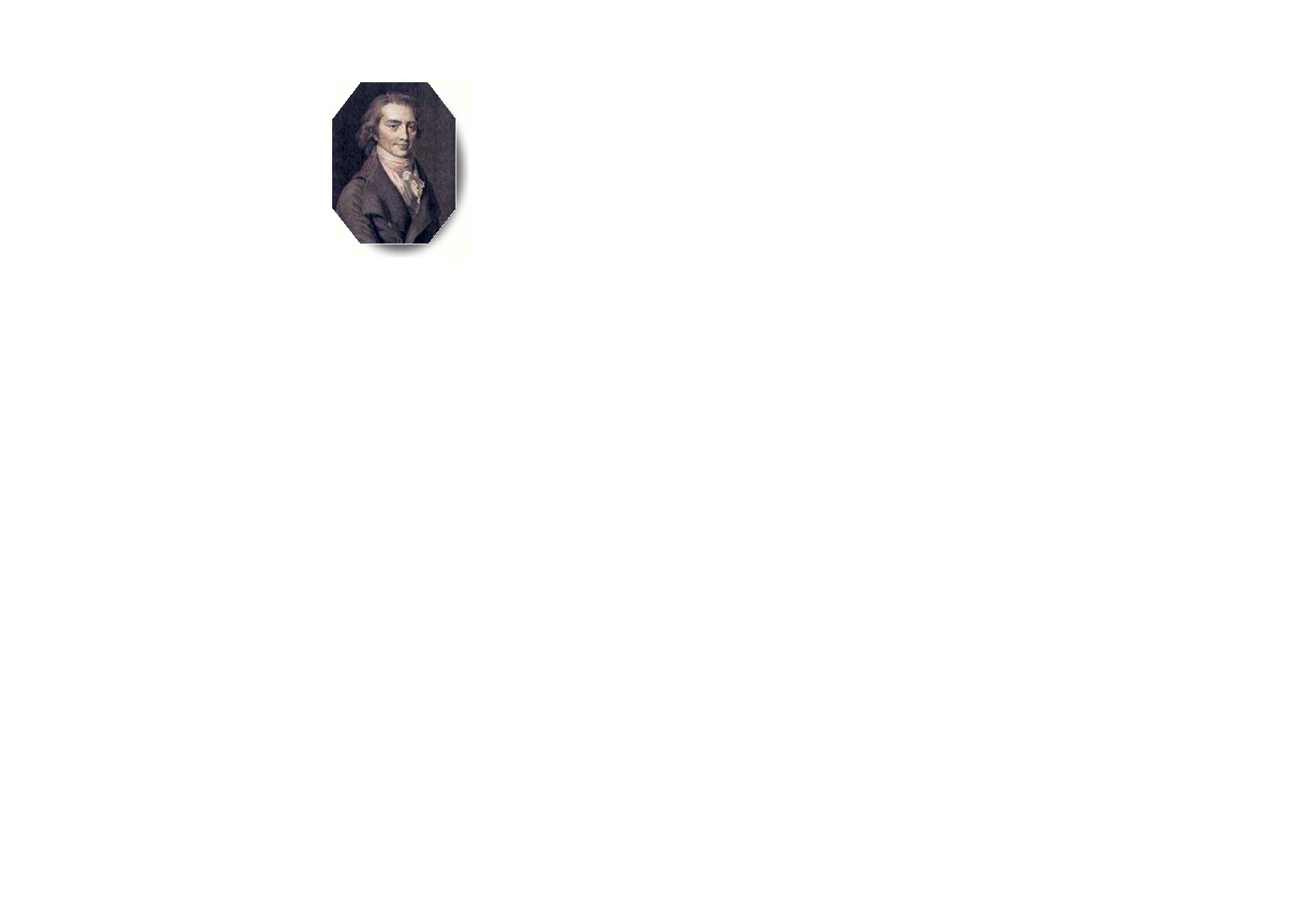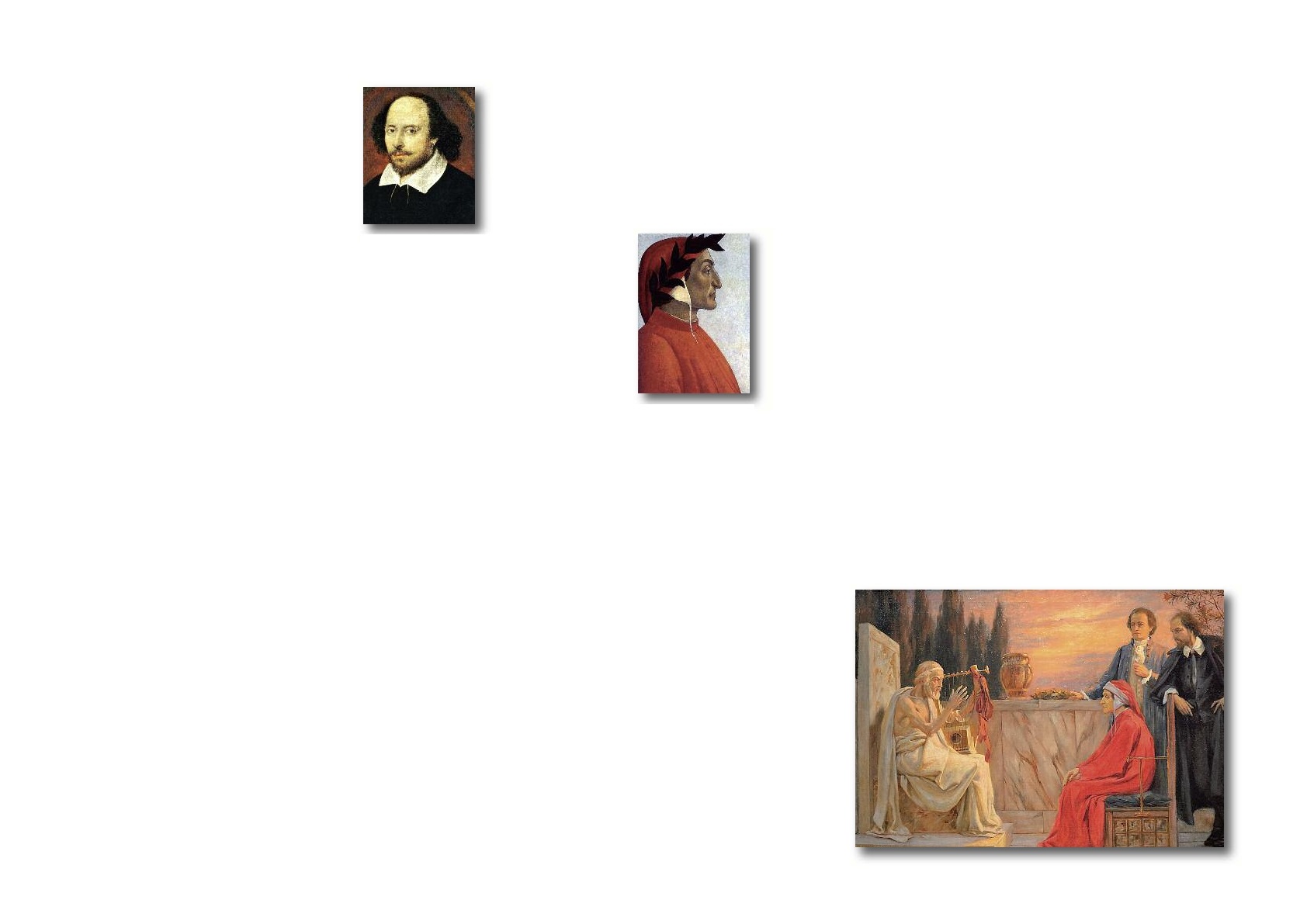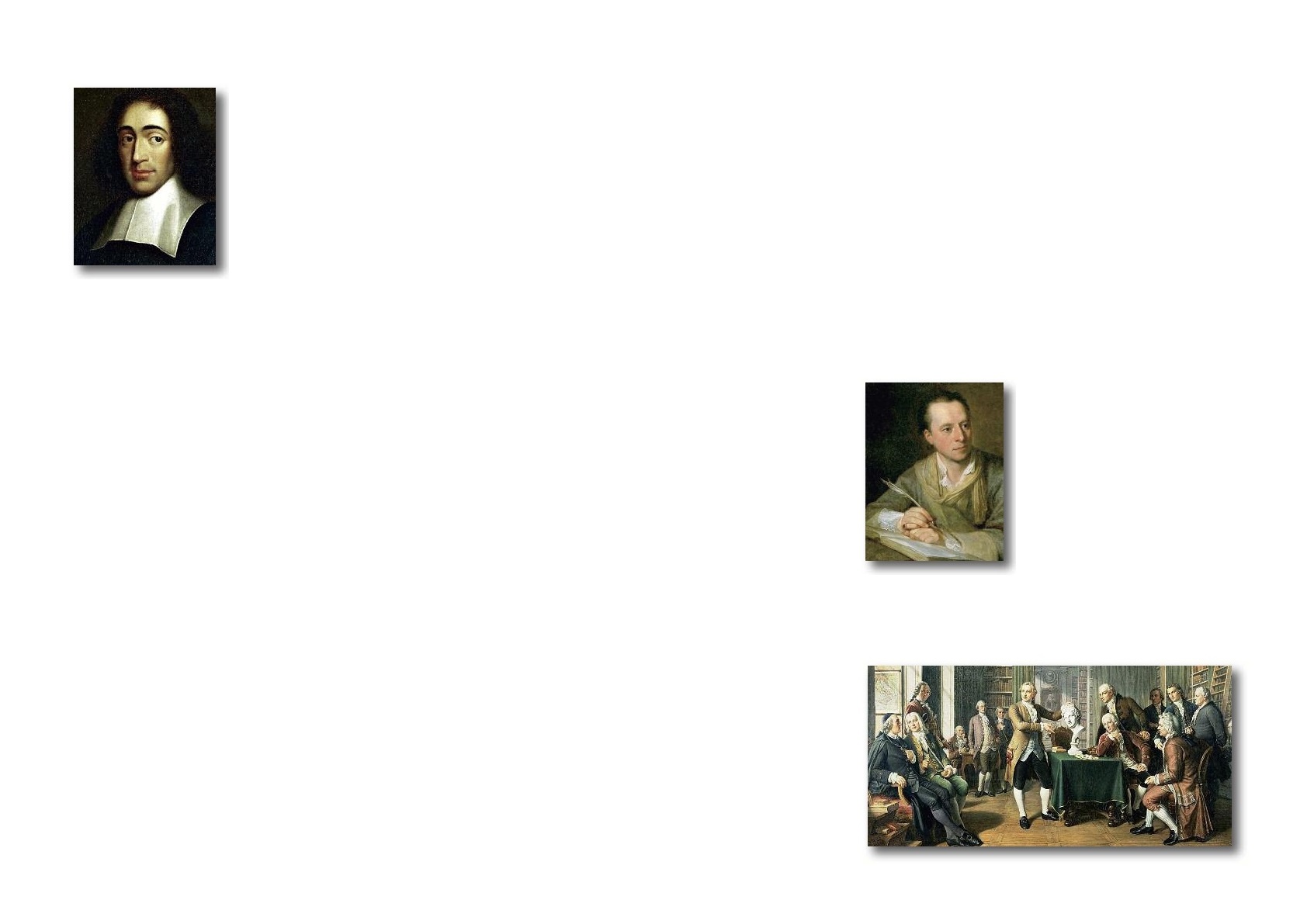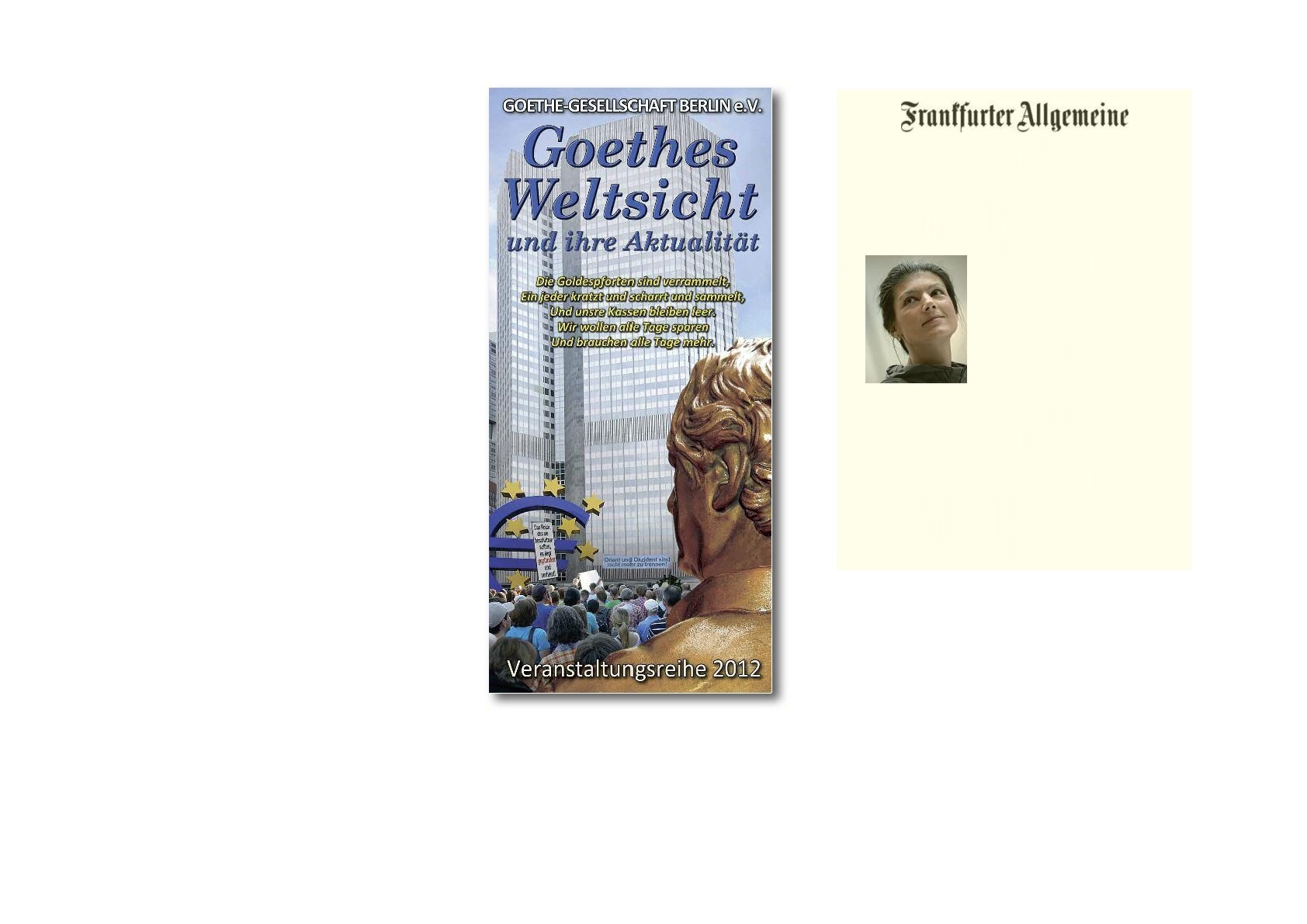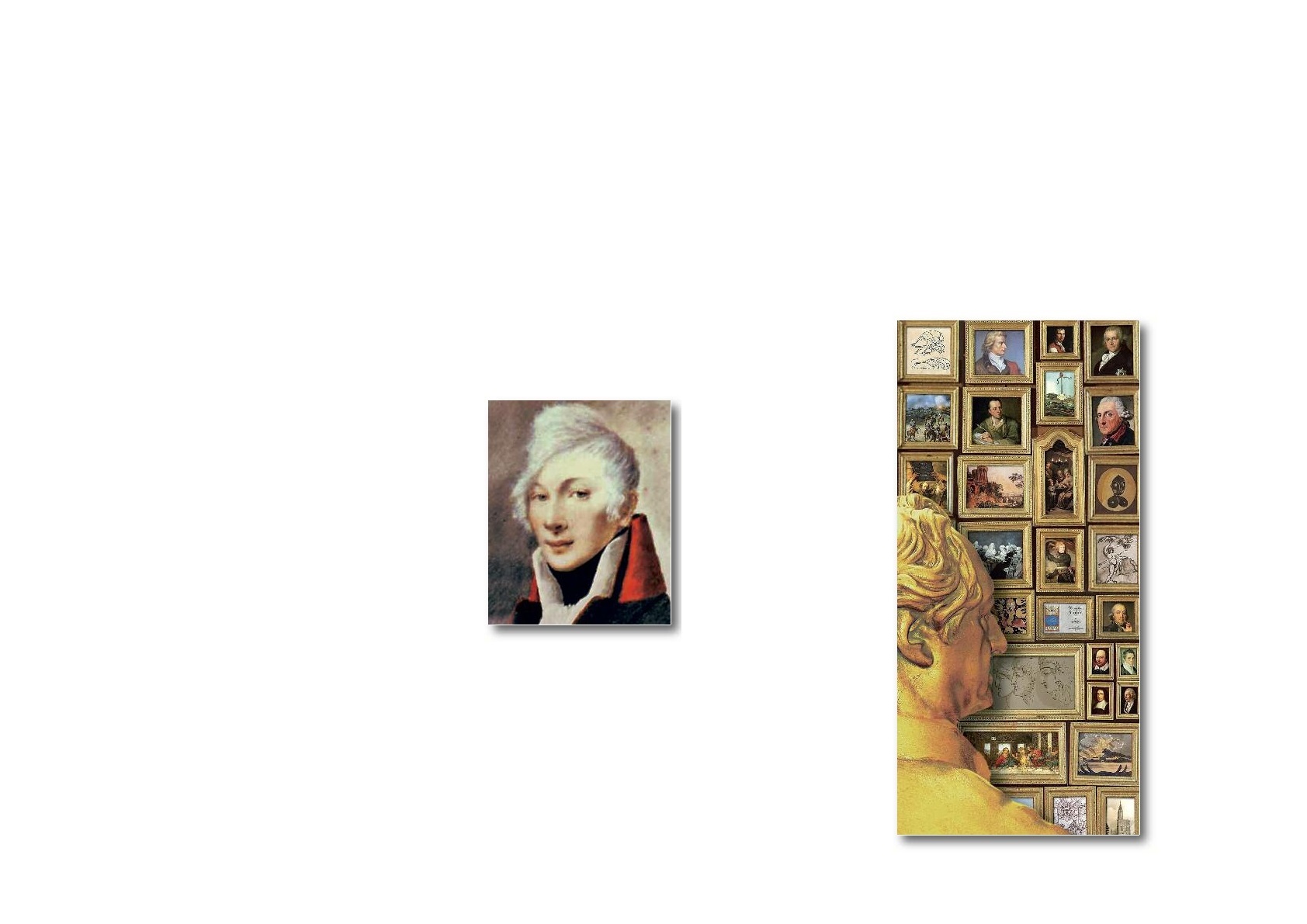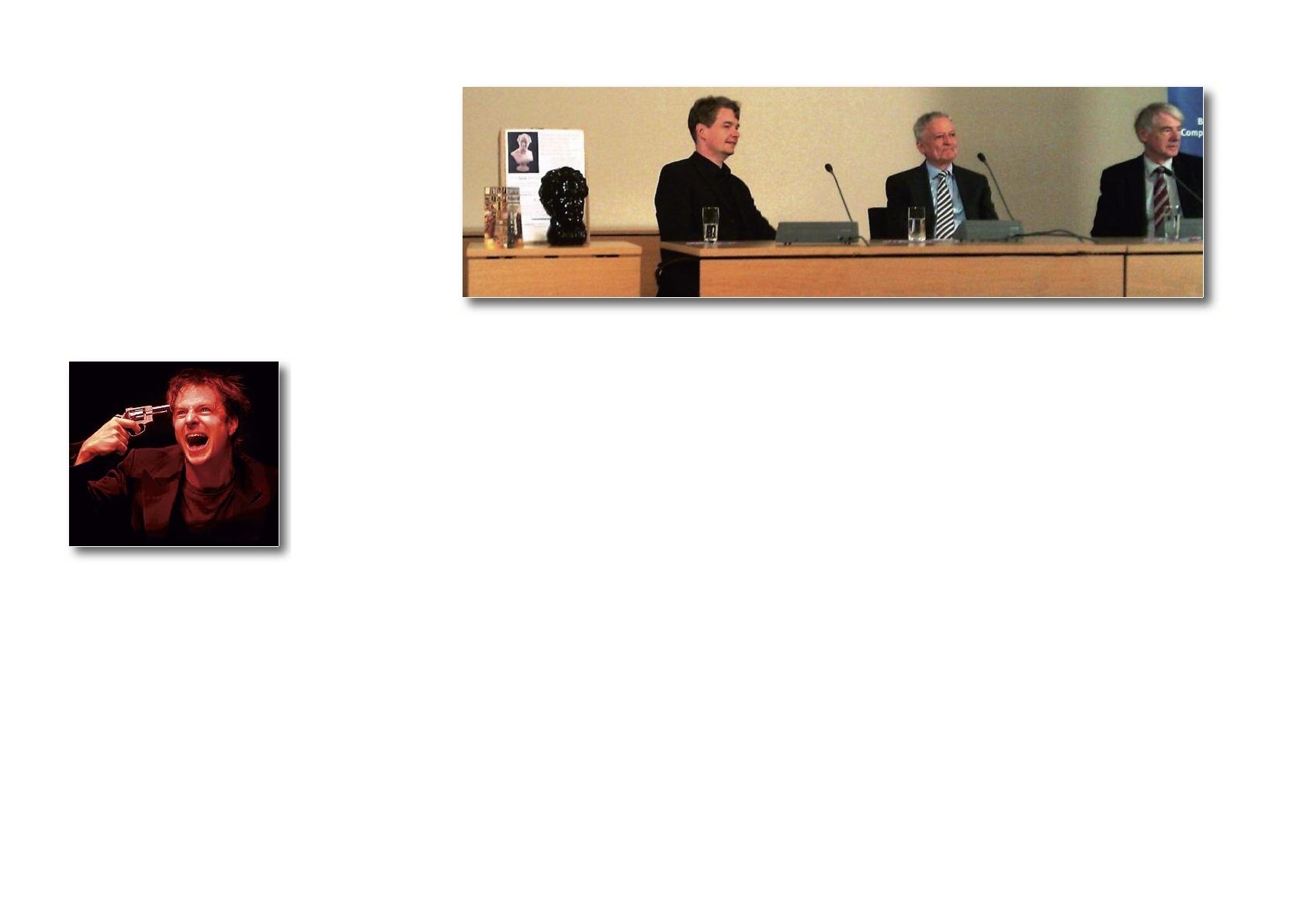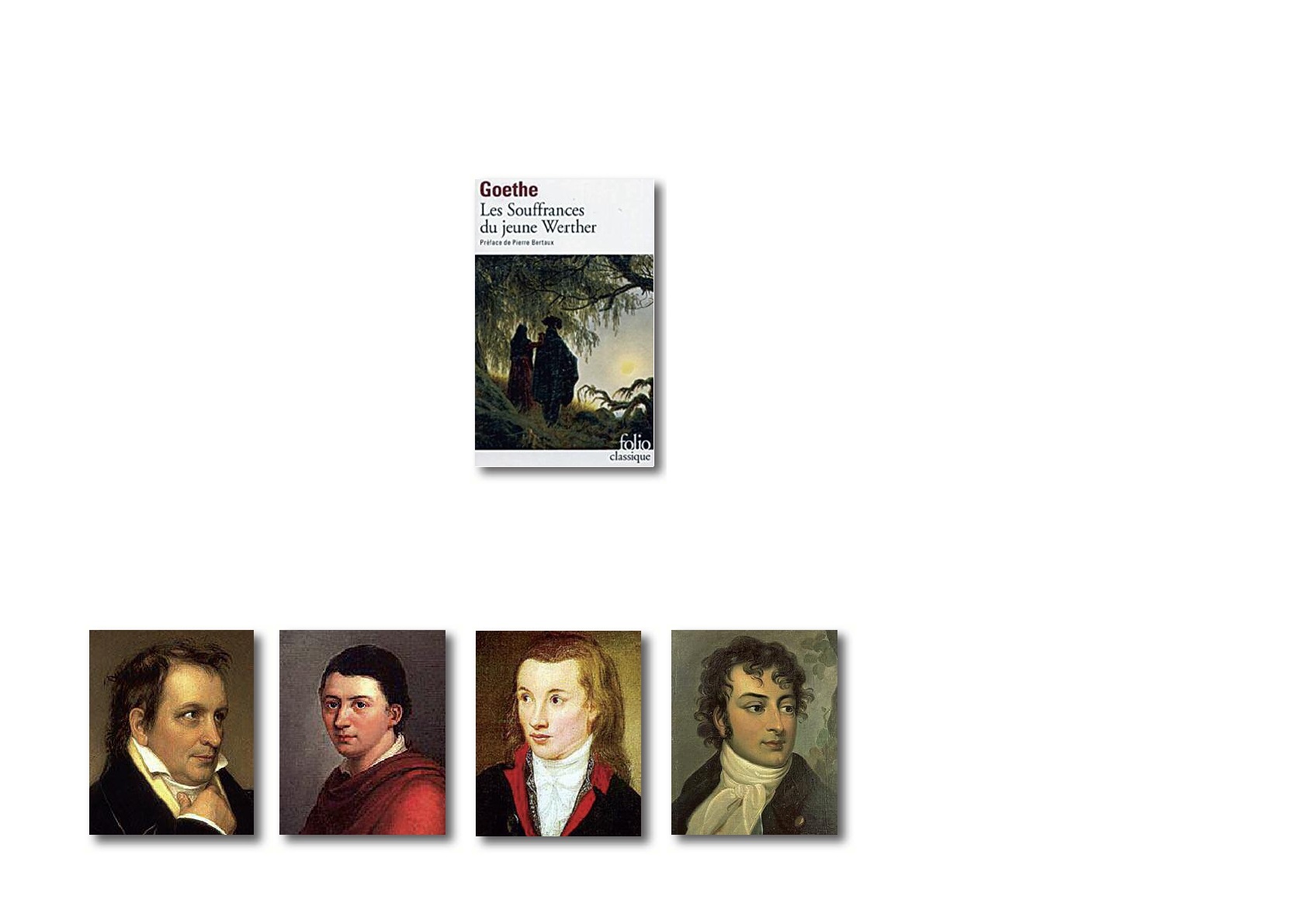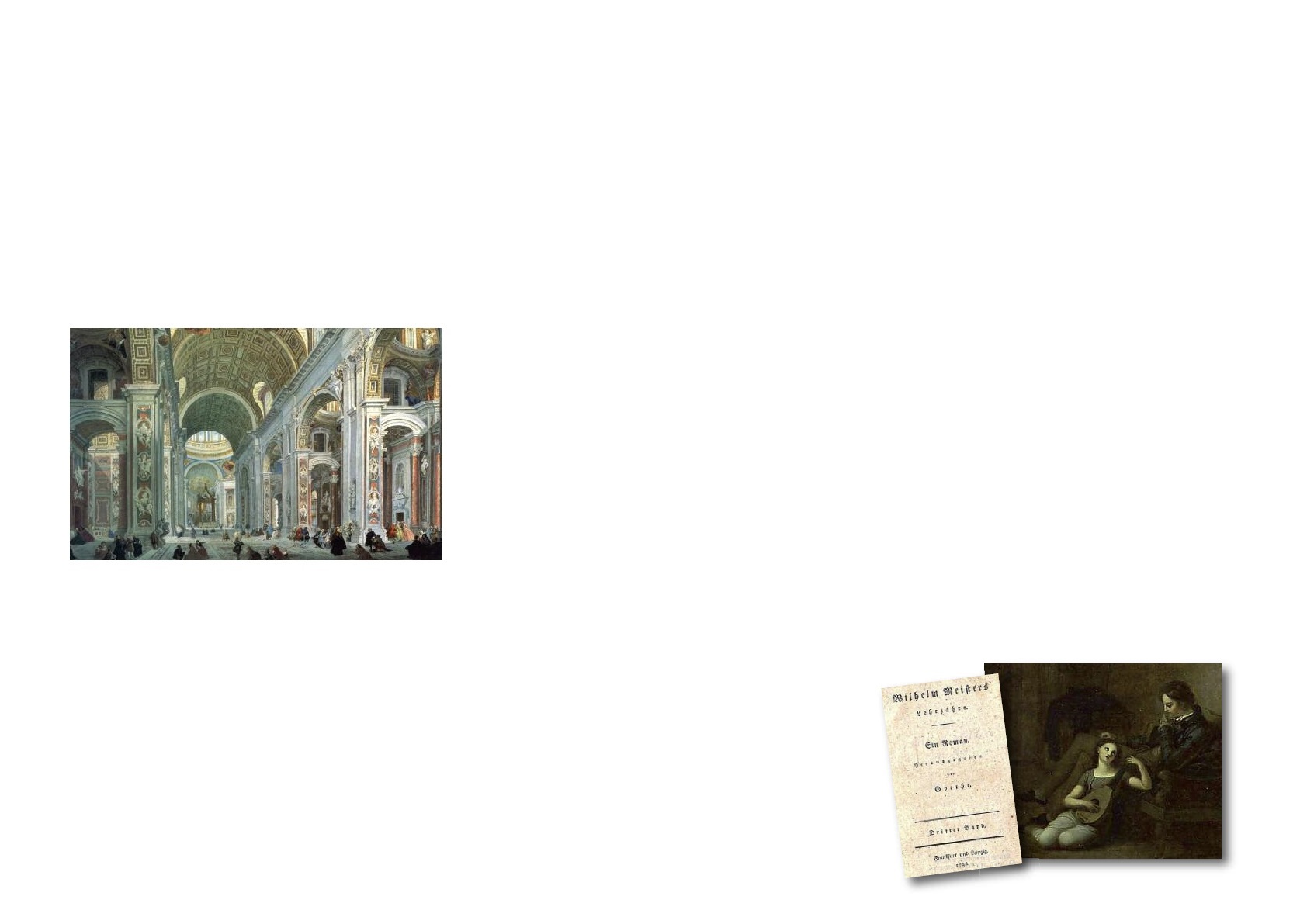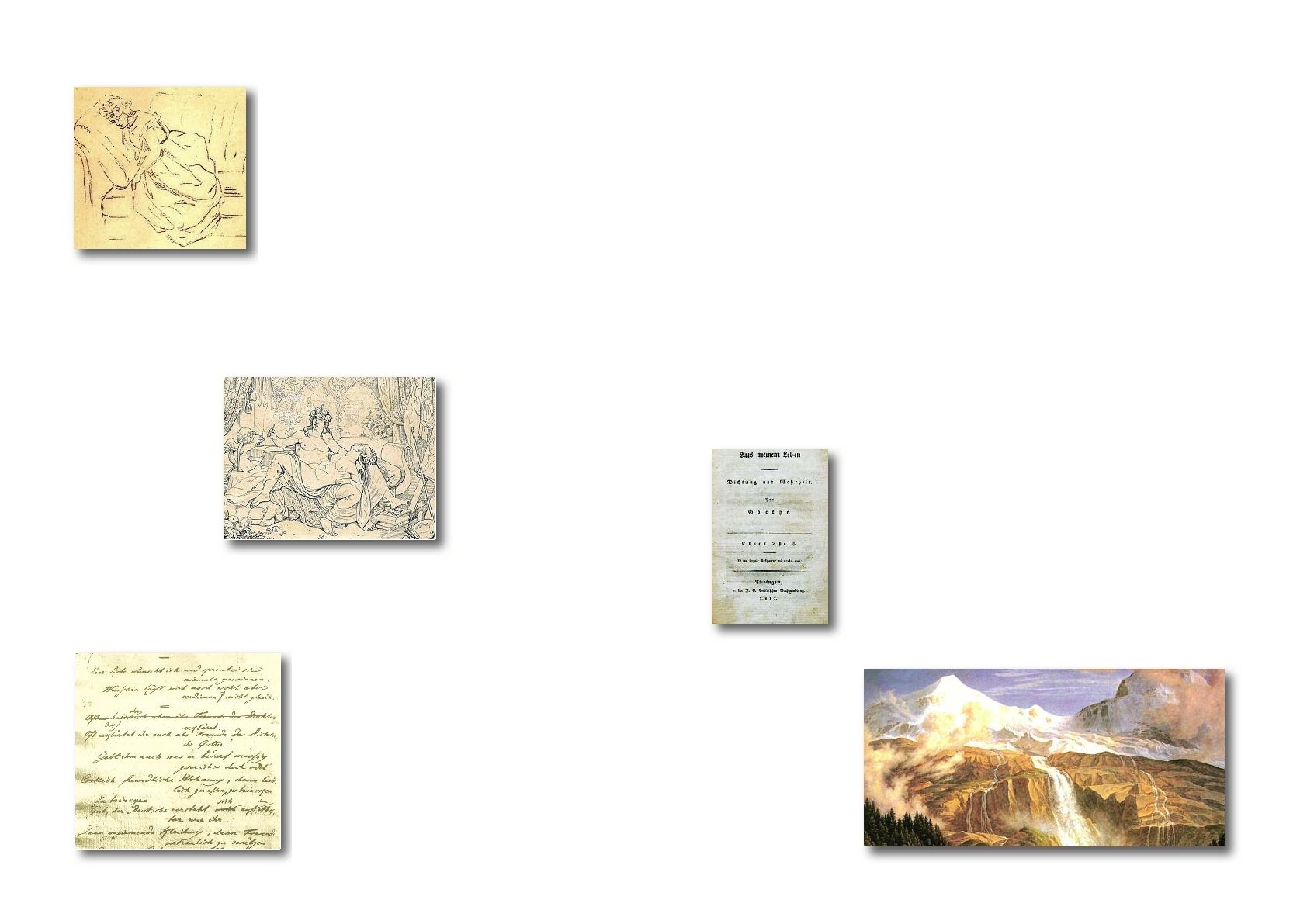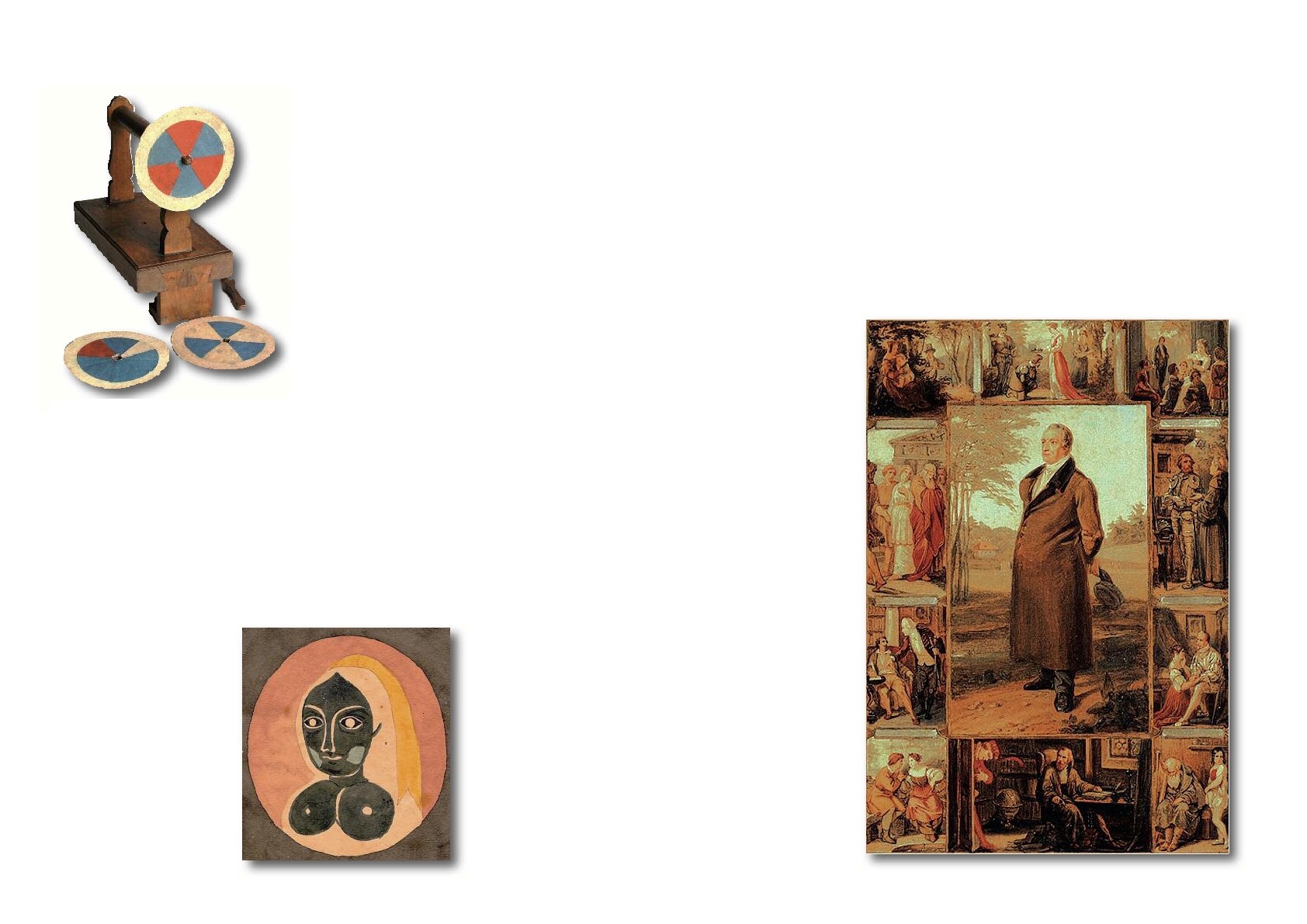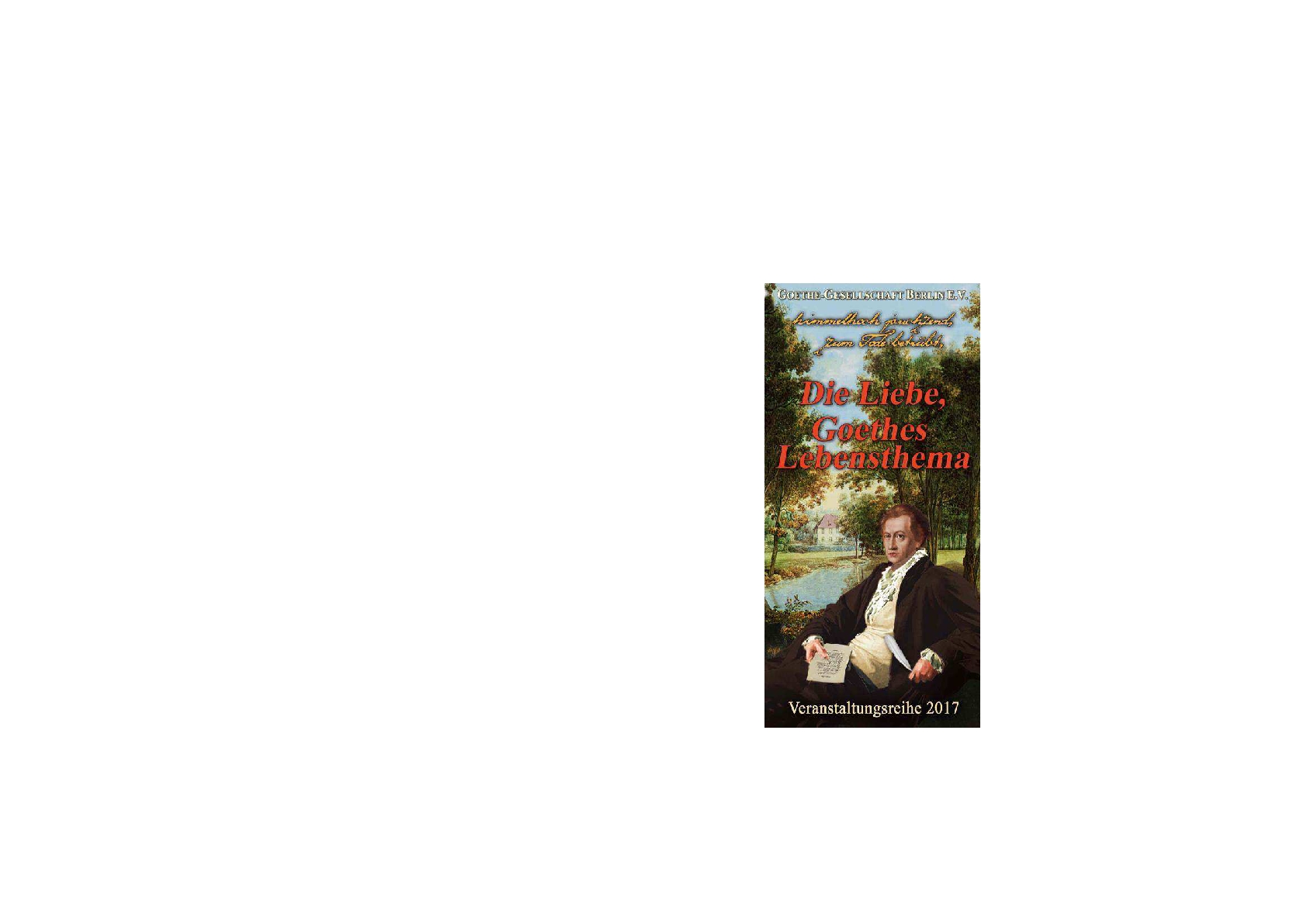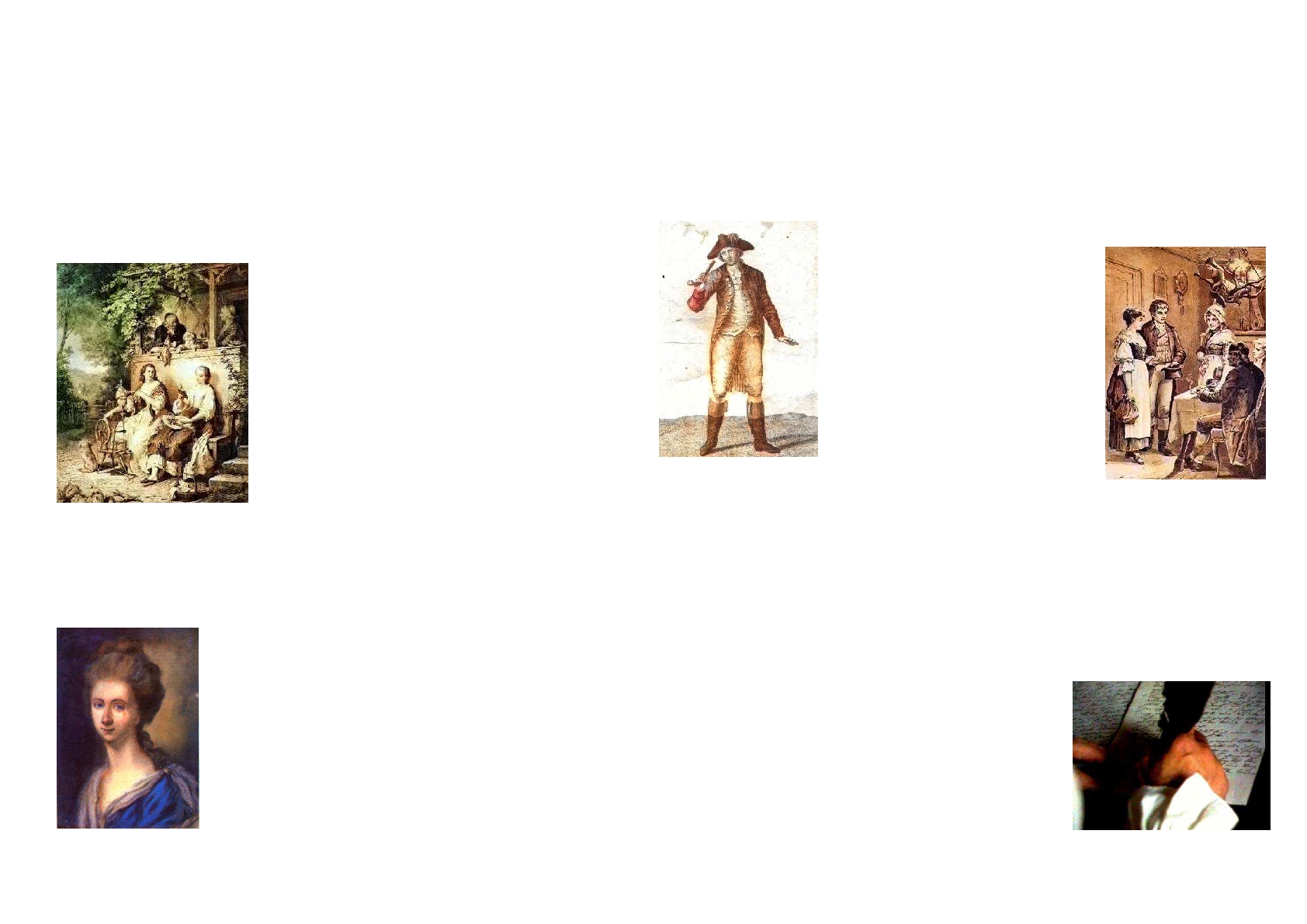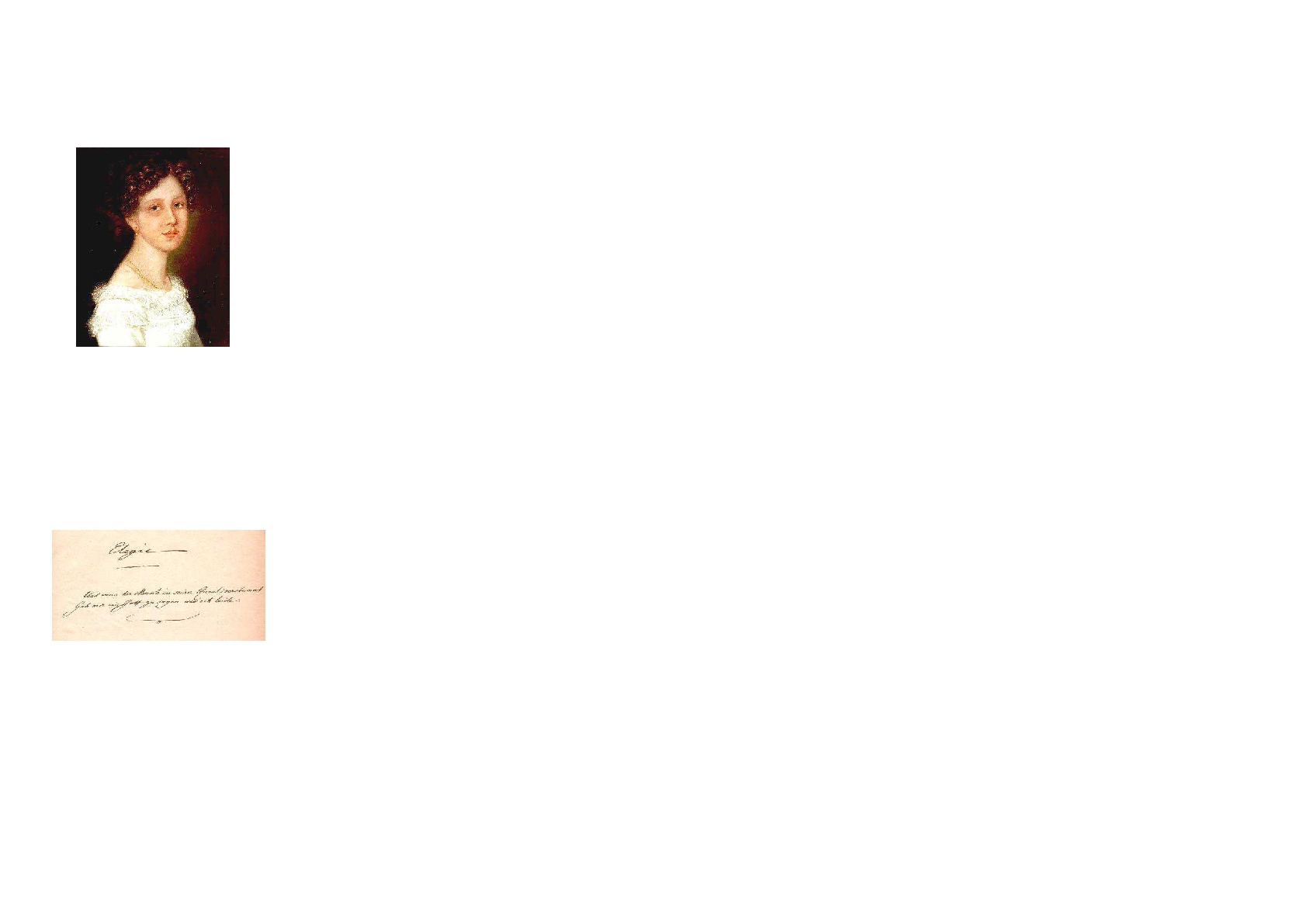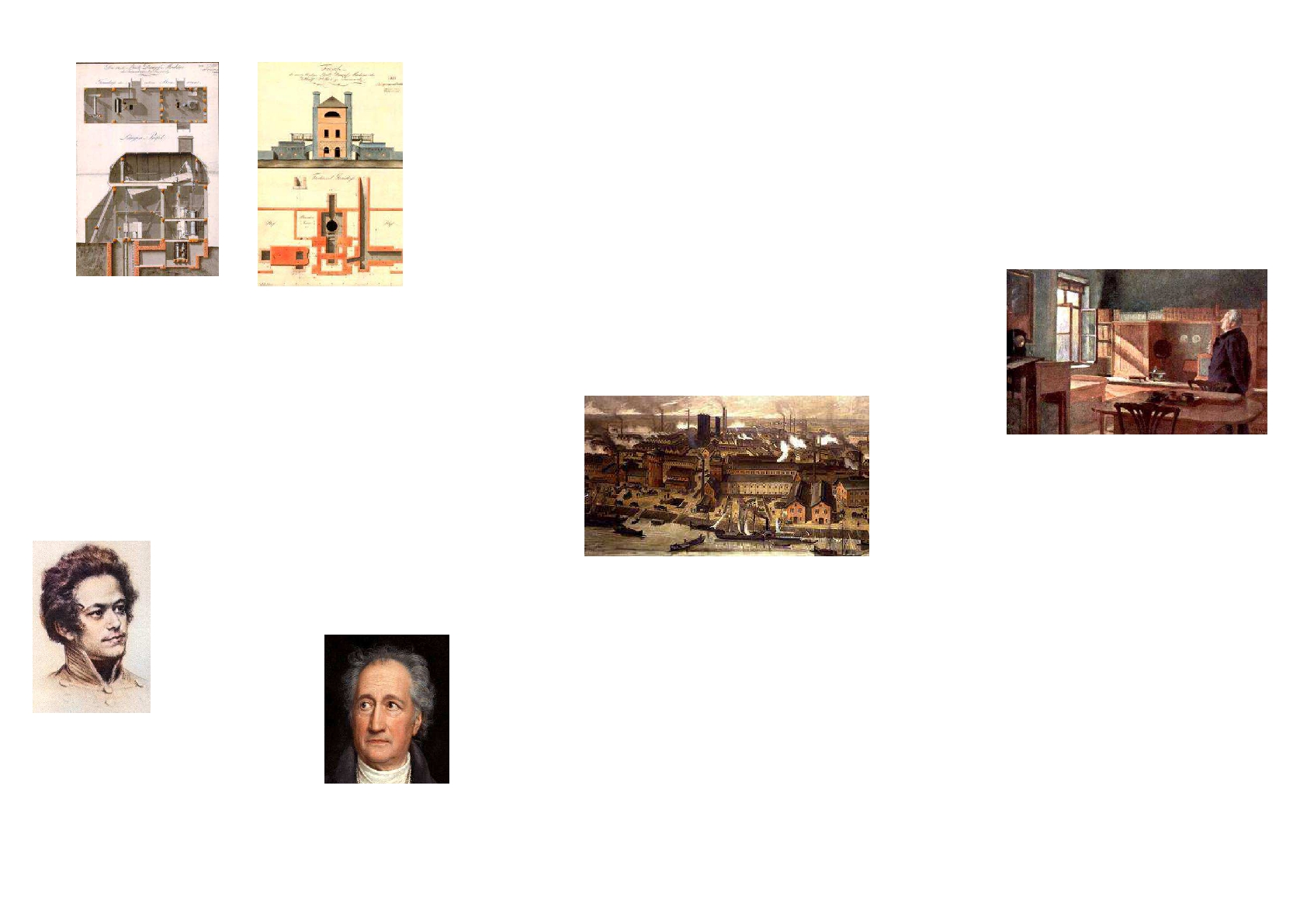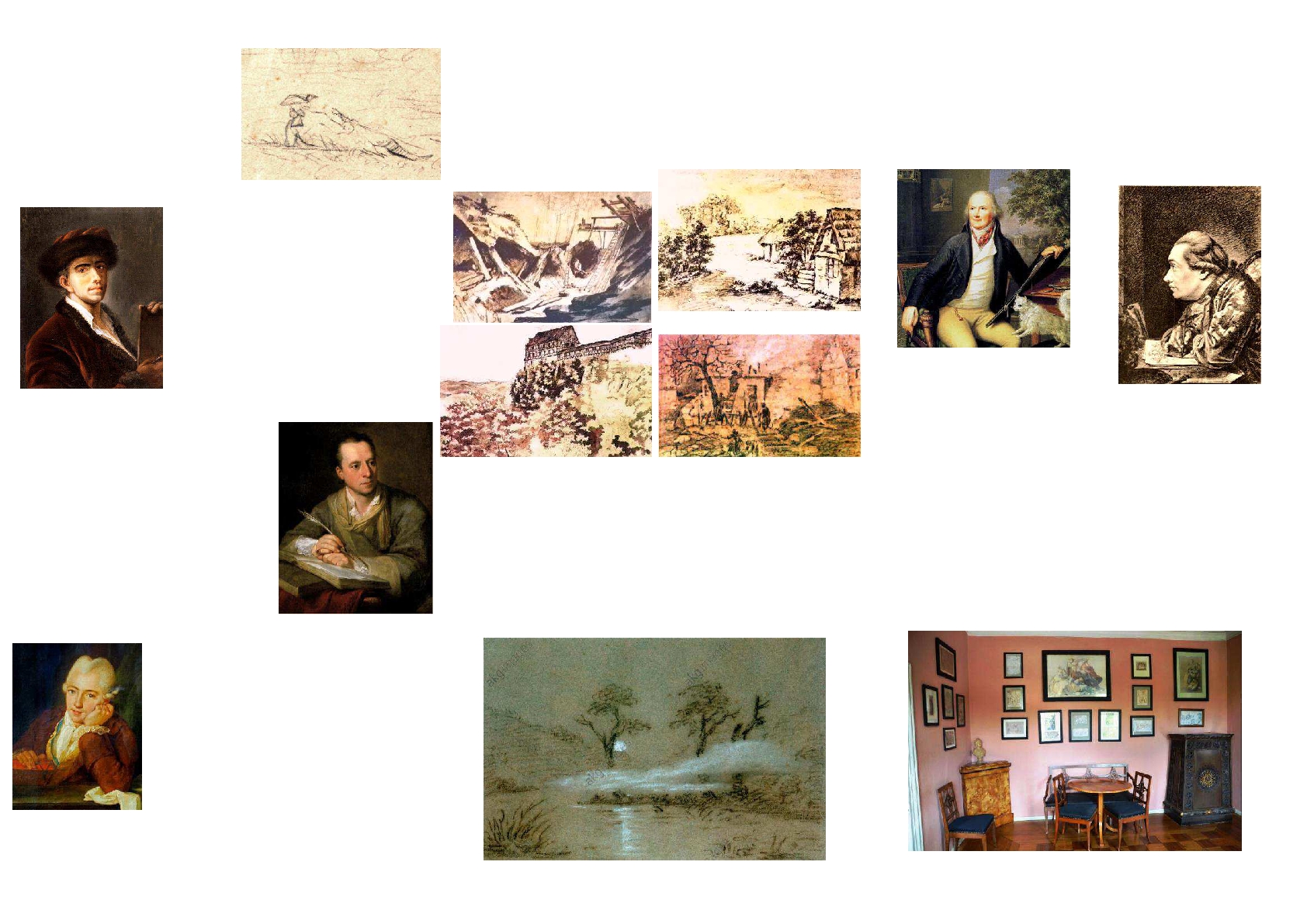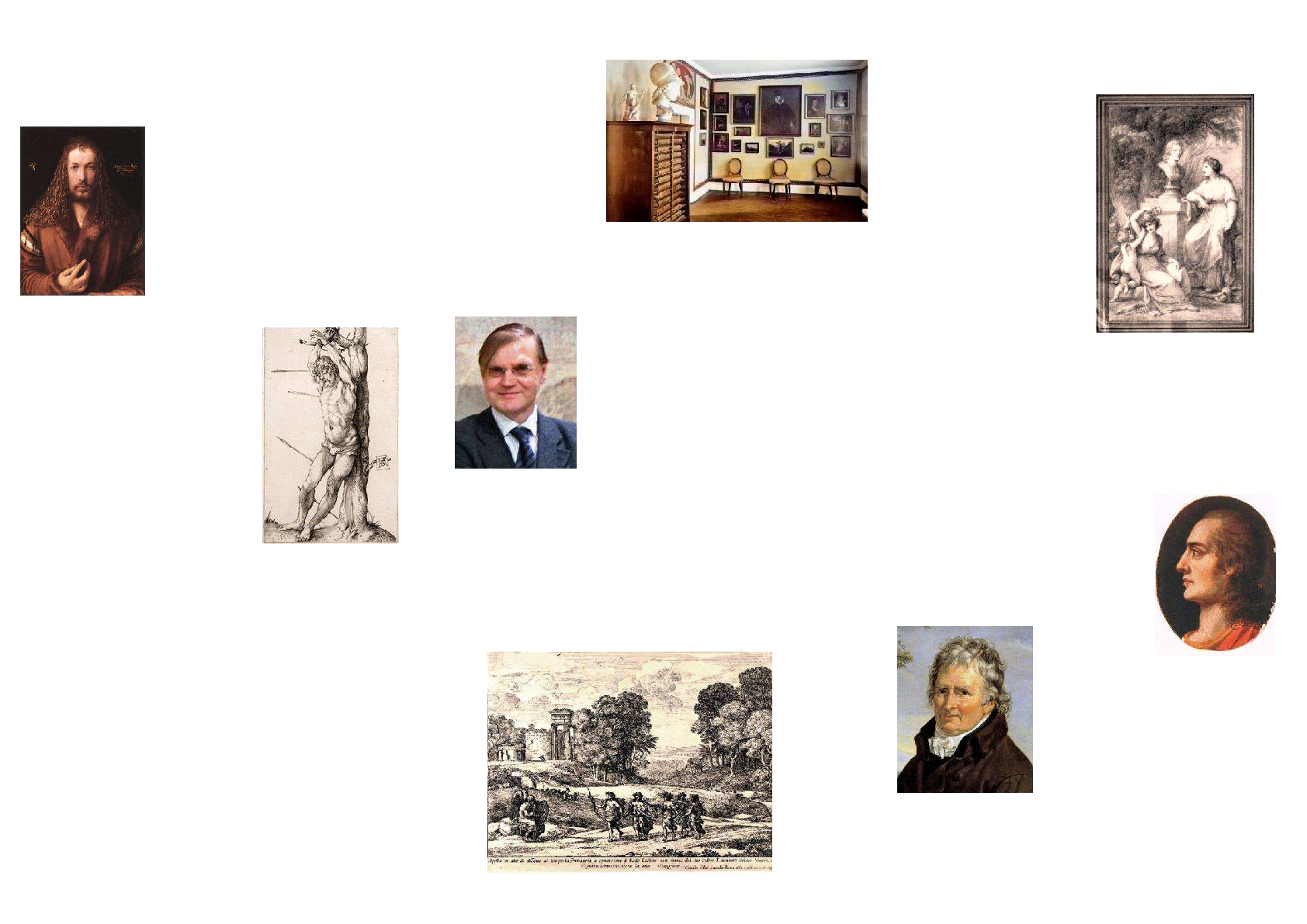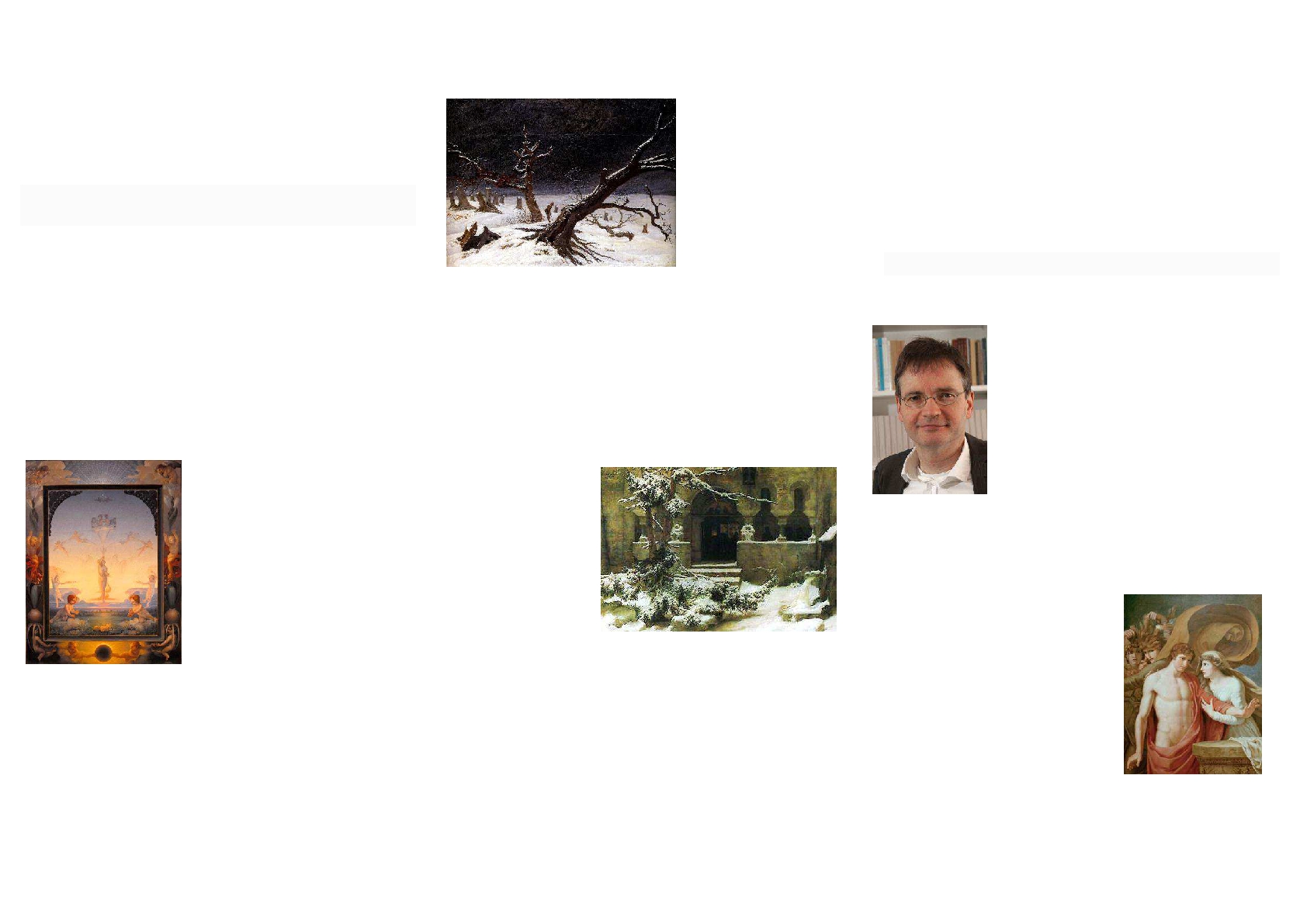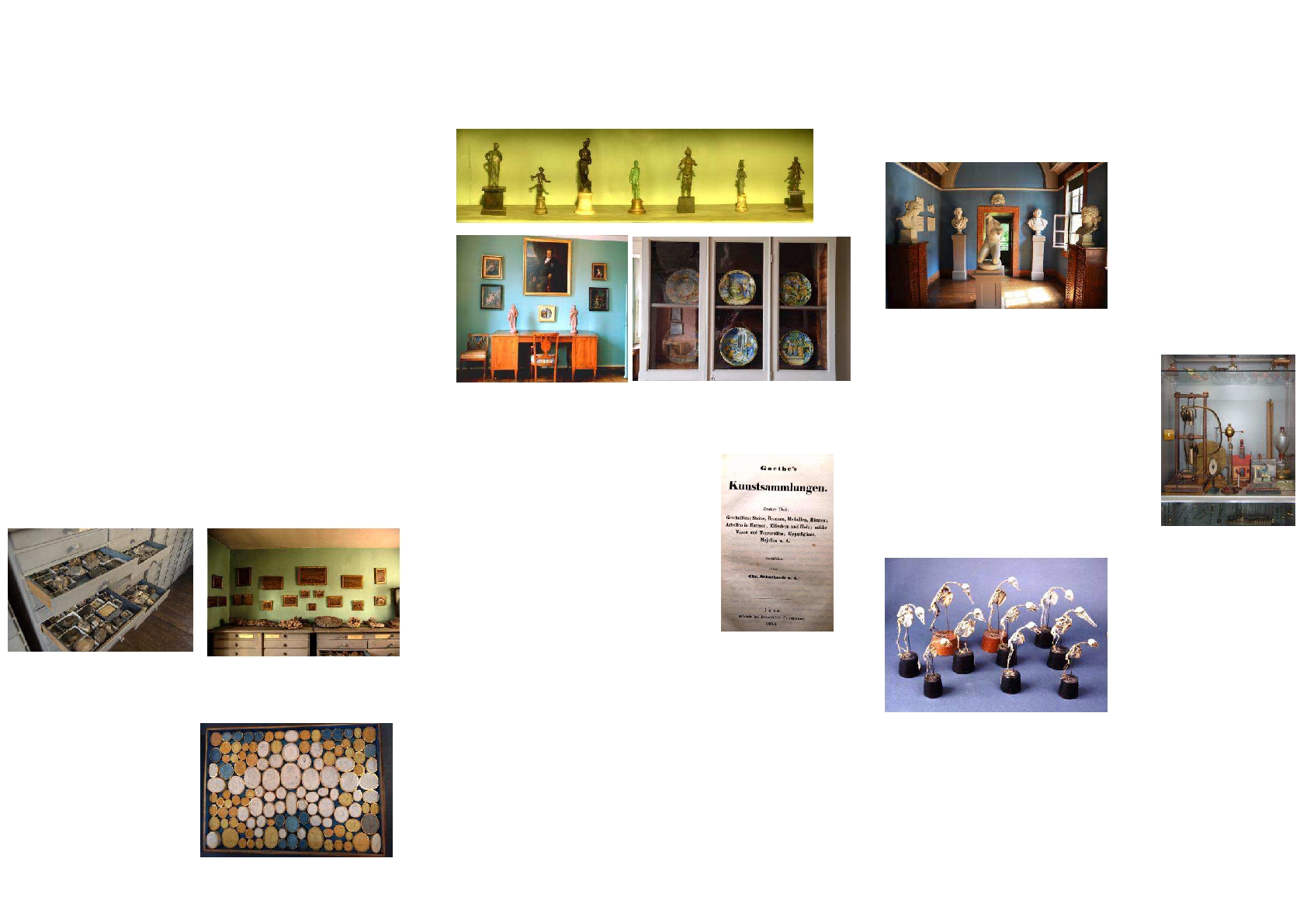Veranstaltungen 1987-2024
Tagesfahrt nach Bad Lauchstädt, Goethe-Theater, Inszenierung
Die Zauberflöte
Prof. Dr. h.c. Karl-Heinz Hahn:
Thomas Mann und die Goethe-Gesellschaft
Prof. Dr. Norbert Miller:
Anmerkungen zur Münchener Ausgabe
Prof. Dr. Hans Wolfgang von Löhneysen:
Die Goethe-Büste von David d´Angers
Beate Schubert:
Goethe am Vorabend der Französischen Revolution
Prof. Dr. Hans-Jürgen Schings:
Die Initiation »Wilhelms Meisters«
Hans Joachim Mey:
Der Briefwechsel Marianne von Willemer und Hermann Grimm
Prof. Hans-Dieter Holzhausen:
Der Literaturkritiker und Goetheforscher Ludwig Geiger
Joachim Pukaß und Christian Rhode: Lesung
Goethes »Reinicke Fuchs«
Prof. Dr. Hans Wolfgang von Löhneysen: Seminar
Der Sammler und die Seinigen
Goethes 240. Geburtstag in Schuberts Garten – mit musikalischen Darbietungen
Prof. Dr. Paul Raabe:
Goethes verstreute Briefe
Tagesexkursion nach Wörlitz,
Führung durch die Gartenanlagen
Goethes 241.Geburtstag in Schuberts Garten – mit musikalischen Darbietungen
Tagesfahrt nach Weimar,
Anna Amalia und ihr Musenhof,
Exkursion nach Bischofsgrün:
Auf den Spuren Goethes zum Ochsenkopf,
Prof. Dr. Hans-Jürgen Schings:
Zeitkritik in Goethes »Wahlverwandtschaften«
Szenische Lesung
Goethes »Wahlverwandtschaften«
Frank-Volker Merkel-Bertholdi:
Leopardis »Consalvo« und Goethes »Werther«
Gesprächsabend über
Alfred Kirchners Inszenierung von Goethes »Faust I«
Theater: Peter Hacks:
Gespräch im Hause v. Stein ü. d. abwesenden Herrn von Goethe
Dr. Rudolf Elvers:
Die Mendelssohns und Goethe
Filmvorführung:
Carl August von Weimar – Goethes Freund
, Regie: Beate Schubert
Tagesfahrt nach Weimar
Goethes 242.Geburtstag in Schuberts Garten – mit musikalischer Umrahmung
Tagesfahrt nach Bad Lauchstädt, Besuch der Inszenierung von Goethes »
Urfaust«
Tagesfahrt nach Neu-Hardenberg, Führung durch Schloß und Parkanlagen
Prof. Dr. Kurt Biermann:
Alexander von Humboldt als Weggefährte Goethes
Dr. Birgit Weissenborn:
Bettina von Arnim und Goethe,
Szenische Lesung »
Die Wahlverwandtschaften«
Ulrich von Heintz:
Führung durch das Schloß Tegel
Goethes 243. Geburtstag in Schuberts Garten – Musikalisch literarischer Abend
Dr. Frank Schweitzer ;
Goethes »Farbenlehre«
Prof. Dr. Heide Eilert:
Goethe und die Malerei des 17. und 18. Jahrhunderts
Prof. Dr. Martin Seiler:
Exkursion über die Pfaueninsel
Goethes 244.Geburtstag in Schuberts Garten – Musikalisch-literarischer Abend
Filmvorführung:
Charlotte von Stein,
Regie: Beate Schubert
Prof. Dr. Siegfried Unseld:
Goethe, der Schriftsteller – vom Verleger gesehen
Prof. Dr. Otto Krätz:
Goethe und die Naturwissenschaften
, Vortrag mit Experimenten
Prof. Dr. Alfred Behrmann:
Italien, wir und die klassischen Reisen der Goethezeit
Dr. Ilse Jahn:
Alexander von Humboldt und Goethe
Exkursion ins Fichtelgebirge:
Mit dem Geologenhammer auf Goethes Spuren
Goethes 245. Geburtstag in Schuberts Garten – Musikalisch-literarischer Abend
Gottfried Eberle:
Goethe und die Musik
, mit gesungenen und gespielten Beispielen
Dr. Joachim Burkhardt: Buch- und Videovorführung:
Ein Film für Goethe
Dr. Manfred Obermann:
Der Einfluß der Freimaurerei auf Goethes Leben und Werk
Prof. Dr. Wolfgang von Löhneysen: »
West-östlicher Divan«: Buch der Betrachtungen
Dr. Werner Hennig:
Einführung in Goethetexte: »Das Märchen» – »Novelle«
Dr. Werner Hennig:
Goethe Einkommen und Vermögen
Prof. Dr. Hans-Dieter Holzhausen:
Goethes Gespräche mit Eckermann
Dr. Gerhard Schewe:
Zum Goethebild Romain Rollands
Prof. Dr. Frank Nager:
Gesundheit, Krankheit und Tod bei Goethe
Film-Uraufführung
Goethe und sein Haus am Frauenplan
, Regie Beate Schubert
Goethes 246.Geburtstag in Frau Schuberts Garten – Musikalisch-literarischer Abend
Prof. Dr. Effi Biedrzynski:
Goethes Weimar
Dr. Ernst Schneider:
Goethe midlife-crisis in Italien
Reinhold Köpke:
Goethe – ein Vorläufer der Tiefenpsychologie
Prof. Dr. Ekkehart Krippendorff:
Goethe und der Orient
Dr. Dagmar von Gersdorff: Lesung
Königin Luise und Friedrich Wilhelm III.
Prof. Dr. Alfred Behrmann:
Goethes Reise nach Sizilien
Goethes 247.Geburtstag in Schuberts Garten – Konzert
Tagesfahrt nach Naumburg: Stadtbesichtigung und Führung durch den Dom
Tagesfahrt nach Dornburg: Besichtigung des Renaissance- und des Rokokoschlosses
Dr. Renate Grummach:
Goethe im Gespräch – aus der Arbeit eines Editors
Peter Stein:
Über die Möglichkeiten, den Gesamtfaust zu inszenieren
316
Prof. Dr. Hans-Jürgen Schings:
Schillers Kritik am Illuminatenorden und ihre Folgen
Beate Schubert:
Goethes Verhältnis zu Büchern
Dr. Jochen Klauß:
Charlotte von Stein – eine Weimarer Legende
Goethes 248. Geburtstag: Wannsee-Dampferfahrt z. 10-jährigen Bestehens der GG-Bln.
Dr. Dagmar von Gersdorff: Lesung
Bettina und Achim von Arnim
Prof. Dr. Volker Hesse:
Goethes Konstitution und Krankheiten
Tagesexkursion: Besuch der Inszenierung
Faust I,
Anhaltinisches Theater Dessau
Prof. Dr. Otto Krätz:
Alexander v. Humboldt – Wissenschaftler, Weltbürger, Revolutionär
Tagesexkursion nach Leipzig:
Klein Paris und der junge Goethe
Tagesexkursion: Anhaltinisches Theater Dessau, Besuch der Inszenierung »Faust II«
Goethes 249.Geburtstag in Schuberts Garten – musikalisch-literarischer Abend
Prof. Martin Seiler (SPSG): Führung durch die Potsdamer Gärten
Prof. Dr. Ekkehart Krippendorff:
Deutschlands dienstältester Minister
Maria Erxleben:
Goethes Verhältnis zu Berlin
Dr. Gudrun Fritsch: Führung durch das Käthe-Kollwitz-Museum, anschließend:
Dr. Wolfgang Butzlaff:
Käthe Kollwitz und Goethe
Hans-Hellmut Allers:
Goethe und das Berliner Theater
Prof. Dr. Ernst Osterkamp:
Goethe und Wilhelm von Humboldt
Dr. Helmut Börsch-Suphan:
Goethes Dichtungen als Inspirationsquelle Berl. Künstler
Dr. Hartmut Schmidt:
Goethe, Nicolai und die Berliner vor 225 Jahren
Tilmann Buddensieg:
Schinkel, Rauch und Goethe
Prof. Dr. Frank Schneider:
Goethe und Reichhardt
Gottfried Eberle:
Goethe Interesse an Zelters Singakademie
Prof. Dr. Norbert Miller:
Goethe im Hause Mendelssohn
Prof. Dr. Hartmut Böhme, Jan-Lüder Röhrs, Prof. Dr. Ferdinand Dammerschun:
Alexander von Humboldt
, Podiumsdiskussion
Prof. Dr. Volker Hesse:
Gesundheit und Krankheit bei Goethe
Dr. Hubert Heilemann:
Goethe als Patient
Prof. Dr. Manfred Heuser:
Die Newton Kritik – eine paranoide Psychose Goethes?
Prof. Dr. Wolfgang Schad:
Goethe als Psychiater
Goethes 251. Geburtstag in Schuberts Garten – Muskalisch-literarisches Programm
Dr. Hartmut Schmidt:
Essen und Trinken bei Goethe
Prof. Dr. Manfred Bühring:
Goethe Anschauen in der Medizin
Prof. Dr. Heinz Schott:
Medizin der Goethezeit
Dr. Gunhild Pörksen:
Gesundheit und Krankheit in Goethes Tagebüchern und Briefen
Prof. Dr. Henrik Birus:
Die Wiederbegegnung des alten mit dem jungen Goethe
Dr. Renate Grötzebach:
Zwei Leseabende zu Goethes »Werther«
Was geht uns heute Goethe an?
Diskussion mit Schülern über »Werthers« Leiden
Jahrestagung der deutschen Goethe-Gesellschaften e.V.
Ausstellung
Goethe – Berlin –Mai 1778
, Staatsbibliothek Berlin (Haus I)
Filmvorführung:
Die neuen Leiden des jungen W.
(1976),
Ulrich Plenzdorf:
Rückblick nach 30 Jahren,
Diskussion mit dem Autor
Joachim Wohlleben:
Goethes »Werther« im Kontext seiner Zeit
Goethes 252. Geburtstag in Schuberts Garten, Lesung:
Der Mann von 50 Jahren
Prof. Dr. Volker Hesse:
Goethes Beziehungen zu Kindern und Heranwachsenden
Hans-Wolfgang Kendzia:
Fünf Leseabende zu Goethes »Faust II«
Prof. Dr. Ekkehart Krippendorff:
Gespräch über Peter Steins »Faust«-Inszenierung
Dr. Klaus-Michael Köppen:
Goethe als geriatrischer Patient
Dr. Dagmar von Gersdorff: Autorenlesung
Goethes Mutter und Schwester
Dr. Josef Mattausch:
Goethes Jugendliebe Katharina Schönkopf
Dr. Wolfgang Butzlaff:
Goethes Verlobungen und Gelöbnisse
Monika Schopf-Beige:
Friedrike Brion und Lili Schönemann
Musikalisch-literarischer Abend –
Die Liedgedichte des jungen Goethe
Dr. Harald Schmidt:
Werthers Lotte – Wahrheit und Dichtung
Ottilie Lohss:
Charlotte von Stein – Goethes Freundin
Prof. Dr. Friedmar Apel:
Iphigenie in Weimar
Eckart Henscheid: Lesung
Frauen unter Goethe
Dr. Franziska Schöffler:
Frauengestalten in »Wilhelm Meisters Lehrjahre«
Siegfried Seifert:
Die Weimarer Primadonna Karoline Jagemann
Eckart Kleßmann:
Christiane Vulpius im Urteil der Zeitgenossen
Hans-Hellmut Allers:
Bettine von Arnim und ihre Beziehung zu Goethe
Prof. Dr. Theo Buck:
Mariannne von Willemer und Goethe
Cornelia Kühn-Leitz: Rezitationsabend
»Buch Suleika«
aus dem
»West-östlichen Divan«
Prof. Dr. Katharina Mommsen:
Die Dichterin Marianne von Willemer
Dr. Heike Spies:
Die Frauengestalten in »Wilhelm Meisters Lehrjahre«
Prof. Dr. Detlev Jena:
Goethes Verhältnis zur Großfürstin Maria Pawlowna
Filmvorführung:
Die Wahlverwandtschaften
mit anschließender Diskussion
Hans-Wolfgang Kendzia:
Goethes Einstellung zur Ehe
Dr. Klaus-Michael Koeppen: Ulrike von Levetzow
Monika Schopf-Beige:
Ottilie von Goethe
Prof. Dr. Werner Busch:
Goethe und die Künste
Hans-Hellmut Allers:
Der Dramatiker und Theaterleiter Goethe
317
Prof. Dr. Katharina Mommsen:
Die Malerin Angelica Kauffmann
Dr. Michael Engelhard:
Goethe und Palladio
Gottfried Eberle:
Goethe und die Musik
Prof. Dr. Ernst Osterkamp:
Goethe als Leser Johann Joachim Winckelmanns
Dr. Jochen Klauss:
Johann Heinrich Meyer, Goethes Künstlerfreund
Hans-Wolfgang Kendzia:
Goethes Portraitisten und sein Verhältnis zu ihnen
Dr. Helmut Börsch-Suphan:
Goethe und Schinkel
Prof. Dr. Norbert Miller:
Der Dichter, ein Landschaftsmaler
Dr. Manfred Koltes:
Das Verhältnis der Gebr. Boisserée im Spiegel ihrer Korrespondenz
Hans-Hellmut Allers:
Goethe und Schiller – Freundschaft und Arbeitsgemeinschaft
Monika Schopf-Beige:
»Das Märchen« – Eine Botschaft Goethes an Schiller
Rainer Schmitz:
Weimarer »Xenien« – Anmerkungen zur lit. Streitkultur um 1800
Prof. Dr. Rolf-Peter Janz:
Schillers und Goethes Annäherung an das antike Theater
Prof. Dr. Katharina Mommsen:
Goethes Anteil an Schillers »Wilhelm Tell«
Dr. Angelika Reimann:
Goethe und Schillers und ihr Balladenschaffen
Prof. Dr. Volker Hesse:
Goethe und die Medizin
Prof. Dr. Hans-Jürgen Schings:
Die Weimarer Klassik und das Böse
Hans-Wolfgang Kendzia:
Anmerkungen zum Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller
Ulrich Ritter und Christian Steyer: Lesung:
Goethe und Schiller – eine Begegnung
Hans-Helmut Allers:
Dr. Faustus in Historie und Literatur
Prof. Dr. Frank Möbus:
Zur Entstehungsgeschichte von Goethes »Faust«
Dr. Alwin Binder:
Visionen moderner Welt in Goethes »Faust I« vor und nach 1800
PD Dr. Michael Jaeger:
Mephistos Modernität
Dr. Manfred Osten:
Zur Aktualität der »Faust«-Tragödie
Event Theaters Brandenburg in der Ruine des St.-Pauli-Klosters
»Faust I«
Prof. Dr. Volker Hesse:
Dr. Faustus und Dr.med Johann Wolfgang Goethe
Dr. Angelika Reimann:
Goethes Gretchentragödie u. d. Kindsmord im 18. Jahrhundert
Prof. Dr. Theo Buck: »
Faust II«, 5. Akt – Fausts Tod, ein tragisches Ende?
Prof. Dr. Alfred Behrmann:
Die Dramaturgie der »Faust«-Dichtung
Hans-Hellmut Allers:
Goethe 1775-1786 – Das erste Weimarer Jahrzehnt
Dr. Jochen Golz:
Ein Portrait der Herzogin Anna-Amalia
Dr. Thomas Franzke:
Goethe und das Weimarer Liebhabertheater
Prof. Dr. Jan Philipp Reemtsma:
Wieland in Oßmannstedt bei Weimar
Dr. Manfred Osten:
Goethe als Leiter der Kriegskommission
Dr. Angelika Reimann:
Goethes amtliche Tätigkeit vor und nach der italienischen Reise
Prof. Dr. Theo Buck:
Goethe – ein politischer Schriftsteller?
Prof. Dr. Ekkehart Krippendorff:
Politische Dimensionen der Weimarer Theaterarbeit
Prof. Dr. Katharina Mommsen:
Goethes berufliche Auseinandersetzung mit Friedrich II
.
Hans-Hellmut Allers:
Goethes lebenslange Suche
Ursula Homann:
Goethes Glaube und Gottesvorstellung
Dr. Manfred Osten:
Goethe u. d. Verheißungen der Lebenswissenschaften im 21. Jhdt.
Prof. Dr. Ludolf von Mackensen:
Goethe und die Alchemie
Prof. Dr. Hans-Jürgen Schings: »
Faust« – die alte und die neue Schöpfung
Goethes 259. Geburtstag, Jürgen Thormann liest
Goethe: Meine Religion, mein Glaube
Prof. Dr. Volker Hesse:
Goethes Ergründung der Naturwissenschaften
Dr. Otto Krätz:
Chemische und physikalische Experimente bei Goethe
Beate Schubert:
Esoterik in Goethes Leben und Werk
Prof. Dr. Theo Buck:
Goethes Entelechie
Hans-Hellmut Allers:
Goethes Freunde,Weggefährten und Lehrmeister
Beate Schubert:
Goethes Lehrmeister in Frankfurt und Leipzig
Dr. Michael Zaremba:
Johann Gottfried Herder – Goethes Mentor
Dr. Ulrike Leuschner:
Die schwierige Freundschaft zwischen Goethe und Merck
Dr. Egon Freitag:
Zum Verhältnis von Goethe und Wieland
Dr. Manfred Osten:
Zur Modernität des Goethe-Jacobi-Verhältnisses
Prof. Dr. K. Mommsen:
Goethes und Schillers Bündnis im Spiegel ihrer Dichtungen
Prof. Dr. Volker Hesse:
Goethe, die Jenenser u. weitere Lehrer d. Naturwissenschaften
Dr. Volker Ebersbach:
Goethes Freundschaft mit Carl August u. m. Carl Friedrich Zelter
Prof. Dr. Manfred Geier:
Goethe und die Gebrüder Humboldt
Dr. Bettina Fröhlich:
Goethes Platon-Rezeption
Prof. Dr. Günter Häntzschel:
Goethe zu Homer
Dr. Manfred Osten:
Zur Aktualität der Hafis-Rezeption bei Goethe
Prof. Dr. Hendrik Birus:
Goethes Shakespeare
Prof. Dr. Alfred Behrmann:
Dantes Spuren bei Goethe – ein Fährtengang
Dr. Michael Engelhard:
Der Sprachmeister Goethe als Erbe Luthers
Prof. Dr. Christoph Perels:
Goethes kritische Verehrung für Rousseau, den Erzieher
Prof. Dr. Theo Buck:
Goethes Verhältnis zu Moliere,Voltaire und Diderot
Dr. Manfred.Osten:
Goethes Spinoza-Begeisterung
Prof. Dr. Volker Riedel:
Goethes Blick auf die Jahrhundert-Gestalt Winckelmann
Dr. Detlev Lüders:
Goethes Aktualität
(Einführung)
Prof. Dr. Dieter Borchmeyer:
Goethes Altersfuturismus
Dr. Manfred Osten:
Goethe als Manager unserer Krisen
Prof. Dr. Wulf Segebrecht:
Goethe in Gedichten der Gegenwart
Prof. Dr. Ekkehart Krippendorff:
Die Entdeckung des politischen Goethe
Prof. Dr. Josef Mattausch:
Vom Leben der Goethe-Sprache
Hans-Hellmut Allers:
Goethes Haltung zu Liebe, Ehe und Familie
318
Dr. Elisabeth von Thadden:
Zur Aktualität von Goethes »Wahlverwandtschaften«
Prof. Dr. Volker Hesse:
Goethes naturwiss. Forschungen – ihre aktuelle Bedeutung
PD Dr. Michael Jaeger:
Fausts Weltkolonisation – Zur Aktualität Goethes
Prof. Dr. Theo Buck:
Goethe heute
Dr. M. Osten u. Dr. Sahra Wagenknecht:
Über den Eigentumsbegriff bei Goethe
Dr. Bernhard Bueb:
Was die deutsche Schule von Goethe lernen sollte
Dr. Adolf Muschg:
Goethes Natur als Beziehungsfähigkeit
Prof. Dr. Uwe Hentschel:
Zur Modernität von Goethes »Werther«
Prof. Dr. Katharina Mommsen:
Goethe und die Weltkulturen
Prof. Dr. John-Dylan Haynes, Dr. Manfred Ostenund, Prof. Dr. Wolf Singer:
Podiumsgespräch
Naturwissenschaftliche Implikationen in Goethes Denken
Dr. Manfred Osten:
Zur Aktualität von Goethes Asienverständnisses
Hans-Hellmut Allers:
Goethe zwischen Aufklärung, Klassik und Romantik
Rainer Falk:
Der junge Goethe und die Berliner Aufklärung
Gösta Knothe (Regisseur):
Die zwei inkommensurablen Teile des Goethe’schen »Faust«
Prof. Dr. Uwe Hentschel:
Die lit. Fehde zwischen Goethe und den Berliner Aufklärern
Prof. Dr. Hans Richard Brittnacher:
Der Konflikt zwischen Goethe und Kleist
Prof. Dr. Helmut Schanze:
Goethe und die Frühromantik
Prof. Dr. Christa Lichtenstern:
Goethe und die Skulptur
Theater Palais am Festungsgraben: »
Reinecke Fuchs«
zu Goethes 264.Geburtstag
Prof. Dr. Hartmut Fröschle:
Goethes Verhältnis zu der Dramatik der Romantiker
Prof. Dr. Conrad Wiedemann:
Goethes Mann in Berlin – Der Briefwechsel mit Zelter
Dr. M. Osten:
Die Romantik und Goethes Widerstand gegen deren Kunst u. Literatur
Prof. Dr. Theo Buck:
Goethes »Werther« im Urteil der europäischen Romantik
Dr. Manfred Osten:
Goethes Dichtung und was ist Wahrheit?
Robert Walter-Jochum, M.A.:
Goethes Sesenheim in »Dichtung und Wahrheit«
Prof. Dr. Gesa Dane:
Fakten und Fiktionen in Goethes »Die Leiden des jungen Werthers«
Prof. Dr. Peter André Alt:
Goethes »Torquato Tasso« als Drama der sozialen Form
Prof. Dr. Rüdiger Safranski, Dr. Manfred Osten:
Goethe – Kunstwerk des Überlebens
Prof. Dr. Uwe Hentschel:
Warum Goethe über Italien keinen Reisebericht verfaßte
Dr. Ariane Ludwig:
Entstehung und Komposition von »Wilhelm Meisters Wanderjahren«
Prof. Dr. Dirk v. Petersdorff:
Widersprüche in Goethes Leben u. Lyrik
Prof. Dr. Anne Bohnenkamp-Renken:
Aus der Arbeit an der historisch-kritischen
Hybrid-Edition von Goethes »Faust II«
Prof. Dr. Peter André Alt:
Das Vorspiel als Endspiel: Goethes »Faust«-Prolog
PD Dr. Michael Jaeger:
Goethe, der Wanderer und »Faust«
Prof. Dr. Daniel W. Wilson:
Schillers Zensur der »Römischen Elegien«
u. d. »Venezianischen Epigramme«
Prof. Dr. Jutta Müller-Tamm:
Zu Goethes autobiogr. Schriften und ihrer Entstehung
Prof. Dr. Uwe Hentschel:
Goethes Briefe aus der Schweiz
Goethes 266.Geburtstag, Duo Con emozione:
Goethe-Vertonungen
Dr. Elke Richter:
Goethes Briefe an Charlotte von Stein
Dr. Manfred Osten:
Alexander von Humboldt in Goethes »Wahlverwandtschaften«
Prof. Dr. Volker Hesse:
Goethes Verständnis des Lichtes
Prof. Dr. Steffen Martus:
Die Entstehung von Goethes Lebenswerk
Dr. habil. Jochen Golz:
Der Weltbürger Goethe
)
Prof. Dr. Christof Wingertszahn:
Goethe und England
Prof. Dr. Theo Buck:
Die intensive Beschäftigung Goethes mit Frankreich
Prof. Dr. Michael Maurer:
Kulturmuster Bildungsreise – Goethe in Italien u. d. Folgen
Prof. Dr. Uwe Hentschel:
Die böhmischen Bäder: Refugium u. intellektueller Marktplatz
Dr. Manfred Osten:
Goethe, ein fernöstlicher Weltbürger
Prof. Dr. Volker Hesse:
Goethes Interesse an Südamerika
Dr. Manfred Osten:
Zur Modernität von Goethes Islam-Verständnis
PD Dr. Michael Jaeger:
Goethes Flüchtlinge
Prof. Dr. Hendrik Birus:
Goethes Idee der Weltliteratur
Dr. Manfred Osten:
Die Liebe – Goethes Glücksgeheimnis
Prof. Dr. Thorsten Valk:
Erotische Rollenspiele in der Lyrik des jungen Goethe
Prof. Dr. Uwe Hentschel:
Zur Natur- und Liebesdichtung im Sturm- und Drang
Detlef Schönewald:
Der Werther – ein Liebesversuch
August Dr. Heike Spies:
Verlobung und Hochzeit im Goethe-Umkreis
Beate Schubert:
Goethes Briefe und Zettelgen an Frau von Stein
Dr. Monika Estermann:
Die Wahlverwandtschaften - ein literarisches Experiment
Dr. Manfred Osten:
Die Liebe im westöstlichen Divan
Prof. Dirk von Petersdorff:
Die letzte Liebeserschütterung in der Marienbader Elegie
Prof. Dr. Uwe Hentschel:
Über die Aktualität von Goethes Werken
Dr. Manfred Osten:
Goethe, ein Vordenker der Migrationskrisen des 21. Jahrhunderts
Prof. Dr. Olaf L. Müller:
Goethe als Naturwissenschaftler – eine Rehabilitation!
Prof. Dr. Bertram Schefold:
Goethe und die moderne Wirtschaft
Prof. Dr. Uwe Hentschel:
Goethes Stadtflucht oder warum wir alle einen Kleingarten haben wollen
Podiumsdiskussion: Dr. Manfred Osten, Dr. Rüdiger Safranski:
Das Glück bei Goethe oder die Kunst des Überlebens
Podiumsdiskussion: Dr. Sahra Wagenknecht, Dr. Manfred Osten, Dr. Michael Jaeger:
Auf freiem Grund mit freiem Volker stehn – Alptraum oder Utopie
Prof. Theo Buck:
Goethe als Dramaturg des modernen Theaters
Dr. Bernhard Fischer:
Goethe und Cotta auf dem Weg zum modernen Urheberrecht
Dr. Michael Jaeger:
Feuermaschinen - Goethe und Marx
319
Beate Schubert:
Goethes Verhältnis zu den bildenden Künsten
Dr. Manfred Osten:
Einführung in Goethes Schule der Achtsamkeit
Dr. Petra Maisak:
Der junge Goethe und die bildenden Künste
Prof. Dr Norbert Christian Wolf:
Goethe Kunstanschauung vom Sturm und Drang bis zur Rückkehr aus Italien
Festakt im Konzerthaus am Gendarmenmarkt:
100 Jahre Goethe-Gesellschaft Berlin e.V.
Prof. Dr. Johannes Grave:
Ideal und Geschichte - Spannungen in Goethes Kunstauffassung um 1800
Prof. Dr. Hermann Mildenberger:
Goethes Weg zur Landschaft
Prof. Dr. Thorsten Valk:
Spannungsvolle Nähe - Goethe und die Kunst der Romantik
Prof. Dr. Stefan Matuschek (Jena):
Goethe Antike-Konzept in seiner historischen Entwicklung
Dr. Robert Steegers:
Der Sammler Goethe im Spiegel seiner Werke und seiner Zeit
Prof. Dr. Uwe Hentschel:
(Autographen) Sammeln als Leidenschaft
Dr. Markus Bertsch:
Wirkung und Rezeption Goethes in der zeitgenössischen Kunst
Dr. Manfred Osten (Bonn):
Goethes ganzheitliches Naturverständnis als Lyriker, Forscher und Pantheist
Dr. Thomas Schmuck:
Tagesfahrt nach Weimar: Führung durch die Ausstellung Abenteuer der Vernunft- Goethe und die Naturwissenschaften um 1800
Prof. Dr. Uwe Hentschel (Chemnitz/Berlin):
Naturgenie trifft auf Unnatur – Lyriker des Sturm und Drang
Prof. Dr. Volker Hesse (Berlin):
Goethe im Netzwerk der Naturwissenschaften
Dr. Thomas Schmuck (Weimar):
Goethes Gespräch mit der Erde
Dr. Hans-Georg Bartel (Berlin):
Goethe und der Wandel der Chemie zur exakten Naturwissenschaft um 1800
Goethe 271. Geburtstag in Krongut Bornstedt/ Sanssouci
Wolfgang Jorcke (Berlin):
Drei Leseabende zum Jahresthema Goethes Natur
Dr. Helmut Hühn (Jena):
Goethes Morphologie und Metamorphosenlehre
Prof. Dr. Friedrich Steinle (Berlin):
Goethes Farbenforschung im Kontext ihrer Zeit – Ein neuer Blick
Prof. Dr. Uwe Hentschel (Chemnitz/Berlin): Zu den Umbruchs- und Krisenerfahrungen um 1800
Beate Schubert (Berlin): Der Student Goethe inmitten der Epochen
Prof. Dr. Dirk von Petersdorff (Jena): Goethe im Sturm und Drang
Prof. Dr. Ernst Osterkamp (Berlin): Goethe und das klassische Ideal
Dr. Manfred Osten (Bonn): Zur Aktualität des Goetheschen Verständnisses der Französische Revolution
Dr. Manfred Osten – Prof. Dr. Peter André Alt - Podiumsdiskussion: Goethes und Schillers Konzept zur ästhetischen Erziehung des Menschen
Goethes 272. Geburtstag: Bad Lauchstädt -Geburtstags-Matinée Musik um Goethe: Goethe-Theater: Faust - Der Tragödie erster Teil
Drei Leseanachmittage zum Jahresthema: Leitung: Wolfgang Jorcke (Berlin)
Prof. Dr. Jochen Golz (Weimar): Goethe, Schiller und Friedrich Schlegel an der Schwelle der Moderne
Prof. Dr. Helmut Hühn (Jena): Zeit und Geschichte in Goethes „Wahlverwandtschaften“
Dr. h.c. Friedrich Dieckmann (Berlin): Napoleonisches beim alten Faust
PD Dr. Michael Jäger (Berlin): Die Julirevolution in Paris und der Beginn des Maschinenzeitalters
320
Dr. Manfred Osten (Bonn):
Goethes Opposition gegen alle lebensfeindlichen Tendenzen seiner Zeit
Philipp Restetzki (Görlitz):
Goethes Verhältnis zu Spinoza unter besonderer Berücksichtigung des Faust
Beate Schubert (Berlin):
Der Kriegsminister Goethe in Opposition zu Friedrich des Großen
Prof. Dr. Rainer Holm-Hadulla (Heidelberg):
Goethes unkonventionelle Frauenbeziehungen
Prof. Dr. Uwe Hentschel (Berlin/Chemnitz):
Goethes Kritik an profaner Nützlichkeit und Arbeitsteilung
Prof. Dr. Jochen Golz (Weimar):
Goethes Blicke auf seinen künstlerischen Widersacher Jean Paul
Goethes 273. Geburtstag:
Bedlam-Theater Fülle des Lebens Gedichte - Balladen – Szenensplitter
Dr. Manfred Osten (Bonn):
Goethe - ein Gegner der kranken Lazarettpoesie der Romantiker
Prof. Dr. Uwe Hentschel (Berlin/Chemnitz):
Goethe und die Unterhaltungsliteratur
Prof. Dr. Ernst Osterkamp (Berlin):
Der Sammler Goethe im Spiegel seiner Werke und seiner Zeit
Prof. Dr. Uwe Hentschel:
Goethe - ein Weltbürger in den Zeiten des Nationalismus
Dagmar von Gersdorff (Berlin):
Lesung: Die Schwiegertochter - Ottilie von Goethe
Dr. PD Michael Jäger (Berlin):
Goethe, Faust und der Saint-Simonismus
Dr. Manfred Osten (Bonn):
Zur Aktualität der Umbrüche und Krisen in Goethes Leben und Werk für das 21. Jahrhundert
Beate Schubert (Berlin):
Goethe entdeckt Shakespeare
Prof. Dr Albert Meier (Kiel):
Goethes revolutionäres Dichten im Sturm und Drang
Prof. Dr. Uwe Hentschel (Berlin/Chemnitz):
Goethes „Iphigenie“ – Zeitenwenden in Weimar und auf Tauris
Prof. Dr Jochen Golz (Weimar):
Goethes Lebenskrise nach seiner Rückkehr aus Italien
Besuch des Romantikmuseums in Frankfurt
Prof. Dr. Dieter Borchmeyer (München):
Entstehungsgeschichte von Goethes Götz
Theaterpremiere im Burghof Jagsthausen:
260 Jahre Goethes Götz v. Berlichingen
Dr. Ariane Ludwig:
Goethes Mährchen - eine Reaktion auf die Französische Revolution
Paul Sonderegger:
Lesung zu Goethes 274. Geburtstag
Herz mein Herz , was soll das geben ? Goethe fünf Jugendlieben in Dichtung und Wahrheit
Dr. Monika Estermann (Berlin):
Lesenachmittage zum Jahresthema
Prof. Dr. Georg Schmidt (Jena):
Goethes politisches Wollen und die Zeitenwende
Dr. Friedrich Dieckmann (Berlin):
Goethe in der Zeitenwende/ Von den Schwierigkeiten politischer Dichtung in stürzender Zeit
Prof. Dr. Ernst Osterkamp (Berlin):
Goethes produktiver Widerstand gegen die Zumutungen des Zeitgeistes
Dr. Manfred Osten (Bonn):
Goethes Faust - die versiegelte Tragödie der Zeitenwende
321
Prof. Dr. Uwe Hentschel (Berlin):
Die Leiden des jungen Werthers - ein Drama in fünf Akten
Prof. Dr. Rolf Selbmann (München):
Goethes Sesenheimer Erlebnislyrik in Straßburg
Prof. Dr Gudrun Schulz (Berlin):
Die Suche des jungen Goethe nach seiner dichterischen Identität im Sturm und Drang
Prof. Dr. Helmut Koopmann (Augsburg):
Zur Pathogenese der Leiden des jungen Werther
Dr. Manfred Osten (Bonn):
Goethes Naturverständnis der Sturm- und Drang-Zeit
Zweitägige Exkursion nach Wetzlar zum Jubiläum 250 Jahre Werthers Leiden
Prof. Dr Jochen Golz (Weimar):
Goethes Weg nach Weimar im Spiegel seiner Lyrik
Joachim Berger (Potsdam):
Lesung zu Goethes 275. Geburtstag
Goethes Liebes- und Naturgedichte an Charlotte, Christiane, Marianne, Ulrike
Tagesexkursion nach Jena:
Besuch der Ausstellung Goethes Metamorphosenlehre im Goethe-Laboratorium
Führung durch den Botanischen Garten, Rezitation Cora Chilcott: GOETHE - Natur und Erkenntnis
Dr. Manfred Osten (Bonn):
Goethe als Naturforscher und seine Entdeckung des Betriebsgeheimnisses
Dr. Stefan Bollmann (München):
Vortrag + Lesung: Der Atem der Welt
Dr. Helmut Hühn (Jena):
Goethes Altersgedicht „Urworte. Orphisch“
322
Das Jubiläumsjahr 250 Jahre Goethe beginnen wir
erstmalig mit einem monothematischen Jahrespro-
gramm und einem selbstgestalteten Flyer. Eröffnet
wird die Veranstaltungsreihe mit einem Vortrag von
Maria Erxleben, Bewundert viel und viel geschol-
ten… – Goethes Verhältnis
zu Berlin.
Erst nach Wochen des
Suchens hat sich ihr Text
als Schreibmaschinen-
skript wieder angefunden,
und wir können ihn auf
den nächsten Seiten in
komprimierter Form wie-
dergeben.
Die Referentin räumt
darin auch fachkundig auf
mit dem immer wieder
kolportierten Vorurteil,
Goethe habe Resentiments
gegen die Berliner gehabt
und diese Zeit seines
Lebens für einen verwege-
nen Menschenschlag ge-
halten.
Sie läßt all jene prominenten Berliner Zeitgenossen
Revue passieren – Literaten, Verleger, Architekten,
Künstler, Schauspieler, Musiker, Mediziner und
Naturwissenschaflter –, zu denen Goethe in den
sechs Jahrzehnten von 1774 bis 1832 Kontakt hat
und mit denen er umfangreiche Korrespondenzen
unterhält.
In der anschließender Diskussion wird der Wunsch
geäußert, man möchte doch einen Spaziergang auf
Goethes Spuren durch das alte Berlin unternehmen.
Gesagt getan, Mitte Mai finden sich fast 40 Inte-
ressierte Unter den Linden ein und folgen, Frau
Erxlebens kundigen Erläu-
terungen lauschend, via
Staatsbibliothek, Universi-
tät, Zeughaus, Palais am
Festungsgraben (die ehe-
malige Zelter´sche Sing-
akademie), über die
Museumsinsel hinüber ins
Nikolaiviertel, um schließ-
lich erschöpft und um ei-
nige Erkenntnisse über das
friderizianische Berlin rei-
cher, in der historischen
Weinstube in der Post-
straße zu landen, die Goe-
the – wer weiß – damals
vielleicht auch schon auf-
gesucht hat.
Zwei Tage später nutzen
drei Dutzend Mitglieder
die Gelegenheit, sich die
Stella-Aufführung der
Schaubühne anzusehen und anschließend ein von
Ekkehart Krippendorff vermitteltes Gespräch
mit der Dramaturgin zu führen.
Im Mai findet eine kombinierte Veranstaltung statt:
zunächst eine kundige Führung durch das Käthe-
Kollwitz-Museum durch die Direktorin Gudrun
Fritsch.
1999
Goethe und seine Berliner Beziehungen
Maria Erxleben (Berlin)
Bewundert viel und viel gescholten….
Goethes Verhältnis zu Berlin
Dr. Gudrun Fritsch (Berlin)
Führung durch das Käthe-Kollwitz-Museum
anschließend: Dr. Wolfgang Butzlaff (Kiel)
Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden…
Käthe Kollwitz und Goethe
Hans-Hellmut Allers (Berlin)
Erlaubt ist, was gefällt…
Goethe und das Berliner Theater
Prof. Dr. Ernst Osterkamp (Berlin)
die schönsten Spuren des
fruchtbaren Zusammenseins…
Goethe und Wilhelm von Humboldt
Dr. Helmut Börsch-Suphan (Berlin)
Menschliche Formen zu zeigen,
so schön als möglich…
Goethes Dichtungen
als Inspirationsquelle Berliner Künstler
Dr. Hartmut Schmidt (Lotte-Museum, Wetzlar)
Ein Genie ist ein schlechter Nachbar…
Goethe, Nicolai und die Berliner vor 225 Jahren
Tilmann Buddensieg (Berlin)
Die grenzenlose Marmorthätigkeit der
preußischen Hauptstadt
Schinkel, Rauch und Goethe (Dia-Vortrag)
52
Anschließend läßt uns im benach-
barten Literaturhaus Wolfgang
Butzlaff in seinem Vortrag
Käthe Kollwitz und Goethe an
den Ergebnissen seiner For-
schungen teilhaben. Die Enkelin
der Künstlerin hatte ihm die Tage-
bücher ihrer Großmutter zur Lektüre überlassen und
so erfährt man zum allgemeinen Erstaunen, daß die
Malerin der Not, des Elends und der Unbill der Hun-
gerjahre nach dem Ersten Weltkrieg eine ausgewie-
sene und belesene Goethe-Kennerin war.
Nach der Sommerpause eröffnet die Herbstsaison
unser Mitglied Hans-Hellmut Allers mit seinem
Vortrag Erlaubt ist, was gefällt – Der Dramatiker
Goethe und seine Beziehungen zum Berliner Thea-
ter. Seine ungemein spannende, viel bislang unbe-
kannte Details aufweisende Recherche, kann hier
aus Platzgründen auch nicht ansatzweise wiederge-
geben werden, liegt jedoch als 140 Seiten umfas-
sende Publikation vor; zwei Dutzend Exemplare
sind noch vorhanden und können über die Berliner
Geschäftsstelle zum Preis von 10 € bezogen werden.
Anläßlich der 250. Wiederkehr von Goethes
Geburtstag widmen wir uns ja in diesem Jahr vor
allem der Frage, welche Haltung der mittlerweile
überzeugte Weimarer Goethe zur preußischen
Hauptstadt einnahm. Zu welchen Künstlern, Wissen-
schaftlern und sonstigen Zeitgenossen hatte er Kon-
takt, entweder durch lebhafte Korrespondenzen oder
durch mündlichen Gedankenaustausch in Weimar
oder an einem dritten Ort?
In seinem Vortrag Die schönsten
Spuren des fruchtbaren Zusa-
menseins weist Ernst Oster-
kamp darauf hin, daß die
Zustände Berlins und Weimars
erstaunlicherweise kaum einen
Niederschlag im Briefwechsel
mit Wilhelm von Humboldt finden.
Immerhin gilt dieser als Repräsentant des gültigen
künstlerischen Geschmacks in Berlin und nimmt in
seiner Funktion als Staatsrat für Unterricht und Kul-
tus, als Vorsitzender des Vereins der Kunstfreunde
sowie als Leiter der Kommission zur Einrichtung
des ersten preußischen Kunstmuseums großen Ein-
fluß im Sinne Goethes auf die Kultur und Wissen-
schaftsmetropole.
Wie uns Helmut Börsch-Suphan anschaulich er-
läutert, steht am Anfang der Beziehung zwischen
Goethe und den Berlinern Künstlern die Illustration.
1775 stach Daniel Berger Zeichnungen Chodowie-
ckis zu Goethes Schriften, zu Erwin und Elmire,
Clavigo, doch insbesondere zu den Leiden des jun-
gen Werther. Es sind Bilder, die im Fluß der Hand-
lung einzelne geeignete Momente herausheben.
Gottfried Eberle (Berlin)
Poesie, Harmonie und Gesang…
Goethe Interesse an Zelters Singakademie
(mit Musikbeispielen)
Prof. Dr. Norbert Miller (Berlin)
Schnappe nur jedes Wort auf, alles will ich
von ihm wissen
Goethe im Hause Mendelssohn
Prof. Dr. Hartmut Böhme, Jan-Lüder Röhrs,
Prof. Ferdinand Dammerschun
Alles der Natur angehörige kam zur Sprache
Goethe und Alexander von Humboldt
53
Auf der höheren Ebene einer durchdringenden
Zusammenfassung des Geschehens stehen die bei-
den von Chodowiecki selbst tradierten Blätter zur
französischen Übersetzung des Werther, weil sie
Leben und Tod, Anfang und Ende des Romans in der
ganzen Spannung des Geschehens bezeichnen.
Der so beliebten Szene der ersten Begegnung Wer-
thers mit der von sechs Kindern umringten Lotte,
steht das von einer unerbittlichen Geometrie ge-
prägte Sterbezimmer mit der Silhouette Lottes ge-
genüber. Es gibt bei Chodowiecki weniges von
dieser Größe bei kleinem Format.
Eines der am beliebtesten Motive neben den Illu-
strationen zu Goethes Faust war der Erlkönig. Von
diesem Gedicht existieren bis in die Gegenwart un-
zählige Darstellungen; als bekannteste Darstellung
kann wohl das zu Goethes Lebzeiten entstandene
Gemälde von Moritz von Schwind gelten, von dem
unzählige Kopien hergestellt wurden. Auch der
Faust I bot eine Fülle von dankbar aufgegriffenen
Motiven, namentlich solche mit historisierendem
genrehaftem Charakter. Weitgehend unbekannt ist
die von Karl-Friedrich Schinkel 1834 geschaffene
Gouache mit dem Titel Die Nacht zieht über den
Golf von Neapel, zu der er sich von Goethes Faust
II inspirieren ließ.
In einem ebenso launigen wie faktenreichen Vor-
trag erläutert uns Hartmut Schmidt, der Leiter des
Lotte-Museums in Wetzlar das gespannte Verhält-
nis zwischen Goethe und dem Berliner Verleger
Friedrich Nicolai, dem damaligen tonangebenden
Verfechter der Berliner Aufklärung. Dieser macht
sich bekanntlich lustig über den Werther-Kult und
verfaßt 1775 eine Parodie auf Goethes Die Leiden
des jungen Werther: Die Freuden des jungen Wer-
ther, in der dieser am Leben bleibt (die Pistole war
von Albert nur mit Hühnerblut geladen worden)
und schließlich Lotte heiratet. Ende gut, alles gut –
wie langweilig.
Die Reaktionen auf Nico-
lais Parodie sind höchst
unterschiedlich. Viele, be-
sonders aus den Reihen der
Aufklärer, loben diese Ver-
sion, während die Stürmer
und Dränger überwiegend
die beißend satirische Dar-
stellung der Protagonisten,
die eine deutliche Anspie-
lung auf das Genre sind, kritisieren.
Die wohl heftigste Reaktion kommt jedoch vom
Verfasser des Originals. Als einer der bissigsten
Kommentare Goethes zu Werthers Freuden gilt
sein Gedicht Nicolai auf Werthers Grab, erschienen
etwa 1775:
Ein junger Mensch ich weiß nicht wie,
Starb einst an der Hypochondrie
Und ward dann auch begraben.
Da kam ein schöner Geist herbei
Der hatte seinen Stuhlgang frei,
Wie ihn so Leute haben.
Der setzt sich nieder auf das Grab,
Und legt ein reinlich Häuflein ab,
Schaut mit Behagen seinen Dreck,
Geht wohl erathmend wieder weg,
Und spricht zu sich bedächtiglich:
„Der arme Mensch, er dauert mich
Wie hat er sich verdorben!
Hätt’ er geschissen so wie ich,
Er wäre nicht gestorben!“
Aufs äußerste verärgert über diese Verunglimpfung
seines Romans, beginnt Goethe einen aufs heftigste
geführten literarischen Feldzug gegen Nicolai, der
Zeit seines Lebens anhalten wird. Neben einzelnen
Streitgedichten verfaßt er weitere schriftliche zum
Teil sehr offensichtliche Angriffe, etwa in den Xe-
nien und 'widmet' Nicolai sogar einen kleinen Auf-
tritt in seinem Faust II als Proktophantasmist, eine
Anspielung darauf, dass Nicolai an Phantasmen litt.
Am 16. Juli schreibt Goethe an Sulpiz Boisserée:
Insofern es mir ziemt, ein Wort mitzusprechen, (...)
thu ich folgenden, doch ganz unmaßgeblichen Vor-
schlag: Rauch in Berlin genießt eines verdienten
Ruhms (…) er könnte mich in den nächsten Mona-
ten besuchen, sein Modell mit fortnehmen und, bey
der gränzenlosen Marmorthätigkeit, die jetzt in
Berlin herrscht, würde die Büste bald fertig seyn;
setzt man sich von Frankfurt aus in Bezug mit ihm,
so erbiete ich mich, ihn auf's freundlichste im Laufe
dieser Monate zu empfangen.
Tilmann Buddensieg entführt uns ins Jahr 1820 in
die Woche vom 18.-20. August, in der die beiden
Berliner Bildhauer Christian Daniel Rauch und
Christian Friedrich Tieck gleichzeitig (a tempo)
54
ihre Bildnisse des einundsiebzigjährigen Goethe in
dessen Jenaer Gartenwohnung modellieren. Wäh-
rend der dreitägigen Modellierarbeit unterrichten
die beiden Bildhauer Goethe über den Fortgang der
Bauarbeiten am Neuen Berliner Schauspielhaus
nach Plänen Schinkels, dessen Vorgängerbau im
Jahre 1817 abgebrannt war.
Im Unterschied zur Büste Tiecks, die zunächst in
Vergessenheit gerät, erfreut sich die Büste Rauchs
bald lebhaften Interesses und großer Wertschät-
zung. Auch Goethe selbst ist von der Arbeit Rauchs
sehr angetan. Mit Rauchs Büste bin ich sehr zufrie-
den (...) Die Behandlung der Büste ist wirklich
grandios und wird sich daher in jeder Größe statt-
lich ausnehmen.
Heute noch gilt die Büste Rauchs aufgrund ihrer
Lebensnähe als Inbegriff des
späten Goethe.
(Siehe hierzu aus Maria Erxlebens Vor-
trag: Goethe und seine Berliner Beziehun-
gen auf den folgenden Seiten)
Einen weiteren Höhepunkt bil-
det die Veranstaltung im Haus von Gottfried
Eberle im Westend: Poesie, Harmonie und Gesang
– Goethes Interesse an Zelters Singakademie mit
Gesangseinlagen der Sopranistin Regine Geb-
hardt.
Sowie Zelter sich auf Flügeln des Gesangs mit einem
Sprung über Ziegelsteine und Mauern hinweg vom
Feld seines Handwerks in das Feld der Kunst begibt,
so soll auch dieses geflügelte Pferd über die Felder
springen und dabei genau in der Schwebe, im Sprung
über die Grenze, gleichsam zwi-
schen beiden Feldern festge-
halten sein. Derart gehört es
dem Bereich der Kunst und
dem Bereich des Handwerks
gleichermaßen an. Der im
Wappen abgebildete Zelter als
Pferd ist zugleich ein Pega-
sus, auf dem der Dichter aus
Weimar im Geiste sich reiten sieht. Versteckt erinnert
Goethe so daran, daß nicht wenige seiner Gedichte
für den Freund und die geselligen Berliner Anlässe in
der Singakademie entstanden.
Auszug aus: Der Singemeister Carl Friedrich Zelter,
hg. von Christian Filips
Mehrheitlich hieß es, man habe sich gefühlt wie in
einem Berliner Salon und ob sich etwas in dieser
Form nicht öfter machen ließe. Ich gebe diese An-
regung hier weiter an Mitglieder, die über die ge-
eigneten Räumlichkeiten verfügen und bereit
wären, die Goethe-Gesellschaft einmal für eine Ver-
anstaltung zu beherbergen; öffentliche Säle mit
einem Flügel sind in Berlin unbezahlbar.
Ein Selbstläufer ist schließlich
der Vortrag von Norbert Mil-
ler über Goethe und Felix
Mendelssohn Bartholdy.
Daß dieses Wunderkind,
»der neue Mozart«, zu den
Schülern seines Duzfreun-
des Zelter zählte, ist ein
Glücksumstand , der Goe-
the wohl bewußt war. Vier-
zehnmal kommt Zelter nach
Weimar. Vergeblich versucht er,
Goethe wenigstens einmal zu einem Besuch von
Berlin zu bewegen, das doch im Hinblick auf
Musik und Musiktheater so viel mehr zu bieten
hatte.
Die Gewinner dieser von Miller genau analysierten
Abstinenz sind wir Nachgeborenen. Denn die in der
Provinz-Residenz doch stets mit Spannung erwar-
teten Neuigkeiten aus der Hauptstadt haben zum fa-
cettenreichen Kolorit einer der wichtigsten
Goethe-Korrespondenzen beigetragen.
Zum Jahresende wagten wir uns dann zum ersten
Mal an eine Podiumsdiskussion: Unser neugeba-
ckenes Vorstandsmitglied Jan-Lüder Röhrs fragte
die beiden Berliner Naturwissenschaftler Hartmut
Böhme und Ferdinand Dammerschun über
Goethes besonderes Verhältnis zu Alexander von
Humboldt aus.
Zelters Wappen,
Entwurf Goethes, 1831
55
Maria Erxleben
Goethes Beziehungen zu Berlin
Bewundert viel und viel gescholten – Es sei mir ge-
stattet, diesen Vers, der den Helena-Akt des Faust
II eröffnet, zu zitieren und zur Charakterisierung
von Goethes Urteil über Berlin zu benutzen, drückt
er doch in einmaliger Weise die Widersprüchlich-
keit aus, in der sich Zustimmung und Ablehnung
gleicherweise finden. Goethes Verhältnis zu Berlin
sei, eine geistige Mitbürgerschaft (...), welche über
Zeit und Ort hinaus ein gegenseitiges Glück beför-
dert.
(Brief an Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen
vom 15. März 1826.)
Es gibt bedeutende Veranlassung, sich wieder ein-
mal mit Goethes Verhältnis zu unserer Stadt zu be-
fassen und zu versuchen, einen – wenn auch nur
partiellen und notwendigerweise eingeschränkten
– Überblick über die vielfältigen menschlichen und
kulturellen Wechselbeziehungen zu bieten, die sich
zwischen ihm und der sich seit Friedrich des Gro-
ßen Regierung in ungeheuren Tempo entwickeln-
den Metropole im nordöstlichen Deutschland
ergeben haben.
Äußerungen Goethes über Berlin, die große
Königsstadt, die lebendige, getümmelreiche, le-
benslustige, verführerische, ungeheuer weite und
bewegte, die immer wieder mit den berühmt-be-
rüchtigten biblischen Großstädten Babylon, Ninive,
Sodom und Gomorrha gleichgesetzt wurde, solche
Äußerungen, bewundernd, absprechend oder iro-
nisch gebrochen, finden sich in großer Zahl in Goe-
thes Briefen und Gesprächen, später auch in
Aufsätzen und Rezensionen.
Wer kennt nicht die pointierten Aussagen, die
immer wieder belegen sollen, daß Goethe mit un-
serer Stadt nichts im Sinn gehabt habe? Ich meine
die Zeilen des ganz jungen Leipziger Studenten im
Brief vom 1766 an die Schwester Cornelia: Ich
glaube, es ist jetzt in Europa kein so gottloser Ort
als die Residenz des Königs in Preußen oder den
von Eckermann Jahrzehnte später überlieferten Satz
aus einem Gespräch vom 4. Dezember 1823: In
Berlin ist ein so verwegener Menschenschlag bei-
sammen, daß man mit Delikatesse nicht weit reicht,
sondern daß man Haare auf den Zähnen haben und
mitunter etwas grob sein muss, um sich über Was-
ser zu halten.
Viel bedeutsamer für unser Thema als solche Einzel-
aussagen Goethes über Berlin und die Berliner sind
die aus seinem Schaffen erwachsenen und auf sein
Schaffen zurückwirkenden, durch ein Empfangen
und Geben fruchtbaren Wechselbeziehungen mit
hervorragenden Bürgern und angesehenen Institutio-
nen der Stadt, die sich auf der Basis gleichartiger
sachlicher Interessen und enger persönlicher Kon-
takte – meist beidem – entwickelten und die jeweils
zugleich ein Stück Kulturgeschichte reflektieren.
Seit etwa 1790, nachdem die Aus-
einandersetzung mit der Berli-
ner Aufklärung und besonders
mit Friedrich Nicolai und des-
sen Werther-Persiflage sowie
die eigenen Reiseeindrücke von
1778 erst einmal Vergangenheit für
Goethe geworden waren, läßt sich ein immer reger
werdendes Interesse seinerseits an den historischen
und kulturellen Fortschritten, an den künstleri-
schen, wissenschaftlichen und technischen Vorha-
ben im aufstrebenden Berlin beobachten. Diese
Teilnahme, die nach der Italienreise Goethes ein-
setzt, wird ganz sicher durch die monatelange Ge-
meinschaft mit Karl Philipp Moritz in Rom
geweckt.
Dieser junge, doch schon
anerkannte Reiseschrift-
steller, Verfasser des
Romans Anton Reiser,
Philologe und Archäo-
loge wird Goethes
Freund und Vertrauter,
und er profitiert dabei selbst
von dessen umfangreichen Altertums- und Sprach-
kenntnissen.
Man darf wohl annehmen, daß in den langen Ge-
sprächen, die Goethe in seiner Eigenschaft als
Krankenpfleger, Beichtvater, Vertrauter und gehei-
mer Sekretär – so von Goethe in der Italienischen
Reise im Januar 1787 beschrieben – mit dem Kran-
ken (er hatte sich beim Sturz vom Pferd den Arm
gebrochen) führte, daß in diesen Gesprächen auch
die Rede von Berlin gewesen sein wird.
56
Dort in Rom, der südlichen Haupt- und Weltstadt,
dürfte Goethe von Moritz eine freundliche Korrek-
tur seines Eindrucks von Berlin, den er während
seines fünftägigen Besuchs im Mai 1778 gewonnen
hatte, erfahren haben. Dazu dürfte sicher auch die
poetische Beschreibung der großen Stadt in
Moritzens Gedicht Sonnenaufgang über Berlin auf
dem Tempelhofer Berge vom 10. August 1780 bei-
getragen haben:
Des blau gewölbten Tages Glanz wird stärker,
und majestätisch steigt Berlin empor.
Die Sonne, die den Gold umsäumten Fächer
Des Morgenrot entfaltet hat,
Vergüldet nun mit ihrem Strahl die Dächer
Und grüßt mit Lächeln unsere Königsstadt…
Mit seiner Häuser und Paläste Menge
Hat es die ganze Flur bedeckt.
Dort dient es sich in ungeheurer Länge
Und hat die beiden Arme ausgestreckt,
Von da, wo seiner Dächer helles Schimmern
Sich in des Waldes Grün verliert,
Bis an die Wiesen, deren sanftes Flimmern
Im Sonnenglanz die Morgenseite ziert…
Nun strömt das Lichtt herab wie Flammenbäche
Und alle Gipfel sind besonnt.
Unüberschaubar ist die weite Fläche
Der Stadt und reicht bis an den Horizont.
Moritz selbst verehrt Goethe unendlich. Als Theo-
retiker des sogenannten Kunstschönen und zum
Professor der Ästhetik und Altertumskunde an der
Akademie der Wissenschaften zu Berlin ernannt,
verbreitet Moritz in seinen Vorlesungen in den
Räumen der Akademie – die Universität war ja
noch nicht gegründet –, die von allen bedeutenden
und einflußreichen Leuten, auch von Ministern und
Angehörigen des Hofes sowie einem Kreis gebil-
deter Damen besucht werden, Goethes Ruhm in
Berlin.
Er exemplifiziert an Goethe und an seinem dichte-
rischen Gestaltungsvermögen, seiner ihm von der
Natur verliehenen Bildungskraft, die sich in allen
seinen Werken manifestiere, seine eigene Kunst-
theorie. Damit löst Moritz eine Art Initialzündung,
ein prägendes Bildungserlebnis in den
Köpfen und auch Herzen seiner
Hörer und vor allen Dingen Höre-
rinnen aus, die, wie er selber, au-
ßerdem fast alle im seit 1780
bestehenden kultivierten Salon der
Henriette Herz verkehren.
In diesem unterhält man
sich, wie später auch in den
anderen berühmten Berliner
Salons – etwa dem der Rahel
Levin, über die neuesten Er-
scheinungen auf dem Gebiet
der Literatur.
Im Salon Herz, in dem Geist und Gefühl, nicht Her-
kunft und Stand den Ausschlag geben, beginnt man
nun sehr einfühlsam, Goethes Dichtungen in neuem
Lichte zu sehen, sucht und findet Besonderes an
ihnen und findet damit auch gleichzeitig zu einem
neueren besseren Verständnis des Dichters, was
gewiß auch manchmal zu einer schwärmerisch
übertriebenen Verehrung seiner Person führt.
Auch nach Moritz’ frühem Tod 1793 werden die
freundschaftlichen Gefühle und Verbindungen, die
sich zwischen den tonangebenden Männern und
Frauen der Berliner Gesellschaft zu Goethe herge-
stellt haben, von diesen weitergetragen und bei
Begegnungen und in Korrespondenzen vertieft.
Zum Kreise der Verehrer zählen auch die jungen
Dichter der Romantik, die in diesen Jahren in
Berlin wirken, etwa Ludwig Tieck, die Gebrüder
Schlegel, de la Motte Fouqué und Zacharias
Werner, die sich Goethe und seiner Dichtung ver-
bunden fühlen.
Besonders ist auch der in Berlin geborene Achim
von Arnim zu nennen, der hier in Berlin zusammen
mit Clemens Brentano 1804 die Liedersammlung
Des Knaben Wunderhorn plant, die dann 1805 in
Heidelberg ausgeführt und Goethe gewidmet wird.
Programmatisch für das geistig kulturelle Berlin
stehen ferner Namen wie Wilhelm von Humboldt,
Carl-Friedrich Zelter, August Wilhelm Iffland,
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Friedrich
Schinkel, Christian Daniel Rauch, Christoph Wil-
helm Hufeland und Wilhelm Beuth zu nennen, auf
die hier nicht im Einzelnen eingegangen werden
kann.
Stellvertretend mögen sie für alle stehen, durch die
Goethe mit der Literatur und Musik, mit der dar-
stellenden, bildenden und der Baukunst sowie den
Geistes- und Naturwissenschaften einschließlich
der Ökonomie, Technik und Politik sowie mit allen
entsprechenden Institutionen in Berlin verbunden
ist.
Diese Verbindungen erweitern Goethes Gesichts-
feld, bilden mit das universale Hintergrundwissen,
57
aus dem Ideen und Fakten, oft schöpferisch adap-
tiert und reproduziert, Eingang in sein dichterisches
Werk sowie in seine kunsttheoretischen und natur-
wissenschaftlichen Arbeiten finden. Aber auch die
Berliner Bekannten und Freunde fühlen sich ihrer-
seits in ihren Bestrebungen durch Goethe angeregt
und bestätigt.
In Berlin findet Goethe die Anerkennung und Ver-
ehrung weitreichender Kreise durch alle sozialen
Schichten hindurch, nicht zuletzt durch Zelters po-
puläre Gedichtvertonungen. Von hier wird der
klassische Goethe und sein Werk weitestgehend be-
kannt gemacht, wird er doch auf den Gebieten von
Kunst und Wissenschaft Autorität und Vorbild.
Im Folgenden sei nun auf einige Einzelheiten von
Goethes Begegnung mit und sein Verhältnis zu Ber-
lin eingegangen. Zunächst einmal ist festzuhalten:
Berlin hat in Goethes Leben einen anderen Stellen-
und Erlebniswert als andere Orte, in denen er ge-
wesen ist oder wohin er briefliche Kontakte unter-
hielt. Nach Berlin verzehrt ihn nicht eine
schmerzhafte Sehnsucht wie nach Rom, hierher
locken ihn nicht die freundlichen Jugenderinnerun-
gen und die Milde des Spätsommerlichts wie nach
den Städten der Rhein-Main-Gegenden. Es zieht
ihn auch nicht eine heiter gesellige Atmosphäre
hierher wie in die böhmischen Bäder; nein, die Be-
ziehungen zu Berlin sind von Anfang an nüchterner,
sachlicher, nicht durch eine arkadische Traum-
vorstellung verklärt.
Doch ist sein Verhältnis zu der Stadt zugleich
gemischt aus Neugierde, Furcht und Bewunderung,
weniger voll innerer Wärme. Die Stadt gibt seinem
Geist Nahrung, weniger seinem Gemüt, flößt
Respekt ein, aber keine liebenden Gefühle. Dazu
ist sie ihm zu groß, grenzenlos im Umfang wie im
Wollen und Hervorbringen.
Die große Vielfalt und Rastlosigkeit in der sich
verändernden ökonomischen und sozialen Struktur,
die Beschleunigung aller lebendigen und techni-
schen Prozesse als Ausdruck der rasanten Entwick-
lung der Produktivkräfte, reißt alle und alles mit
sich und macht das Lebensgefühl und die Lebens-
weise der Berliner so dynamisch im Positiven wie
auch Negativen.
In welchem Licht erscheint nun Berlin dem jungen
Goethe? Als er das erste und auch einzige Mal in
die Stadt kommt, ist er 28 Jahre alt, der Sieben-
jährige Krieg erst 15 Jahre vorüber und die preußi-
schen Truppen bereits in ein neues Kriegsabenteuer
verwickelt, den bayerischen Erbfolgekrieg.
Vom 15.-20. Mai 1778 begleitet er den inkognito
als Graf von Ahlefeldt reisenden Herzog Carl
August und den Fürsten Leopold Franz III. von An-
halt-Dessau, die hier in Berlin die politische Lage
sondieren wollen. Friedrich der Große ist zu diesem
Zeitpunkt gar nicht anwesend, sondern bei seinen
Truppen.
Vielleicht hat man gerade deshalb diese Tage
gewählt, denn man macht sehr bald Besuch beim
Prinzen Heinrich, von dem man weiß, daß er in
Opposition zu seinem königlichen Bruder steht und
mit verschiedenen Generälen eine Fronde bildet,
die gegen eine Teilnahme an diesem Krieg sind. Die
sächsischen Fürsten wären bei einer erneuten krie-
gerischen Auseinandersetzung zwischen Preußen
und Österreich von einem Durchmarsch der preu-
ßischen Armee durch ihr Land die wieder am
stärksten Betroffenen.
Also schon der Anlaß für diese Berlinreise ist für
Goethe ein höchst
unerfreulicher; drin-
gende Zurückhaltung
und Diskretion im Um-
gang mit Zivilpersonen
und Militärs zur Wah-
rung von Carl Augusts
Inkognito sind ihm an-
geraten. Außerdem ist
ihm auch das literari-
sche Berlin mit seiner
propagierten Aufklärung, aus der heraus auch Nico-
lais Werther-Persiflage entstanden ist, nicht gerade
sympathisch. Es ist noch nicht lange her, da hat
Goethe in diesem Zusammenhang die Verse ge-
schrieben: Was schert mich der Berliner Bann, Ge-
schmäckler-Pfaffenwesen, und wer mich nicht
verstehen kann, der lerne besser lesen!
58
Zeit seines Lebens fühlt er sich in gewissen
Berliner Literaturkreisen als Geächteter, erst bei
den Aufklärern, sehr viel später dann, fast am Ende
seines Lebens, bei den streng orthodoxen Kreisen
und viele seiner wenig freundlichen Urteile über die
Berliner beziehen sich nur auf diese Personengrup-
pen.
Doch wieder zurück zum Mai des Jahres 1778. Aus
Potsdam kommend fährt Goethe am 16.Mai nach-
mittags um 4 Uhr nach Berlin hinein. Vermutlich
wohnt er Unter den Linden 23 im Hotel de Russie,
das später den Namen Zur goldenen Sonne erhält.
Goethes Berliner Tagebuch bietet nur äußerst lako-
nische Eintragungen und stichwortartig einige
Namen und Bezeichnungen, aus denen seine
Besichtigungen und Besucher
werden müssen. Man ersieht
aus den kurzen Notizen, daß er
im Stadtzentrum war, in der
Nikolaikirche, wo er einer
Predigt des Aufklärers und
Berliner Propstes Johann Joa-
chim Spalding beiwohnt. Ferner
besucht er die Spandauer Straße, besichtigt das
Schloß, den alten Dom und das Zeughaus, spaziert
durch die Friedrichstraße und stattet auch der
Königlichen Porzellan-Manufaktur am Ende der
Leipziger Straße einen Besuch ab.
Die damals doch recht neuen Prachtgebäude Unter
den Linden wie die Oper, die zwischen 1775 und
1780 entstehende Bibliothek, d.h. die Kommode,
das 1766 erbaute Palais Prinz Heinrich, heute
Humboldt-Universität, sowie die von Friedrich dem
Großen selbst als Entwurf skizzierte Hedwigs-
Kathedrale hat er zwar gesehen, äußert aber keine
Eindrücke, sondern notiert nur die Namen.
Zweimal ist Goethe bei
dem von ihm verehrten
Kupferstecher Daniel
Chodowiecki zu Besuch,
dessen kleinformatige
Buchillustrationen er
Zeit seines Lebens be-
wundert. Das Titelbild
zu Nicolais Anti-Werther
Die Freuden des jungen
Werthers, die Umar-
mung Lottes durch Wer-
ther darstellend, hat er
sich sogar ausgeschnit-
ten und, wie er später in Dichtung und Wahrheit be-
schreibt, »unter seine liebsten Kupfer gelegt.«
Erwähnt wird ein Spaziergang im Tiergarten. Fer-
ner besucht er den Archivar der Akademie der Wis-
senschaften, Wegelin, und die deutsche Sappho, die
Dichterin Anna Louise Karsch.
Die Karschin und ihre Tochter
geben ausführliche Berichte über
Goethes Besuch in ihrem Hause,
die aber sicherlich recht dichte-
risch ausgeschmückt sind. Offen-
bar erfreulich für Goethe sind das
Wiedersehen mit dem aus den Lili-
Tagen in Offenbach bekannten Musiker
und Komponisten Johann André, der 1775 Erwin
und Elmire vertont hat und nunmehr Musikdirektor
der Döbbelinschen Schauspielertruppe in Berlin ist.
Gleich am Abend des Ankunftstages sieht Goethe
die Aufführung Die Nebenbuhler.
Genauso karg wie zu Berlin sind die Tagebuchan-
gaben über die Tage in Potsdam auf der Hin- und
Rückfahrt, die auch nur aus einigen, oft noch in Ab-
kürzung geschriebenen, Wortbrocken bestehen.
Geradezu erschütternd ist jedoch das wiedergege-
ben, was Goethe in Berlin eigentlich bewegt und
dann auch wohl für mehr als 50 Jahre wie ein
Trauma seine Einstellung zur preußischen Königs-
stadt immer wieder unterschwellig beeinflußt haben
mag, wie in seinen Reisebriefen an Charlotte von
Stein und in einem Bericht an den Freund Johann
Heinrich Merck, den hochgebildeten einstigen He-
rausgeber der Frankfurter Gelehrten Anzeigen und
derzeitigen Kriegsrat in Darmstadt.
Auch in Berlin hat Goethe, der Augenmensch, auf-
merksam umhergeschaut, aber er hat geschwiegen
– geschwiegen im Tagebuch, an der Tafel, in adliger
Gesellschaft und in bürgerlichen Häusern. Man hat
ihm das – fremde Tagebücher und Briefe bezeugen
es mehrfach – als Stolz und Hochmut, aber auch als
59
Unwissenheit und Ungeschicklichkeit ausgelegt.
Aber in den vertrauten Briefen sprach er!
Im Bericht an Charlotte von Stein heißt es:
Berlin. Sonntag d. 17. Abends. Durch die Stadt und
mancherley Menschen Gewerb und Wesen hab ich
mich durchgetrieben. Von den Gegenständen selbst
mündlig mehr. Gleichmut und Reinheit erhalten mir
die Götter aufs schönste, aber dagegen welckt die
Blüte des Vertrauens der Offenheit, der hingeben-
den Liebe täglich mehr. Sonst war meine Seele wie
eine Stadt mit geringen Mauern, die hinter sich eine
Citadelle auf dem Berge hat. Das Schloss bewacht
ich, und die Stadt lies ich in Frieden und Krieg
wehrlos, nun fang ich auch an die zu befestigen,
wärs nur indess gegen die leichten Truppen.
Es ist ein schön Gefühl an der Quelle des Kriegs
zu sizzen in dem Augenblick da sie überzusprudeln
droht. Und die Pracht der Königstadt, und Leben
und Ordnung und Überfluss, das nicht wäre ohne
die tausend und tausend Menschen bereit für sie ge-
opfert zu werden. Menschen Pferde, Wagen, Ge-
schütz, Zurüstungen, es wimmelt von allem. (...)
Wenn ich nur gut erzählen kan von dem grosen
Uhrwerck, das sich vor einem treibt, von der Bewe-
gung der Puppen kan man auf die alte Walze FR,
gezeichnet mit tausend Stiften, schliessen, die diese
Melodien eine nach der andern hervorbringt.
Berlin d. 19. Wenn ich nur könnte bey meiner Rück-
kunft Ihnen alles erzählen wenn ich nur dürfte. Aber
ach, die eisernen Reifen mit denen mein Herz ein-
gefasst wird ,treiben sich täglich fester an, daß end-
lich gar nichts mehr durchrinnen wird. (…) So viel
kann ich sagen, ie grösser die Welt, desto garstiger
wird die Farce und ich schwöre, keine Zote und
Eseley der Hanswurstiaden ist so eckelhafft als das
Wesen der Grossen Mittlern und Kleinen durchei-
nander. Ich habe die Götter gebeten dass sie mir
meinen Muth und grad seyn erhalten wollen biss
ans Ende, und lieber mögen das Ende vorrücken
als mich den lezten Theil des Ziels lausig hinkrie-
chen lassen. Aber den Werth, den wieder dieses
Abenteuer für mich für uns alle hat, nenn ich nicht
mit Nahmen.
Im Brief an Merck lesen wir am 5.August:
… in Berlin war ich im Frühjahr; ein ganz ander
Schauspiel! Wir waren wenige Tage da, und ich
guckte nur drein wie das Kind in Schön-Raritäten-
Kasten. Aber Du weißt, wie ich im Anschaun lebe;
es sind mir tausend Lichter aufgegangen. Und
dem alten Fritz bin ich recht nah worden, da ich
hab sein Wesen gesehn, sein Gold, Silber, Marmor,
Affen, Papageien und zerrissene Vorhänge, und hab
über den großen Menschen seine eignen Lumpen-
hunde räsonniren hören. Einen großen Theil von
Prinz Heinrichs Armee, den wir passirt sind, Ma-
noeuvres und die Gestalten der Generale, die ich
hab halb dutzendweis bei Tisch gegenüber gehabt,
machen mich auch bei dem jetzigen Kriege gegen-
wärtiger. Mit Menschen hab ich sonst gar Nichts zu
verkehren gehabt und hab in preußischen Staaten
kein laut Wort hervorgebracht, das sie nicht könn-
ten drucken lassen. Dafür ich gelegentlich als stolz
ausgeschrieen bin.
Soweit Goethes Eindrücke und Erlebnisse bei dem
einzigen Berlin-Besuch seines Lebens. In den Jah-
ren danach tritt Berlin für ihn erst einmal zurück bis
zum Ende seiner Italienreise, erst die 90-er Jahre
des 18. Jahrhunderts beginnen den Wandel in
seinen Beziehungen zu Berlin herbeizuführen.
Zwar hat es 1795 noch eine Kontroverse gegeben,
als der zur Aufklärer-Fraktion um Friedrich Nicolai
zählende Daniel Jenisch im Berlinischen Archiv der
Zeit und des Geschmacks den Vorwurf erhebt, daß
es in Deutschland an klassischen Nationalautoren
mangele. Goethe hat das in seinem berühmten Auf-
satz Literarischer Sansculottismus zurückgewiesen
und dabei auch den heute selbstverständlichen
Gedanken der Verbindung der vergangenen Kultur-
leistung mit den Bestrebungen der Gegenwart
innerhalb der eigenen historischen Epoche aus-
gesprochen.
Und auch, als 1796 die Xenien in Berlin wie auch
anderswo große Aufregung bei den Betroffenen,
aber auch geheime Zustimmung bei den Goethe-
Verehrern finden, wird das sich aufbauende Verhält-
nis nicht mehr ernstlich gestört.
Goethe hat sich zur Abrundung seines Weltbildes
und der Verfestigung seiner theoretischen Überle-
gungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse in
Berlin Gleichgesinnte gesucht, gleich strebende
60
und vorzügliche, Belehrung gebende Sachkenner,
und sie auf fast allen Gebieten gefunden. Er lernt
Berlin als die Stadt anerkennen, wo, wie er an
Beuth im Februar 1832 schreibt: Wissenschaft,
Künste, Geschmack und Technik vollkommen ein-
heimisch in lebendiger Tätigkeit sind.
Auf Vorschlag des Archäologen
Aloys Hirt wird Goethe 1806
zum Ehrenmitglied der Aka-
demie der Wissenschaften er-
nannt in der richtigen
Einschätzung, daß er durch
seine den Klassizismus in
Deutschland fördernden Bestrebun-
gen, mit seinen aus tiefer Antike-Kenntnis erwach-
senden theoretischen Aufsätzen und literarischen
Kunstwerken auch wissenschaftliche Anerkennung
verdiene.
Nun einige weitere Bereiche, in denen Goethes
Einbindung in das kulturelle Leben Berlins sichtbar
wird: Eine hervorragende Rolle spielt dabei das
Theater. Der im Entstehen begriffenen deutschen
Bühne kommt eine der bedeutendsten Vermittler-
rolle zwischen dem Autor, dem Sprachkunstwerk
und dem Publikum zu. Weiter gefördert wird beim
Publikum das Verständnis des Bühnenwerks wie
auch die Bekanntschaft mit der Person des Autors
durch Kritiken und Besprechungen in den großen
Berliner Tageszeitungen, besonders der Spener-
schen und der Vossischen.
Es sei jedoch gleich gesagt, daß Goethes Stücke
keinen besonders großen Raum im Spielplan des
Berliner Theaters einnehmen. Die Autorenhonorare
für die Zeit von 1790 bis 1810 belegen das für Ber-
lin. Sie betragen für Goethe 200, Schiller 1100, für
Iffland 2700 und für Kotzebue 4000 Taler! Das liegt
daran, daß man von Seiten des großen Publikums
den klassischen Aufführungen vielfach Langeweile
vorwirft.
Die Natürliche Tochter erregt 1803 sogar einen
Theaterskandal, ausgelöst von dem Bildhauer
Gottfried Schadow, wie man in Berlin munkelt. Die
Aufführung wurde ausgepocht, also das, was heute
durch Pfeifen und Ausbuhen geschieht.
Anders klingen natürlich die Berichte der Goethe-
Verehrer aus dem an Bildung und Einfluß tonange-
benden Teil des Publikums, die auch auf die
Geschmacks- und Urteilsbildung ihrer Mitbürger
Einfluß nehmen wollen.
Rahel Levin berichtet z.B. ihrem zukünftigen
Gatten Varnhagen von der Tasso-Aufführung 1811:
Meine Wonne! Es mußten 800 Menschen Götter-
worte hören und die Seele einnehmen... Goethe,
Gott, wie vergöttere ich den immer von neuem.
Tatsächlich entfaltet Goethes dramatisches Werk
von Berlin aus seine große künstlerische Wirkung.
Es beginnt damit schon am 12. April 1774 mit der
Uraufführung des Götz von Berlichingen durch die
Koch’sche Gesellschaft. Diese Truppe nimmt nach
dem Götz 1774 auch noch den Clavigo in ihr Re-
pertoire auf; doch das Thema Goethe und das Ber-
liner Theater ist abendfüllend und reicht für
mehrere Bücher.
Wie mit dem Theaterleben ist Goethe über Carl-
Friedrich Zelter natürlich mit der Musikkultur Ber-
lins verbunden. Es ist dies ebenfalls eines der
großen Themen, die in Einzelbehandlungen immer
wieder dargestellt zu werden verdienen.
1796 hatte Zelter Goethe einige
seiner Lied-Kompositionen zu-
kommen lassen, die in Goethe
den Wunsch nach näherer Be-
kanntschaft erwecken. Er
schreibt an die Übermittlerin
der Lieder, die Frau des Berliner
Verlegers Johann Friedrich Unger:
Musik kann ich nicht beurteilen, denn es fehlt mir
an Kenntnis der Mittel, deren sie sich zu ihrem
Zweck bedient, ich kann nur von der Wirkung spre-
chen die sie auf mich macht... Und so kann ich von
Herrn Zelters Kompositionen meiner Lieder sagen,
daß ich der Musik so herzliche Töne zugetraut
hätte.
Es ist das Einfache, das Gemütvolle, das ihn an Zel-
ters Musik anzieht. Mit Zelter ergibt sich dann eine
jahrzehntelange Korrespondenz, die in dem
menschlich so anrührenden und kulturhistorisch so
61
interessanten Briefwechsel nachzulesen ist. Zelter
wird für Goethe der Berichterstatter über Berliner
Verhältnisse in der bürgerlichen Gesellschaft und
bei Hof, über die Entwicklung der Stadt und ihrer
Bewohner, über das kulturelle Leben in allen seinen
Manifestationen. Er ist der Vermittler persönlicher
Kontakte zwischen Goethe und manchen Berliner
Persönlichkeiten der Wissenschaft und Kunst, und
er wird selbst im Laufe der Zeit so etwas wie der
offizielle Repräsentant des großen Dichters in
Berlin.
Als Direktor der Singakademie und Begründer der
geselligen Berliner Liedertafel (1808), so genannt,
weil man alle vier Wochen an jedem einem Voll-
mond nächsten Dienstag (die Straßenbeleuchtung
in Berlin war nämlich katastrophal) bei einer Mahl-
zeit von zwei Gängen an einer langen Tafel zusam-
menkam, bei der man nach dem Vorbild russischer
Truppen auch in Berlin den Männergesang pflegen
wollte, fand Zelter viele Goethe-Gedichte geeignet,
später verfasst der Dichter zum Teil eigens Verse
für diesen geselligen Kreis. Es sei hier nur an das
Bundeslied (In allen guten Stunden...), das Tischlied
(mich ergreift, ich weiß nicht wie, ein himmlisches
Behagen...) zu erinnern oder an das berühmte
Trinklied ergo bibamus (Hier sind wir versammelt
zu löblichem Tun...). Beim ersten Mal – so ein Be-
richt vom April 1810 – habe man so laut und fürch-
terlich gesungen, daß die Dielen erklangen und die
Decke des langen Saals sich zu heben schien.
Und wer kennt nicht die schlichte Vertonung des Kö-
nigs in Thule? Durch diese volksliedhaften, gut sing-
baren Kompositionen werden Goethes Gedichte in
weiten Kreisen der Bevölkerung bekannt. Von den
Aufführungen der Berliner Singakademie, von ihrem
endlich 1827 fertiggestellten großen neuen Gebäude
am Kastanienwäldchen hinter der Alten Wache
gehen ständig Berichte nach Weimar.
1827 ist auch die Höhe der von Zelter betriebenen
Bach-Pflege erreicht. Schon vorher sind in der
Singakademie Bach’sche Motetten erklungen, nun
aber überträgt Zelter seine Begeisterung für die
Musik des universalen deutschen Komponisten
auch auf den großen deutschen Dichter.
Der läßt sich in Bad Berka vom dortigen Organisten
Schütz Bachkompostionen vorspielen und übermit-
telt seinem Freund nach Berlin im Juni 1827 den
ungeheuren Eindruck, den diese Musik auf ihn ge-
macht hatte, mit den großartigen, der Musik adä-
quaten Worten: wenn die ewige Harmonie sich mit
sich selbst unterhielte, wie sich’s etwa in Gottes
Busen kurz vor der Weltschöpfung möchte zugetra-
gen haben.
Als Krönung von Zelters Bemühungen um Bach ist
die am 11. März 1829 erfolgte erste Wiederauffüh-
rung der Matthäuspassion in der Singakademie an-
zusehen, die zu dirigieren Zelter seinem
bedeutendsten und liebsten Schüler überlässt, Felix
Mendelssohn Bartholdy. Auch dieser, schon in Kin-
derjahren bei Goethe eingeführt, ist stets ein großer
Verehrer des Dichters und seiner poetischen
Schöpfungen geblieben.
Von seinen Vertonungen Goethischer Gedichte soll
hier nur die 1831 begonnene Erste Walpurgisnacht,
Ballade für Chor und Orchester, die Ouvertüre
Meeresstille und glückliche Fahrt genannt werden,
ebenso die Liedkomposition Auf dem See und das
Zigeunerlied.
Unter Goethes Komponisten
seiner Texte verdient noch
besonders der schon ge-
nannte Johann Friedrich
Reichardt hervorgehoben zu
werden, der mit seinen Lied-
vertonungen im letzten Jahr-
zehnt des 18. Jahrhunderts sehr zur
Volkstümlichkeit Goethes beigetragen hat.
Nicht zuletzt ist auch Karl-Friedrich Schinkel in
besonderer Weise mit Zelter verbunden – durch
dessen Eigenschaft als Maurermeister und über
Schinkels Theaterneubau des Schauspielhauses am
Gendarmenmarkt und durch seine Bühnendekora-
tionen.
Belebende und fördernde Anteilnahme sind hier
ebenfalls die Grundpfeiler. Es ist bekannt, daß
62
Goethe durch sein schöpferisch nachvollziehendes
Vorstellungsvermögen gerade bildende Künstler
anzuregen und zu ermuntern vermag, ihre eigenen
Ideen reicher darzulegen und manche seiner Emp-
fehlungen in ihre eigene Vorstellungswelt einzube-
ziehen.
Schinkel empfindet dies ganz stark, wie aus seinem
Brief an Christian Daniel Rauch vom November
1816 hervorgeht In Goethes Nähe wird dem Men-
schen eine Binde von den Augen genommen, man
versteht sich vollkommen mit ihm über die schwie-
rigsten Dinge, welche man allein sich nicht getraut
anzugreifen und man hat selbst eine Fülle von Ge-
danken darüber, die sein Wesen unwillkürlich aus
der Tiefe herauslockt.
Da Goethe ein lebenslanges Interesse
an Bauaufgaben pflegt, läßt er sich
auch von Schinkel besonders über
dessen Vorhaben in Berlin unter-
richten. 1817 berät er sich mit ihm
über das Relief an der Neuen
Wache. 1820 wird er bei einem ge-
meinsamen Besuch von Schinkel, Rauch
und Friedrich Tieck (während die beiden letztge-
nannten dabei ihre Goethe-Büste modellieren) über
den Theaterneubau unterrichtet.
Goethe notiert in den Tag und Jahresheften, wie
fruchtbar für beide Seiten diese Begegnung ist: Es
hatte sich in den wenigen Tagen so viel Produktives
betreffend Anlage und Ausführung, Pläne und Vor-
bereitung, Belehrendes und Ergötzliches zusam-
mengedrängt, daß die Erinnerung daran immer
wieder neu belebend sich erweisen muß.
Und so entwirft er dann mit Schinkel gemeinsam
eine passende Inschrift für das Neue Schauspiel-
haus, der dann aber doch jene des Altertumsfor-
schers Aloys Hirt vorgezogen wird
Auch über die Innenausstattung und sogar über
räumliche Mängel, wie z.B. die Logen hinter dem
Balkon seien zu eng, zu niedrig, finster, ja ängstlich,
oder die Orchesterleute klagten über unbequeme
Eingänge und Treppen oder die Bildhauer bewit-
zelten die Reliefs, Gruppen, Figuren usw., darüber
wird ein genauer Briefwechsel, meist über Zelter
oder Schultz geführt.
Goethe erhält auch alle Pläne und Risse des Alten
Museums im Lustgarten sowie die Bauzeichnungen
der Friedrichwerderschen Kirche, die der greise
Dichter mit den Worten kommentiert: Ich wünschte
wirklich darin einer Predigt beizuwohnen, welches
viel gesagt ist!
(an Zelter, 12. Februar 1829)
Am 10. Februar 1821 findet in Anwesenheit des
Hofes die Einweihung des Konzertsaals und der
Festsäle im Schauspielhaus statt. Das eigentliche
Theater wird am 26. Mai mit einem Eröffnungspro-
log, den Goethe eigens zu dem Anlaß gedichtet
hatte, festlich seiner Bestimmung übergeben. Vor-
getragen wurde der Prolog vor einem Prospekt, der
den Gendarmenmarkt mit dem Schauspielhaus zwi-
schen den Türmen des Deutschen und des Franzö-
sischen Domes zeigte.
Goethes Dank an Schinkel für die sich in seiner
Architektur aussprechende humanisierende Bau-
gesinnung, die der eigenen entspricht, findet sich in
den Schlußversen des Prologs zur Eröffnung des
Schauspielhauses 1821 in der mahnenden Anrede
an das versammelte Publikum:
So schmücket sittlich nun den geweihten Saal
Und fühlt euch groß im herrlichsten Lokal
Denn euretwegen hat der Architekt
Mit hohem Geist so edlen Raum bezweckt
Das Ebenmaß bedächtig abgezollt
Daß ihr euch selbst geregelt fühlen sollt.
Auf den Prolog folgte Goethes Schauspiel Iphige-
nie auf Tauris.
Von gleicher Herzlichkeit wie zu Schin-
kel ist gleich von Anfang an Goethes
Verhältnis zu Christian Daniel
Rauch. Auch hier seien nur wenige
Fakten in Erinnerung gerufen. Bei
seinem Besuch mit Schinkel und
Tieck in Weimar 1820 modelliert
Rauch seine berühmte à-tempo-Büste, die
mit ihrem leicht zur Seite gedrehten Kopf wohl die
bekannteste, weil lebensvollste und wahrheits-
63
getreueste Wiedergabe des Goethe’schen Antlitzes
darstellt.
Die bereits erwähnten Bildhauer
Friedrich Tieck und Gottfried Scha-
dow stehen ebenfalls in einem pro-
duktiven Verhältnis zu Goethe.
War die Beziehung zu Schadow
ursprünglich ablehnend, so wandelt
sie sich doch im Lauf der Jahre.
Zu den künstlerischen und zugleich technischen
Leistungen, die Goethe hier beeindrucken, gehört
auch die vom Stadtbaumeister Christian Gottlieb
Cantian vor dem Alten Museum aufgestellte Gra-
nitschale, wie Goethes Aufsatz von 1828 Granitar-
beiten in Berlin beweist.
Auf dem sich überschneidenden Gebiet von Wis-
senschaft, Technik und Volksbildung seien auch
noch zwei Männer genannt, die weiter Wirkendes
und Bleibendes geleistet haben, indem sie den Fort-
schritt auf praktisch technischem Gebiet in die Aus-
bildung junger Menschen integrierten, was Goethe
außerordentlichen Respekt abnötigte.
Es handelt sich um Christian Wilhelm
Beuth als Begründer des Gewerbein-
stituts. Ihm vertraut Goethe in sei-
nen letzten Lebenswochen, am 1.
Februar 1832, eine in die Zukunft
gehende Bitte an, nämlich für die
Herstellung künstlicher plastischer ana-
tomischer Lehrpräparate von Organen und
Körperteilen zu sorgen, wofür Beuth entsprechende
Institutionen und Künstler interessieren sollte.
Ich habe nicht lange mehr Zeit, schreibt Goethe,
und muß daher eilen, das Mögliche zu tun, anderes
zuverlässigen Freundin anzuvertrauen. Ich mag
mich aber umsehen, wo ich will, außer Berlin
scheint mir das Gelingen unmöglich. — Wie sehr
er von der Wichtigkeit dieses Anliegens durch-
drungen ist, bezeugt der Ausschnitt über die plasti-
sche Anatomie im dritten Buch von Wilhelm
Meisters Wanderjahren, auch dieses wieder ein
Beispiel, wie Tageswissen in einer Dichtung seinen
Platz findet.
Als zweites Beispiel neben Beuth ist Karl Friedrich
Klöden zu nennen, dessen mit Stichen Daniel Cho-
dowieckis versehenes Buch Von Berlin nach Berlin
manchem bekannt sein wird. Klöden
berichtet darin von seiner Leitung
der ersten Gewerbeschule.
Diese, eine hohe Allgemein-
bildung zur Bewältigung der
Aufgaben der industriellen
Revolution vermittelnde Schu-
le, wird das Muster eines neuen
Schultyps, der Realschule, in der
man sich, statt auf die alten Sprachen wie im her-
kömmlichen Gymnasium, auf die lebenden und auf
die naturwissenschaftlichen und technischen Fächer
konzentriert. Ihr Programm zu Prüfungen an den
Gewerbeschulen wird 1829 von Goethe lobend
besprochen.
Zum Schluß möchte ich noch auf einige der zahl-
reichen und vielfältigen wissenschaftlichen Kon-
takte eingehen, die sich zwischen Goethe und
Berliner Gelehrten und wissenschaftlichen Institu-
tionen ergeben haben.
Es steht außer Zweifel, daß Goethes Streben in den
späteren Lebensjahren darauf gerichtet ist, gerade
auch für seine naturwissenschaftlichen Arbeiten auf
den Gebieten der Optik, der Farbenlehre, der Ana-
tomie, Zoologie, Botanik, Geologie und Mineralo-
gie Anerkennung zu finden, die ihm jedoch von den
meisten Fachgelehrten versagt bleibt.
Als 1806 Preußen seine Universität Halle verliert
(Halle wurde bekanntlich dem Königreich Westfa-
len zugeschlagen), kommen viele Professoren von
dort nach Berlin und es entsteht sehr schnell der
Plan einer Universitätsgründung.
Der Altphilologe Friedrich August Wolf, der die
Philologie von der Theologie eman-
zipiert und die eigentliche Al-
tertumswissenschaft erst
begründet hat, dem Goethe
freundschaftlich verbunden
ist und dem er viel für sein
eigenes Antike-Verständnis
verdankt, hat schon 1807 eine
diesbezügliche Denkschrift bei
Friedrich Wilhelm III. eingereicht und Wilhelm von
Humboldts Namen an die erste Stelle seiner Vor-
schlagsliste gesetzt.
Zelter schreibt dazu an Goethe am 23 August 1809:
Wolf hat einen Plan gemacht, statt der alten Uni-
versität Halle eine neue preußische hier am Orte
zu etablieren und solche womöglich in der Akade-
mie der Wissenschaften zu verbinden.
Aber erst 1809, als Wilhelm von Humboldt zum
Leiter des preußischen Unterrichtswesens berufen
64
wird, erreicht dieser die Gründungsgenehmigung
und dazu die Schenkung des seit 1802 leerstehen-
den Palais des verstorbenen Prinzen Heinrich als
Universitätsgebäude.
Humboldt, auch im Salon der Henriette Herz als
junger Mann zum Verehrer Goethes geworden,
steht seit 1794 in engem Kontakt mit Goethe und
bleibt bis zu dessen Lebensende einer seiner ver-
trauten jungen Freunde, der es sich sogar erlauben
kann, den Herrn Geheimrat in seinen Briefen mit
Liebster Goethe oder mein innig geliebter Freund
anzureden.
Wilhelm von Humboldt, das
sei nicht vergessen anzu-
merken, ist auch der Adres-
sat von Goethes letztem
Brief vom 17. März 1832,
fünf Tage vor seinem Tode
geschrieben, geht dieser somit
als Vermächtnis auch nach Berlin.
Er enthält die Antwort auf Humboldts Bitte, das
Faust-Manuskript doch nicht einzusiegeln, sondern
den Freunden schon jetzt den Lesegenuß zu
gönnen.
Goethe aber lehnt es ab, weil für diese sehr ernsten
Scherze die Zeit noch nicht gekommen sei, da ver-
wirrende Lehre zu verwirrtem Handeln über die
Welt walte. Und er schließt mit dem Bekenntnis und
der Aufforderung zur Steigerung der eigenen Per-
sönlichkeit, der individuellen Existenz.
Genauso vertraut wie zu Wilhelm von Humboldt ist
auch Goethes Verhältnis zu dessen jüngerem
Bruder Alexander. 1794 hatte der junge Bergrat bei
seinem Bruder in Jena zu Besuch geweilt und es
hatte sich eine tiefe gegenseitige Beziehung
zwischen ihm und Goethe ergeben.
Goethe stellt diese Beziehung in einem Brief an den
Berliner Verleger Unger einmal so dar: Die
Gegenwart des Herrn Bergrat machte mir eine
ganz besondere Epoche, indem er alles in Bewe-
gung setzt, was mich von vielen Seiten interessieren
kann.
Auch der junge Humboldt bekennt, daß das Jenaer
Jahr und der Gedankenaustausch mit Goethe auf
seine geistige Entwicklung sehr stark eingewirkt
habe, nach seiner Rückkehr von
einer Süd- und Mittelamerika-
Expedition finden wir in dem
Brief an Goethe vom 6. Feb-
ruar 1806, in dem er die beab-
sichtigte Übersendung seiner
mit Bonpland verfaßten Ideen zu
einer Geographie der Pflanzen ankündigt, den schö-
nen Satz: In den einsamen Wäldern am Amazonen-
strom erfreute mich oft der Gedanke, Ihnen die
Erstlinge dieser Reise widmen zu dürfen nach Art
der antiken Weihgeschenke!
Besonders schätzt Goethe den archäologisch und
zeichnerisch begabten Architekten Wilhelm Zahn,
der Zeichnungen von Wandmalereien aus Pompeji
vorlegen kann und dem die Benennung eines der
schönsten pompejanischen Häuser mit Casa di
Goethe zu danken ist.
65
Zu Goethes Besuchern oder Korrespon-
denzpartnern gehören ferner der
Theologe und Philosoph Friedrich
Schleiermacher, der Verfasser der
Römischen Geschichte Barthold Georg
Niebuhr und der Althistoriker Friedrich
Wilken.
Nicht vergessen sei auch der große Orientalist
Heinrich Friedrich von Diez, dessen wertvoller
Nachlaß in der Berliner Staatsbibliothek auf-
bewahrt wird, und dem Goethe bedeutende
Anregungen und Belehrungen für seinen
West-östlichen Divan verdankt. Verbun-
den mit Goethe ist auch der Philosoph
Johann Gottlieb Fichte, mit dessen An-
schauung er vielfach übereinstimmt und
den er gern nach dem Atheismusstreit an der
Universität Jena gehalten hätte.
In der pädagogischen Provinz in Wilhelm Meisters
Wanderjahren reflektiert er in der Lehre von der
notwendigen Einordnung des individuellen
Lebens in die Gesellschaft unter anderem
auch Fichtes philosophische Grundsätze.
Auch Wilhelm Friedrich Hegel ist mit
Goethe seit seiner Lehrtätigkeit in Jena
1801-1807 gut bekannt, Goethes Urphä-
nomen und Hegels Idee sind einander ent-
sprechende Begriffe. Beide verbindet auch
Hegels Eingehen auf Goethes Farbenlehre.
Neben vielen anderen hervorragenden Männern
ihres Fachs seien auch noch zwei berühmte Ärzte
genannt: Werner Christoph Wilhelm Hufeland, als
Sohn des Weimarer Hofarztes auch einige Jahre
Goethes behandelnder Arzt, ist leitender Mediziner
der Charité und königlicher Leibarzt in Berlin ge-
worden. Sein Kollege Johann
Christoph Reil, nach der Schlie-
ßung der Hallenser Universität
1806 auch in Berlin tätig, ist
bei seiner ärztlichen Tätigkeit
in den Lazaretten nach der Völ-
kerschlacht bei Leipzig 1813 an
Typhus verstorben. Mit Goethe war
er schon als Badearzt in Halle wie auch durch seine
dortige Begründung des Theaters bekannt, wozu
der Dichter 1811 den Prolog Was wir bringen
geschrieben hat.
Last but not least sei der große Anteil von Berliner
Verlegern an der fruchtbaren Wechselbeziehung
zwischen Goethe und Berlin angeführt. Sie ma-
chen, zum Teil in Erstdrucken,
Goethes Werk dem Lesepubli-
kum bekannt. Um nur die wich-
tigsten zu nennen: Bei Unger
erscheint 1789 Das Römische
Carneval, später in die Italieni-
sche Reise aufgenommen, dann
7 Bände Goethes Neue Schrif-
ten und 1796 der Wilhelm Meis-
ter. Vieweg verlegt 1797 den
Erstdruck von Hermann und
Dorothea, der ein Riesenerfolg
wird, so daß Goethe zufrieden
an Aloys Hirt schreibt:»Berlin
ist vielleicht der einzige Ort,
von dem man sagen kann, dass
ein Publikum beisammen sei,
und umso mehr muss es einen
Autor interessieren, wenn er daselbst gut aufge-
nommen wird.«
Nicht zu vergessen auch der berüchtigte Nach-
drucker Friedrich Himburg, der zwar ohne Hono-
rarzahlung an den Dichter, doch aber schon seit
1775 für die Verbreitung seiner Werke gesorgt
hatte. Dem gesamten Verhältnis, das zu einer tiefen
Verbundenheit mit unserer Stadt geführt hatte, gibt
Goethe Ausdruck in einem anfangs bereits zitierten
Brief vom 15. März 1826 an Friedrich Wilhelm III.
anläßlich des erteilten Privilegs gegen Nachdru-
cker, wo er sich über Berlin und sich Rechenschaft
gibt: Männer, welche (...) das Treffliche vollbrin-
gen, solche standen von früh an mit mir in trauli-
chen Verhältnissen und durch fortdauernde
Wechselwirkung ist eine geistige Mitbürgerschaft
eingeleitet, welche über Zeit und Ort hinaus ein ge-
genseitiges Glück befördert.
Auf einer geistigen Mitbürger-
schaft beruhte sein Verhältnis zu
Berlin, der persönlichen hat er
sich, selbst besuchsweise, immer
wieder entzogen, trotz des
manchmal geäußerten Wunsches,
hinzukommen. Am 19. Novem-
ber 1820 schreibt er: Mein
Wunsch Berlin zu besuchen (...)
die Königsstadt zu schauen, zu
erkennen und zu verehren (...),
dieses Gefühl ist zu einer Art Un-
geduld geworden, daß, wenn
Fausts Mantel in meinem Besitz
wäre, sie mich augenblicklich
auffliegen sehen.
66
Aber der Mantel ist nicht in seinem Besitz. Von
einer weiteren Berlinvisite mag ihn eher eine bei-
nahe ans Existenzielle rührende Faustische Vision
der Großstadt abgehalten haben: Des Erdgeists sau-
sendes Weben, die menschliches Vermögen eigent-
lich übersteigende unablässige Bewegung und
Tätigkeit, die hier Wirklichkeit geworden war.
Rational läßt sich so etwas nicht erklären. Entschei-
dend aber bleibt, daß trotz oder gerade wegen aller
Widersprüchlichkeiten das Verhältnis Goethes zu
Berlin für beide Seiten fruchtbar war und der Kunst
und der Wissenschaft ihrer Zeit einen bis heute gül-
tigen Stempel aufgeprägt haben.
67
Man hat mich immer als einen vom Glück besonders Begüns-
tigten gepriesen, auch will ich mich nicht beklagen und den
Gang meines Lebens nicht schelten. Allein im Grunde ist es
nichts als Mühe und Arbeit gewesen, und ich kann wohl sagen,
daß ich in meinen fünfundsiebzig Jahren keine vier Wochen ei-
gentliches Behagen gehabt.
Goethe zu Eckermann, 27.Januar 1824
Goethes zahlreiche, oft akut-bedrohliche, oft auch
langwierige und immer wiederkehrende Erkran-
kungen sind ein lebenslanges Thema in seinen
eigenen Äußerungen, Gesprächen und Briefkon-
takten mit seinem Umfeld. Die wichtigsten Diag-
nosen, die uns dadurch überkommen sind, seien
hier wiedergegeben: Lebensbedrohliche Risikoge-
burt; Masern, Windpocken, echte Pocken; Hals-
entzündungen, katarrhalische Fieber; zweimaliger
Blutsturz; Gelenk- und Muskelrheumatismus; Ha-
bituelle Obstipation; Nierensteine; Zahneiterun-
gen, Zahnverlust; Hypertonie, Arteriosklerose;
Schwindelanfälle, Gedächtnisverlust; zwei Herz-
infarkte; Hypochondrie, Depression; Polyarthritis;
phasenweise Alkoholismus.
Die erste lebensbedrohliche Krise ist überliefert
aus der Leipziger Zeit, als der Jugendfreund Beh-
risch 1767 nach Dessau versetzt wird, Goethes
Beziehungen zu dem geliebten Kätchen Schön-
kopf zusammenbrechen und ein Juraexamen be-
vorsteht. Eines Nachts wachte ich mit einem
heftigen Blutsturz auf, und hatte noch soviel Kraft
und Besinnung, meinen Stubennachbar zu wecken.
Doktor Reichel wurde gerufen, der mir aufs
freundlichste hülfreich ward, und so schwankte ich
mehrere Tage zwischen Leben und Tod.
Ob die Krankheit in dieser akuten Phase wirklich
lebensbedrohlich war, wissen wir nicht; daß sich
aber die Vorstellung einer Todesnähe bei Goethe
traumatisch festgesetzt hat, lässt sich über sein
ganzes Leben immer wieder beobachten. Bei den
ersten Anzeichen der Stabilisierung seines Zustan-
des bricht er seinen Aufenthalt endgültig ab.
Frankfurt erreicht er als Schiffbrüchiger, als
Studienabbrecher, körperlich krank, vor allem
aber seelisch verwundet. Der enttäuschte Vater
findet einen Kränkling vor.
Es beginnt eine einein-
halbjährige Rekonva-
leszenz im Elternhaus,
mit mehreren, erneut
sehr dramatisch erleb-
ten Rückfällen. In sei-
nem Giebelzimmer
verbringt er Tage des
Hindämmerns und
immer wiederkehren-
der Rezidive seiner
seelischen und körper-
lichen Probleme. Einem
unerklärlichen, schlau-
blickenden, sprechen-
den, übrigens abstrusen
Arzt gelingt es, mit einer
geheimnisvollen Arznei
die schwere Verstop-
fung zu durchbrechen.
Als der ungeduldig ge-
wordene Vater auf die
Fortsetzung des Studi-
ums drängt und Goethe
im März 1770 nach
Straßburg aufbricht,
fühlt er meine Gesund-
heit, noch mehr aber
meinen jugendlichen
Mut wieder hergestellt.
Als er sich 1775 in das problematische Liebesver-
hältnis mit der Frankfurter Bankierstochter Lili
Schönemann bis zur Depression verstrickt,
schreibt er an seine vertraute Brieffreundin, Au-
guste Gräfin zu Stolberg: O wenn ich jetzt nicht
Dramas schriebe ich ging zu Grund! Dies ist bei
Goethe ein wichtiges, häufig wiederkehrendes
Phänomen: Schon nach dem Werther-Erlebnis hat
er seine poetische Kreativität als »altes Hausmit-
tel« bezeichnet und sich dadurch aus »einem stür-
mischen Elemente« gerettet gefühlt.
Daß er sich öfter aus körperlichen Misshelligkei-
ten gewissermaßen frei schreibt, läßt sich bis ins
hohe Alter verfolgen.
2000
Gesundheit und Krankheit bei Goethe
Prof. Dr. Volker Hesse (Berlin)
Was nützt mir der ganzen Erde Geld?
Kein kranker Mann genießt die Welt
Gesundheit und Krankheit bei Goethe
Dr. Hubert Heilemann (Dresden)
Gesteigertes Übelbefinden, heftige Schmerzen am
Herzen, um 11 Uhr zur Ader gelassen…
Goethe als Patient
68
Prof. Dr. Manfred Heuser (München)
Farben – die Seele des Lichts
Die Newton-Kritik
– eine paranoide Psychose Goethes?
Prof. Dr. Wolfgang Schad (Witten-Herdecke)
Seelenleiden zu heilen vermag der Verstand
nichts,
die entschlossene Tätigkeit hingegen alles…
Goethe als Psychiater
Goethes 251. Geburtstag in Frau Schuberts
Garten
Musikalisch-literarisches Programm
Seit 1776 führt er 57 Jahre lang Tagebuch, bis
wenige Tage vor seinem Tode. Akribisch notiert
er dort u.v.a. seine körperlichen Zustände und
seine Stimmungen. Bereits am Anfang seines
Weimarer Aufenthaltes lesen wir von andauern-
dem Zahnweh, verdorbenem Magen, von wie-
derholten Fiebern, Bronchialkatarrhen und
rheumatischen Schmerzen in Muskeln und Ge-
lenken, von Herzklopfen und fliegenden Hitzen.
Die ständig gestörte Verdauung wird im Alltag
zum Dauerproblem, ebenso die Zahneiterungen,
die zu dieser Zeit beginnen und ihn bis ins Alter
begleiten, bis er seine Zähne verlor. Die Tage-
buchnotizen lassen sich beliebig auffüllen durch
klagende Briefe an die Geliebte Charlotte von
Stein und an Freunde wie Lavater, Merck, Kne-
bel und andere. Sie alle zeigen, wie anfällig
Goethe sich fühlt, wie übersensibel, wie hypo-
chondrisch er auf körperliche Beschwerden rea-
giert.
In den 1780-er Jahren, unter der Last seiner Wei-
marer Ämter als Kammerpräsident, in der Berg-
werkskommission und in der Oberaufsicht über
die wissenschaftlichen und Kunstanstalten, lesen
wir im Tagebuch und in seinen Briefen immer
wieder von Zahnflüssen, Halsentzündungen,
rheumatischen Beschwerden, Magenverstimmun-
gen und ähnlichen Alltagsbeschwerden: mein
Zahnweh ist leidlich, doch hab ich mich bei Hofe
entschuldigt; (...) mein Hals hat sich diese Nacht
nicht verbessert, ich will versuchen, zuhause zu
bleiben; (...) ich darf es nicht wagen, auszuge-
hen«; »man sieht, daß allerlei im Körper stickt
das nicht weiß, wohin es sich resolvieren will.
Sein Arzt in dieser Zeit ist bis 1793 der damals
noch junge, später wohl berühmteste Arzt seiner
Zeit, Christoph Wilhelm Hufeland. Er überzeugt
nicht nur Goethe durch seine Vorstellung von
einer dem Körper innewohnenden Lebenskraft
und von der Förderung eines gesunden und lan-
gen Lebens durch die vernünftige Regulierung
der menschlichen Grundbedürfnisse Essen,
Trinken, Schlaf, Bewegung, Ruhe etc., die sog.
Makrobiotik. Hufeland schickt Goethe 1785 zu
seiner ersten Badekur nach Karlsbad – ihr wer-
den vierundzwanzig weitere Badereisen folgen:
Das Karlsbader Schwefelwasser fördert insbe-
sondere Goethes chronisch schlechte Ver-
dauung – bis an sein Lebensende wird er Wasser
vom dortigen Kreuzbrunnen im Hause haben.
69
Aus der zweiten Badekur in Karlsbad, im Septem-
ber 1786, bricht Goethe heimlich nach Rom auf,
um dort bis zum Juni 1788 zu bleiben. Nie wieder
hat er sich so gesund gefühlt wie dort; das Klima
bekommt ihm ausgezeichnet, wo man den ganzen
Tag nicht an seinen Körper denkt, sondern wo es
einem gleich wohl ist, notiert er bereits nach we-
nigen Tagen in Vicenza für Frau von Stein. Gegen
Ende seines Aufenthaltes schreibt er ihr aus Rom,
er hätte die ganze Zeit keine Empfindung aller der
Übel gehabt, die mich im Norden peinigten« und
daß er »mit eben derselben Constitution hier wohl
und munter lebe, so sehr als ich dort litt.
Im Jahr seiner Rückkehr 1788 nimmt er die 23-
jährige Christiane Vulpius zu sich, begegnet erst-
mals Friedrich Schiller und löst sich von Frau von
Stein. Er steht an der Schwelle zu einer neuen Le-
bensphase – und beginnt erneut an den alten
Übeln zu leiden und sich entsprechend zu verhal-
ten. Da ich mich einmal entschlossen habe krank
zu sein, so übt auch der Medikus (…) sein despo-
tisches Recht aus, schreibt er im März 1800 an
Schiller, durch dessen Freundschaft er andererseits
seit 1794 den für beide so ungeheuer produktiven
Aufschwung erlebt.
Anfang Januar 1801 erkrankt er an der sogenann-
ten Blatterrose, die medizinisch damals wie heute
als Erysipel bezeichnet wird. Unter gleichzeitigem
hohem Fieber mit einer zeitweisen Bewußtlosig-
keit entwickelt sich im Bereich der linken Ge-
sichtshälfte eine hochentzündliche, teilweise
blasenbildende Schwellung, die auf das linke
Auge, den Gaumen, den Rachen und den Kehl-
kopf übergreift. Krampfhusten und Erstickungs-
anfälle führen dazu, daß er zwei Tage nicht im
Bett bleiben kann, um nicht zu ersticken. Neun
Tage und neun Nächte dauert dieser Zustand, nach
dem endgültigen Abklingen bleibt er monatelang
krank, grämlich und reizbar.
Im Februar 1805 erkrankt Goethe erneut ernstlich,
mit wochenlangen Nierenkoliken unter gleichzei-
tigen Fieberschüben und erheblichen Schmerzen;
die Koliken werden Goethe noch jahrelang quä-
len. Zweimal nachts muß Christiane den ganzen
Leib mit scharfem Spiritus einreiben, innerlich
werden alte, bei Harnwegserkrankungen bewährte
pflanzliche Hausmittel wie Brennessel und Bären-
traube, aber auch Opium und Bilsenkraut gegen
die Schmerzen gegeben. Zudem muß er reiten, um
den vermuteten Nierenstein in Bewegung zu brin-
gen.
Nach der Schlacht von Austerlitz, in der Napoleon
vernichtend die Österreicher und Russen schlägt,
soll Goethe gesagt haben: Wenn mir doch der liebe
Gott eine von den Russennieren schenken wollte,
die zu Austerlitz gefallen sind!
Noch während der Rekonvaleszenz des Steinlei-
dens bricht nach langer, wirklich schwerer Krank-
heit sein Freund Schil-
ler zusammen und
quält sich 9 Tage lang
bis zu seinem Tode am
9. Mai 1805 im Alter
von 45 Jahren. Man
wagt zunächst nicht,
es Goethe zu sagen;
als er es erfährt, rea-
giert er mit einem
schweren Rückfall.
Unleidlicher Schmerz
ergriff mich, und da
mich körperliche Leiden von jeglicher Gesell-
schaft trennten, war ich in traurigster Einsamkeit
befangen. Meine Tagebücher melden nichts von
jener Zeit; die weißen Blätter deuten auf einen
hohlen Zustand. Dieser dauert, wie das nahezu
stumme Tagebuch ausweist, sieben Monate.
Goethes übersensible Einstellung, sich von Krank-
heit und Tod ihm nahestehender Menschen fern-
zuhalten, ist mehrfach aus seinem Leben bezeugt.
1816, während Christianes achttägigem Sterben in
so fürchterlichen Krämpfen, daß die Mägde da-
vonliefen, bleibt er in seinen hinteren Zimmern,
arbeitet, experimentiert und diktiert Post. Goethe
weiß von dieser seiner Tendenz, sich durch Bei-
hülfen, die uns die Kultur anbietet, zusammen zu
nehmen, um sich von Kummer und Trauer abzu-
lenken, bezahlt dies aber fast jedesmal mit einem
vermehrten Ausbruch seiner körperlichen Übel.
Am deutlichsten wird dies nach dem plötzlichen
Tod seines Sohnes August im Oktober 1830 auf
der Reise in Rom, den er zunächst äußerlich
Dr. Hartmut Schmidt (Wetzlar)
Ich liebe zu tafeln am lustigen Ort
Essen und Trinken bei Goethe
Prof. Dr. Manfred Bühring (Berlin)
Das Wahre erscheint nicht unmittelbar…
Goethe Anschauen in der Medizin
70
beherrscht zur Kenntnis nimmt, dann aber, einige
Wochen später mit dem zweiten Blutsturz seines
Lebens reagiert.
Mit seinen Ärzten versteht er sich gut; zu seinen
Hausärzten Wilhelm Huschke wie auch später zu
Wilhelm Rehbein – beide sind großherzogliche
Leibärzte – hat er großes Vertrauen, wenngleich er
sie vielfach beschimpft und ihre Anordnungen gele-
gentlich hintergeht.
Als sich der 66-jährige 1815 in Heidelberg aus der
Liebesbeziehung mit Marianne von Willemer ver-
abschiedet, fingen aber die bisher nur drohenden
Übel an, förmlich aufzubrechen. Es entstand, so
fährt Goethe fort, ein Brustweh, das sich fast in
Herzweh verwandelt hätte, aber dies sei, so läßt er
sich von dem Heidelberger Professor Nägele beru-
higen, eine natürliche Folge der Heidelberger
Zugluft und veränderlichen Schloßtemperatur.
Am 11. Februar 1823, im Alter von 74 Jahren, er-
krankt Goethe akut so schwer, daß man bereits sei-
nen Tod meldet. Starke Schmerzen in der
Herzgegend, Beklemmung auf der Brust, hochgra-
diges Angstgefühl, Atemnot, später Fieber und
Ödeme an beiden Füßen –Symptome eines Herzin-
farktes.
Huschke und Rehbein können dies damals nicht
wissen, sie behandeln symptomatisch mit Aderlass,
Blutegel, Meerrettich-Kompressen und Arnika-Tee.
Goethe hat hierzu wenig Vertrauen: Probiert nur
immer, sagt er zu seinen Ärzten, der Tod steht in
allen Ecken und breitet seine Arme nach mir aus,
aber laßt euch nicht stören.
Gegen die Hilflosigkeit der Ärzte erhebt er dieses
Mal bittere Klage, beschimpft sie als Hundsfötter
und wehrt sich gegen ihre Verordnungen: wenn ich
nun doch sterben soll, so will ich auf meine eigene
Weise sterben. Tatsächlich erholt er sich relativ
bald, ist sich nach dieser Krise aber im Klaren, daß
ihm die nun folgenden Jahre nur geschenkt sind.
Den nahezu gleichen Zustand mit schwerem Husten
und Herzschmerzen erlebt er noch einmal im
November des gleichen Jahres, in tiefer Depression
nach dem Verzicht auf die junge Ulrike von
Levetzow in Marienbad. Die relativ schnelle Erho-
lung von diesem Zustand wird sicher zu recht mit
dem beruhigenden Besuch seines Altersfreundes
Carl- Friedrich Zelter gesehen, dem Goethe mehr-
fach die Marienbader Elegie vorliest und dem er
noch ein Jahr später davon schreibt: Wenn das, was
du als Grund meiner Krankheit erkanntest, nun, wie
es den Anschein hat, sich als das Element meines
Wohlbefindens manifestieren wird, so geht alles gut.
Zu Goethes großem Leidwesen verstirbt
1825 sein langjähriger, sehr geliebter
Hausarzt Hofrat Rehbein. An seine Stelle
kommt der junge, erst 28-jährige Dr. Carl
Vogel, der Goethe bis zu seinem Tode
nicht nur bestens ärztlich betreut, sondern
wie seine Vorgänger zur Vertrauensperson
wird. Daß ich mich jetzt so gut halte, sagt
Goethe zu Eckermann, verdanke ich
Vogel; ohne ihn wäre ich längst abgefah-
ren. Vogel ist zum Arzt wie geboren und
überhaupt einer der genialsten Menschen,
die mir je vorgekommen sind.
Bis zuletzt arbeitet er am vierten Teil von Dichtung
und Wahrheit und vollendet im Jahr vor seinem Tod
den zweiten Teil seines Faust. Die Beschreibung sei-
nes Hausarztes Vogel über Die letzte Krankheit
Goethe’s im Winter 1831/32 dokumentiert eindrück-
lich den dramatischen Verlauf des offensichtlichen
Herztodes, der schließlich – in der Beschreibung Vo-
gels – ungemein sanft zu Ende gegangen sei.
Prof. Dr. Heinz Schott (Bonn)
Den Sinnen hast Du dann zu trauen,
kein Falsches lassen sie Dich schauen…
Medizin der Goethezeit
Dr. Gunhild Pörksen (Freiburg)
Die Nacht im Sessel sitzend zugebracht…
Gesundheit und Krankheit
in Goethes Tagebüchern und Briefen
71
Hatte Goethe, der sich mit dem Wesen der Natur
beschäftigte, der suchte, was die Welt im Innersten
zusammenhält, der als Staatsmann, Theaterdirektor
und Dichter sich in einem Zustand beständiger Be-
schäftigung befand, überhaupt Zeit für Kinder?
Waren sie Teil seines Lebensplanes, seiner Emotio-
nen, seiner Fürsorge und Objekte liebevoller Zunei-
gung?
Wie wir aus zeitgenössischen Berichten wissen,
fühlt sich bereits der junge Goethe zu Kindern hin-
gezogen. So wissen wir von seiner Zuneigung zu
den Kindern seiner Freunde und Bekannten, u.a. zu
Mercks Kindern in Darmstadt, den Kindern des
Amtmanns Buff in Wetzlar, Charlottes Geschwister
sowie den Kindern Wielands in Weimar.
Nach der Übersiede-
lung nach Weimar
1775 erlebt er den har-
monischen Familien-
kreis des Schriftstellers
Christoph Martin Wie-
land. Der ledige Goe-
the fühlt sich Kindern
so eng verbunden, daß
er für den Nachwuchs
der Freunde eigens
Kinderfeste in seinem
Gartenhaus organisiert
und gestaltet. Auch
führt er Geschicklich-
keitsspiele und sportli-
che Übungen in
Weimar ein; etwa das
Schlittschuhlaufen.
Dies entspricht seiner
Vorstellung von einem natürlichen Leben und einer
natürlichen Erziehung.
In Weimar nimmt der unverheiratete
Goethe zwei Pflegesöhne in sein Haus auf
– zunächst den 12 jährigen Schweizer Hir-
tenknaben Peter im Baumgarten und später
den 11 Jahre alten, Friedrich, genannt Fritz,
den jüngsten Sohn der Frau von Stein.
Die Bemühungen Goethes um seine Pfle-
gesöhne sind in ihrem Ansatz sehr emotio-
nal und z.T. rührend. Während der engen
Bindung an Charlotte von Stein kann er
unter den gegebenen Bedingungen in die-
ser Lebensperiode nicht an die
Gründung einer eigenen Familie
denken.
Die Betreuung des 12-jährigen
Peter im Baumgarten gestaltet
sich jedoch zunahmend problema-
tisch. Peter gliedert sich nur schwer
ein, raucht Pfeife und nimmt seinen
Hund mit ins Bett. Auch malt er einmal die Büste
Wielands mit Tinte an. Nach zwei Jahren schickt
Goethe ihn 1779 nach Ilmenau, damit er den Jäger-
beruf erlernen soll.
Frau von Stein vertraut ihm ihren jüngsten Sohn
Fritz an, der drei Jahre lang – von 1783 bis zur
Italienreise – in Goethes Haus wohnen wird. Goethe
sieht ihn als ein Liebespfand der Frau von Stein. Er
schreibt ihr 1783: Du weißt nicht, wie sehr ich Dich
auch in ihm liebe und wie ich mich freue, einen
Pfand von dir zu haben. Er nimmt Fritz auf seinen
Reisen mit, um ihn durch Anschauung zu bilden.
Friedrich von Stein selbst bezeichnet
später in der Gesamtrückschau die Er-
ziehungsphase bei Goethe als die glück-
lichste Periode seiner Jugend.
In Wilhelm Meisters Wanderjahren äu-
ßert er seine Ansichten über die Aufgabe
der Erziehung: Wohlgeborene, gesunde
Kinder bringen viel mit: die Natur hat
jedem alles gegeben, was er für Zeit und
Dauer nötig hatte, dieses zu e n t w i k-
k e l n ist unsere Pflicht, öfters ent-
wickelt´s sich besser von selbst.
2001
Goethe – Jugend und Alter
Prof. Dr Henrik Birus (München)
Im Gegenwärtigen Vergangenes...
Die Wiederbegegnung des alten
mit dem jungen Goethe
Die neuen Leiden des jungen W. (1976)
Filmvorführung
Anschließend: Diskussion mit dem Autor
Ulrich Plenzdorf: Rückblick nach 30 Jahren
Prof. Dr. Volker Hesse (Berlin)
Meinem Herzen sind die Kinder am nächsten
Goethes Beziehungen zu Kindern
und Heranwachsenden
72
Goethes Erziehungsmaximen beinhalten vor allem
folgende Grundsätze:
1. Heranführen des Kindes an die Dinge der Wirklichkeit.
2. Die Bildung den Anlagen entsprechend zu gestalten.
3. Heiterkeit in der Pädagogik und Milde des Lehrers
4. Erziehung zur Ehrfurcht den Erwachsenen gegenüber.
Bemerkenswert sind für uns auch Goethes Gedan-
ken über Fortentwicklung und Reifen des Kindes.
In Dichtung und Wahrheit schreibt er: Wir können
die kleinen Geschöpfe, die vor uns herumwandeln,
nicht anders als mit Vergnügen, ja mit Bewunderung
ansehen. (...) Das Kind mit seinesgleichen und in
Beziehungen, die seinen Kräften angemessen sind,
scheint so verständig, so vernünftig, daß nichts drü-
ber geht, und zugleich so bequem, heiter und ge-
wandt, daß man keine weitere Bildung für daßelbe
wünschen möchte.
Die Unarten der Kinder vergleicht Goethe milde
mit Stengelblättern einer Pflanze, die nach und nach
von selbst abfallen. Der Mensch sagt er, hat ver-
schiedene Stufen, die er durchlaufen
muß, und jede Stufe führt ihre besonde-
ren Tugenden und Fehler mit sich, die in
der Epoche, wo sie kommen, durchaus
als naturgemäß zu betrachten und gewis-
sermaßen recht sind. Auf der folgenden
Stufe ist er wieder ein anderer, von den
früheren Tugenden und Fehlern ist keine
Spur mehr, aber Arten und Unarten sind
an deren Stelle getreten. Und so geht es
fort bis zu der letzten Verwandlung, von
der wir nicht wissen, wie wir sein wer-
den.
(zu Eckermann)
Goethe rät zur sorgsamen und geduldigen Erzie-
hung: Ein Blatt, das groß werden soll, ist voller Run-
zeln und Knittern, ehe es sich entwickelt, wenn man
nicht Geduld hat und es gleich so glatt haben will
wie ein Weidenblatt, dann ist’s übel.
(Brief an Jacobi
vom 9. September 1788).
Goethes »Pädagogik« gibt der Bildung den Vorrang
vor der Erziehung. Zwang und Verbote möchte er
vermeiden. In den Wahlverwandtschaften formu-
liert er: Sowohl bei der Erziehung der Kinder als
bei der Leitung der Völker (ist) nichts ungeschickter
und barbarischer als Verbote, als verbietende Ge-
setze und Anordnungen.
Goethe will dagegen dem Heranwachsenden selbst
überlassen, was er aus einem Wissensangebot für
sich entnimmt. Seiner Meinung nach darf das Bil-
dungssystem den Charakter nicht verbiegen. An W.
v. Humboldt schreibt er: Das beste Gemüt ist das,
welches alles in sich aufnimmt, sich alles zuzueig-
nen weiß, ohne daß es der eigentlichen Grundbe-
stimmung, demjenigen was man Charakter nennt,
im mindesten Eintrag thue... Ziel muß es sein, daß
der Einzelne sich zum ’Organ’ der Gemeinschaft
bildet.
Das Fehlen erzieherischer Konsequenzen beim
gleichzeitigen Ziel eines umfassenden Wissenser-
werbes wirkt sich – retrospektiv gesehen – nicht
umfassend positiv aus, weder auf die Entwicklung
des Fritz von Stein, noch auf seinen Sohn und seine
Enkel. Als Goethe 40 Jahre alt war, gebärt ihm die
16 Jahre jüngere Christiane Vulpius den einzigen
überlebenden Sohn Au-
gust. Es steht außer Zwei-
fel, daß er ein liebevoller
und besorgter Vater ist.
August wird später ein
wichtiger Helfer für Goe-
the, der ihn jedoch lange
noch als Kind und als Ab-
hängigen behandelt.
Nach Augusts Tod muß er zusätzlich die Aufgaben
der Vaterstelle mit übernehmen. Die Enkel haben
in Goethes Haus Sonderrechte, sie dürfen sogar in
das »Allerheiligste«, das Arbeitszimmer, kommen
und haben dort einen Spieltisch. Goethe liebt seine
Enkel, ein Ausdruck hierfür ist ein Brief, den er an
Marianne von Willemer schreibt: Meine Enkel sind
wie heiteres Wetter: Wo sie hintreten, ist es hell..
Wir sehen, daß Goethe nahezu sein ganzes Leben
auch mit Kindern verbringt. Trotz der intensiven
Anforderungen, die an ihn gestellt werden, hat er
Zeit für sie. Volker Hesse
73
Goethe ist sechs Mal in seinem Leben lebens-
bedrohlich erkrankt. Diese Lebenskrisen haben
ihn – das ist das Außergewöhnliche – jeweils tief
verwandelt und ihn geistiger und gereifter werden
lassen, oder, wie er es selbst nannte: Zu höherer
Gesundheit wiedergeboren.
Auch in Zeiten tiefer Depression und schwerer
körperlicher Beeinträchtigung arbeitet Goethe
durch Selbstbeherrschung und mit diszipliniertem
Fleiß und ist auch in solchen Phasen kreativ.
Seine seelischen Krisen, von denen es auch im
Alter viele gibt, bewältigt er durch Läuterung,
konsequente Bewußtmachung und Entsagung
und schließlich, dank seinem schöpferischen
Genie, durch dichterische Gestaltung.
So sagt er von sich selbst, daß er auch als alter
Mensch aus solchen Krankheits-Krisen gesund
und als ein neuer Mensch hervorgegangen ist, ob-
wohl die körperlichen Einschränkungen unverän-
dert vorhanden sind.
Beim alten Goethe stehen die Mäßigung und der
Verzicht, das Opfer und die Entsagung als For-
men der Selbstbewahrung immer im Mittelpunkt.
Bis ins hohe Alter hinein hat Goethe seine seeli-
schen Leiden und vor allem auch seine körperli-
chen Einschränkungen immer als Ansporn zur
Selbstbesinnung genutzt, um sich auf sich selbst
zurückzuziehen und sein Leben und Wesen zu
deuten. So entstehen bei ihm aus Perioden der
Einsamkeit und der Stille stets Phasen der schöp-
ferischen Neugestaltung in Form eines neuen
Kunstwerkes oder einer wissenschaftlichen
Abhandlung.
Goethe über Alter und Krankheit:
Motto von Dichtung und Wahrheit: Der
Mensch, der nicht geschunden wird, wird nicht
erzogen.
Im Tasso: …und wenn der Mensch in seiner Qual
verstummt, gab mir ein Gott zu sagen wie ich
leide.«
In Dichtung und Wahrheit: Genesung ist jedoch
immer angenehm und erfreulich, wenn sie auch
langsam und kümmerlich vonstatten geht und da
sich bei mir die Natur geholfen, so schien ich auch
nunmehr ein anderer Mensch geworden zu sein.
Denn ich hatte eine größere Heiterkeit des Geistes
gewonnen, als mir lange nicht bekannt, ich war
froh, mein Inneres frei zu fühlen, wenn mich gleich
ein langwieriges Leiden bedroht.
Goethe als 78-Jähriger an Kanzler von Müller:
Unser Leben kann sicherlich durch die Ärzte um
keinen Tag verlängert werden, wir leben, solange
es Gott bestimmt hat, aber es ist ein großer Un-
terschied ob wir jämmerlich wie arme Hunde
leben oder wohl und frisch und darauf vermag ein
kluger Arzt viel.
Joachim Wohlleben (Berlin)
Goethes Werther im Kontext seiner Zeit
Prof. Ekkehard Krippendorff (Berlin)
Gespräch über Peter Steins Faustinszenierung
PD Dr. med Klaus-Michael Koeppen (Berlin)
Goethes Schaffenskraft
als geriatrischer Patient
74
Goethe als 80-Jähriger: es ist unglaublich, wie-
viel der Geist zur Erholung des Körpers vermag.
Ich leide oft an Beschwerden des Unterleibes, al-
leine der geistige Wille und die Kraft des oberen
Teiles halten mich im Gange. Der Geist muß nur
dem Körper nicht nachgeben.
Resümee:
Welche Bedeutung kann das Leben eines dichte-
rischen Genies, das in reichlichem Ausmaß kör-
perliche und seelische Leiden durchgemacht und
überstanden hat, für unsere geriatrischen Patien-
ten haben?
Ganz wichtig scheint mir hervorzuheben, daß
Goethe auch in hohem Alter weiß und umsetzt,
wie man sich weiterhin immerfort verändern, er-
neuern und verjüngen muß, um nicht stehen zu
bleiben. Wie viele unserer alten geriatrischen
multimorbiden Patienten bleiben stehen, versto-
cken, können und wollen nicht in die Zukunft bli-
cken, beklagen nur ihre Leiden und erinnern sich
stets der guten alten Zeiten und der jüngeren
Jahre.
Goethe führt uns vor Augen, wie man auch in
Phasen seelischer und körperlicher Leiden durch
Anpassung an die physische Gegebenheit weiter
aktiv geistig und schaffend sich betätigen kann.
I m m e r ist Goethe tätig, bis ins hohe Alter führt
er Gespräche mit Altersgenossen, aber auch mit
der jüngeren Generation; er interessiert sich für
neue Tendenzen, sieht das künftige Zeitalter der
Technik herannahen, ahnt auch schon das Pro-
blem der drohenden Arbeitslosigkeit und interes-
siert sich für die Möglichkeiten des Auswanderns
nach Amerika.
Die lebhafte Anteilnahme auch des alten Goethe
an aktuellen politischen Ereignissen, etwa der
französichen Juli-Revolution von 1830, an aller-
neuesten Erfindungen wie der Eisenbahn oder
Entdeckungen, auch in anderen Teilen der Welt,
weiß er noch in seinem Alterswerk zu verarbei-
ten. Faust II, Dichtung und Wahrheit und Wilhelm
Meisters Wanderjahre – nicht umsonst mit dem
Untertitel Die Entsagenden versehen – zeigen
uns, wie ein starker Wille auch körperliche und
seelische Schwächen des Alters durchstehen
kann.
Insbesondere ist es bewundernswert, wie Goethe
bis in sein letztes Lebensjahr die Idee des Faust,
der ihn über 60 Jahre beschäftigt hat, durch die
Reife des Lebens und Alters gewandelt, doch
noch vollenden kann.
Bemerkenswert und bezeichned ist, wie sehr sich
Goethe bemüht, stets auf der Höhe seiner Zeit zu
bleiben. Durch seine konsequente, dem Leben zu-
gewandte Neugierde werden offenbar Kräfte frei-
gesetzt, die ihn seine körperlichen und seelischen
Leiden nicht nur ertragen lassen, sondern bei ihm
sogar noch schöpferische Kräfte freisetzen.
Auch wenn sich Goethe mit zunehmendem Alter
auf sich selbst zurückzieht und ungewollte Ein-
drücke der Außenwelt abwehrt, so können sein
dichterisches Werk und sein Leben uns auch in
heutiger Zeit Hinweise geben, wie man selbst im
hohen Alter trotz vieler Gebrechen ein geistig fri-
scher und körperlich tätiger Mensch sein und
bleiben kann.
Klaus-Michael Koeppen
75
76
Alle GG-Ortsvereinigungen, die als Gastgeber
schon einmal ein OV-Treffen ausgerichtet haben,
und auch all jene Vorstandsmitglieder, die bereits
ein Dutzend dieser Tagungen und mehr absolviert
haben, würden vermutlich nur müde abwinken,
würde ich jetzt hier einen ausführlichen Bericht
erstatten über die auf der Arbeitstagung behan-
delten Themen.
Vermutlich würde auch eine eingehende Schilde-
rung des kulturellen Begleitprogramms und der
abendlichen Festivitäten nach so langer Zeit
höchstens ein gelangweiltes Gähnen erzeugen.
Daher werde ich versuchen, es kurz zu machen
und nur die Aspekte betonen, die für künftige OV-
Treffen-Ausrichter von Interesse sein könnten.
Zunächst hier einmal in Stichworten die Arbeits-
tagung, deren Ablauf eigentlich jedem von uns
geläufig ist.
Dem einzigen davon existierenden Foto kann
man entnehmen, daß die Weimar-Abordnung zur
traditionellen Fraktion gehört, denn der Präsident,
Dr. habil. Jochen Golz, und die bewährte Leiterin
der Geschäftsstelle, Dr. Petra Oberhauser, reprä-
sentieren die Muttergesellschaft nunmehr seit den
späten 1990-er Jahren.
Prof. Dr.Volkmar Hansen (Düsseldorf) wurde in-
zwischen von Prof. Dr. Christoph Wingertszahn
abgelöst; der damalige Leiter des Goethehauses
Frankfurt, Dr. Christoph Perels (auf der Tagung
vertreten von Dr. Petra Maisak), wurde vor über
einem Jahrzehnt von Prof. Dr. Anne Bohnenkamp
abgelöst.
Auch bei den GG-Vorständen hat es im Laufe von
16 Jahren einige personelle Veränderungen gege-
ben, aber noch ist es – wie die diesjährige OV-
Tagung in München wieder gezeigt hat – wie
schon seit Jahrzehnten ein großes Familientreffen
der deutschen Goetheaner.
Freitag 27. 4.
9 Uhr, Senatssaal der Humboldt-Universität,
Beginn der Arbeitstagung,
Begleitprogramm: Stadtführung durch das historische
Berlin, die Friedrichstadt, Gendarmenmarkt, Nikolaiviertel;
15 Uhr, Dampferfahrt mit Kaffeetrinken,
20 Uhr, Konzert in der Deutschen Staatsoper: Fidelio /
(alternativ) 20 Uhr, Philharmonie, Nikolaus Harnoncourt:
Mozart und Haydn.
Samstag, 28.4.
9 Uhr, Senatssaal der Humboldt-Universität,
Fortsetzung der Arbeitstagung,
Begleitprogramm: Zwei Museumsführungen:
Pergamonmuseum / (alternativ) Gemäldegalerie,
16:30 Uhr, Vortrag im Plenarsaal des Deutschen Bundes-
tags sowie die Besichtigung der Kuppel im Reichstagsge-
bäude,
19:30 Uhr, Opernpalais Unter den Linden: Geselliger
Abend mit Buffet. Goethe-Vertonungen von Mozart, Reich-
hart und Schubert, Markus Ahme, Tenor, und Edwin Diele,
Klavier.
Jahrestagung der Ortsvereinigungen in Berlin
77
Sonntag, 29.4.
10 Uhr, Führung: Das neue Berlin
– Potsdamer Platz und Sony Center
12 Uhr, Treffen am Goethe-Denkmal im Tiergarten
mit Ansprache des Präsidenten,
anschließend im Haus Sommer neben dem Brandenburger
Tor Treffen mit Mitgliedern der Goethe-Gesellschaft Ber-
lin, Lesung: Ulrich Ritter: Goethes unsterbliche Geliebte
Resumé: Die Goethe-Gesellschaft Berlin veran-
staltete vom 26. 4. bis 29. 4. 2001 eine Jahresta-
gung mit insgesamt 144 Teilnehmern, von diesen
waren 129 zahlende Teilnehmer aus 52 deutschen
Ortsvereinigungen der Goethe-Gesellschaft in
Weimar e.V..
Die Tagung verlief erfolgreich, sämtliche Veran-
staltungen fanden mit großer Beteiligung statt;
die Organisation verlief reibungslos, die Kosten
blieben im Rahmen der veranschlagten Summen.
Hervorzuheben ist, daß die in Zusammenarbeit
mit der Stadtbibliothek konzipierte Ausstellung
Goethe- Berlin- Mai 1778, die erfolgreich bis
zum 6. 6. 2001 lief, nur aufgrund der Tagung
überhaupt zustande kommen konnte.
2001
Eröffnung der Ausstellung
Goethe ~ Berlin ~Mai 1778
Durch die Stadt und mancherley Menschen Gewerb
und Wesen hab ich mich durchgetrieben.
(An Charlotte von Stein, 17. Mai 1778)
Mitte Mai 1778 besucht Johann Wolf-
gang Goethe als Begleiter des Weima-
rer Herzogs Carl August die
Preußischen Residenzen. In Berlin war
er sechs Tage unterwegs, An- und Ab-
reise eingerechnet. Anlaß sind diplo-
matische Erkundungen im Hinblick auf
den zwischen Preußen und Österreich
drohenden Bayerischen Erbfolgekrieg.
Da er Tagebuch geführt und sich auch in Briefen
über seine Eindrücke geäußert hat, konnte der Aus-
stellungskurator Siegfried Detemple in der Alten
Staatsbibliothek recht genau nachvollziehen, wel-
ches Besuchsprogramm absolviert wurde, wen die
Gäste aus Weimar trafen, welche Sehenswürdigkei-
ten sie besuchten und was bei den Empfängen am
Hof geredet wurde, sofern das durch schriftliche Äu-
ßerungen überliefert ist.
Die Ausstellung blickt zunächst einmal zurück auf
die Situation in der preußischen Hauptstadt und gibt
auch Berliner Künstlern und Gelehrten das Wort, mit
denen Goethe in den folgenden Jahrzehnten in Ver-
bindung stand.
78
Gezeigt wird, wie Goethe schon vorher in Berlin be-
kannt geworden war, nämlich durch Aufführungen
von Götz von Berlichingen (Uraufführung) und Cla-
vigo, 1774, der Operette Erwin und Elmire, 1775,
und Stella (Uraufführung), 1776.
An seinen Tagebuchnotizen entlang führt die Schau
durch das friderizianische Berlin, macht bekannt
mit den Freunden, Gelehrten
und Künstlern, die er
aufsuchte, u. a. An-
ton Graff und Da-
niel Chodowiecki,
zeigt die Gebäude,
die er besichtigte, und
gibt eine Momentauf-
nahme der Stadt im Augenblick
der Mobilmachung.Zu sehen sind zeitgenössische
Gemälde, Radierungen, Stiche, Briefe und Doku-
mente aus den Sammlungen der Stiftungen Preußi-
scher Kulturbesitz und Preußische Schlösser und
Gärten Berlin-Brandenburg, dem Deutschen Histo-
rischen Museum und dem Gleimhaus in Halber-
stadt.
Viele Dokumente werden erst-
malig öffentlich ausgestellt, z.
B. der Briefwechsel, den Fried-
rich der Große Januar bis Au-
gust 1778 von Schlesien aus mit
seinem Bruder, dem Prinzen
Heinrich in Berlin, führte, Do-
kumente zu Friedrichs Kriegsvor-
bereitungen sowie eine in der
Staatsbibliothek gefundene Sammlung kolorierter
Kupfer mit einer vollständigen Übersicht über die
Uniformen der Preußischen Regimenter dieser Zeit.
Goethe besucht den einzigen Men-
schen, den er in Berlin persönlich
kennt: Johann André, Sohn
eines Offenbacher Seidenfabri-
kanten, erlernte zwar zunächst
den Handel, wandte sich aber
früh der Musik zu. Theaterdirek-
tor Döbbelin holte ihn 1777 nach
Berlin. Bis dahin hatte er bereits 18 Opern
und Singspiele komponiert. Die Bekanntschaft
geht zurück ins Jahr 1773, als Goethe sich mit dem
Gedanken trug, ein Singspiel für das Theater zu
schreiben und mit der Niederschrift von Erwin und
Elmire begann.
Auf seiner Rheinreise 1774 liest Goethe Lavater aus
seiner ersten Fassung vor; wenig später vertieft sich
die Verbindung zu André, als der 25-jährige Goethe
sich in Lili Schönemann verliebt, dasWerkchen in
wenigen Wochen zu Ende schreibt und André in
Offenbach dazu die Arien vertont. Im Mai 1775
wird es in Frankfurt von einer Liebhaberbühne mit
gutem Zuspruch des Publikums uraufgeführt.
Nach seinem Besuch bei Anton
Graff, dem hoch angesehenen
Portraitmaler des Hofes, ent-
schließt sich Goethe spontan zu
einem weiteren Besuch bei dem
Historiker Jacob Daniel Wege-
lin, da dieser zufälligerweise im
selben Haus wie Graff wohnt.
Wegelin ist Mitglied der Königlichen Akademie der
Wissenschaften und deren Archivar. Mit ihm unter-
hielt sich Goethe über die Philosophie der Geschichte
oder über dessen neuestes Projekt, seine 1779 veröf-
fentlichte Abhandlung über die psychologische Kunst
des Tacitus. Wegelin galt zwar als etwas umständlich
und weitschweifig, hatte aber ein unglaubliches his-
torisches Wissen, und er galt als einer der erster Ver-
treter der empirischen Geschichtsschreibung.
Fruchtbar für den 28-jährigen Goethe war das Ge-
spräch sicher, hatte er jedoch bereits zwei Jahre
zuvor in einem Brief an Merck angemerkt, er wolle
ausprobieren, wie einem die Weltrolle zu Gesicht
stünde.
Zunächst aus Anlaß einer
gemeinsamen Jahresta-
gung der Goethe-Gesell-
schaften geplant, fügt
sich die Ausstellung ein
in die Veranstaltungs-
reihe Preussen/2001.
Wegen der vielen Arbei-
ten Daniel Chodowie-
ckis, die zu sehen sein
werden, ist sie auch
eine kleine Reminis-
zenz an dessen Tod
vor zweihundert Jah-
ren, am 6.Februar 1801
Auf besonders gelungene Weise informiert über Goethes Berliner Aufent-
halt der Katalog zur Ausstellung Goethe-Berlin-Mai 1778 in der Staatsbi-
bliothek zu Berlin 2001 (Siegfried Detemple in Zusammenarbeit mit der
Goethe Gesellschaft Berlin e.V. anläßlich der Jahrestagung der Goethe-
Gesellschaften vom 26.-29.4. 2001).
79
2001 erscheint im Insel-Verlag eine
400 Seiten umfassende Biografie
über eine Frankfurter Bürgers-
frau namens Elisabeth; monate-
lang steht der dicke Wälzer auf
Nr. 1 der Sachbuch-Bestseller-
liste. Er trägt den Titel: Goethes
Mutter. Die Autorin: Unser Mit-
glied Dagmar von Gersdorff.
Grund genug für uns, umgehend bei ihr
anzufragen und das neue Jahresprogramm den
Frauen um Goethe zu widmen.
Die Autorin stützt sich nicht nur auf die bisher er-
schlossenen Quellen, sondern hat erstmalig die um-
fangreichen Haushaltsaufzeichnungen unter die
Lupe genommen, aus denen viel Aufschlußreiches
über das Leben im Haus am Großen Hirschgraben
hervorgeht.
Die nur 18 Jahre ältere Mutter, Elisabeth Catharina
Textor, ist die erste Frau in Goethes Leben und trägt
fraglos entscheidend dazu bei, daß er dem weib-
lichen Geschlecht Zeit seines Lebens nicht nur
Bewunderung, sondern auch großen Respekt zollt.
Das fröhliche, lebensbejahende Naturell der Mutter
sorgt für ein offenes Haus, in dem zahlreiche Besu-
cher aus- und eingehen. Goethe und seine
Geschwister, von denen nur die ältere Schwester
Cornelia das Erwachsenenalter erreicht, verleben
hier eine glückliche Kindheit. Insbesondere Wolf-
gang, ihr über alles geliebter Hätschelhans, wird
von der Mutter verwöhnt und häufig gegen den, um
20 Jahre älteren gestrengen Vater in Schutz genom-
men.
Das enge Verhältnis zur Mutter bleibt ein Leben
lang bestehen; aus den wenigen Briefen, die sich er-
halten haben – Goethe hat bei seinem umfangrei-
chen Autodafé 1792 fast sämtliche an ihn
gerichteten Briefe verbrannt – wird ersichtlich, daß
Mutter und Sohn enge Vertraute waren, die einander
so gut kannten, daß nur wenige Worte oder Andeu-
tungen nötig waren, um einander zu verstehen.
Nur wenig bekannt ist jenes Gedicht, das Goethe
mit 18 Jahren an Frau Aja richtet:
An die Mutter
Obgleich kein Gruß, obgleich kein Brief von mir /
So lang dir kommt /, laß keinen Zweifel doch
Ins Herz, als wär die Zärtlichkeit des Sohns,
Die ich dir schuldig bin, aus meiner Brust
Entwichen. (...)
Und dir bei jedem Blicke zeigt, wie dich dein Sohn verehrt.
Er habe Phantasie, Einbildungskraft und Formulie-
rungskunst von der Mutter, der brillanten Erzähle-
rin, geerbt, bemerkt Goethe in Dichtung und
Wahrheit, und auch die Besucher im Hirschgraben
sind oft überrascht, den Dichter ganz in ihr wieder-
zufinden.
Der dreijährige Leipziger Studienaufenthalt vermit-
telt dem jungen Goethe vielfältige Welt- und Selbst-
erfahrung. Insbesondere die Begegnung mit
Käthchen Schönkopf mit ihren Höhen und Tiefen
markiert eine neue Entwicklungsstufe. Josef
Mattausch geht dem anhand lebendiger, aussage-
starker Zeugnisse nach.
Als der 17-jährige Student im Herbst 1766 in Leip-
zig zu Studienzwecken eintrifft, nimmt er den Mit-
tagstisch im Gasthof des Weinhändlers Christian
Gottlieb Schönkopf, wo er alsbald die Tochter des
Hauses kennenlernt; Anna Katharina Schönkopf,
die dort gelegentlich aushilft.
Die Beziehung scheint allerdings
von Anfang an recht problematisch
gewesen zu sein, nicht zuletzt
wegen Goethes extremer Eifer-
sucht auf vermeintliche Neben-
buhler. Vertrauter in der
Beziehung zu Käthchen ist der
zehn Jahre ältere Ernst Wolfgang
Behrisch, Fachmann in allen Fragen
des galanten Lebens und der Poesie. Käthchen wird
allerdings der ständigen überschwenglichen Ge-
fühlsausbrüche und künstlichen Eifersuchtsdramen
bald überdrüssig. Als er sie nach
schrecklichen Szenen wirklich verlo-
ren hat, erscheint die Trennung im
Frühjahr 1768 unausweichlich.
Goethe kuriert sich von den durch-
gemachten Erschütternissen durch
das Schäferspiel Die Laune des Ver-
liebten, in dem ein eifersüchtiger
Liebhaber geheilt wird, als er erkennt,
2002
Die Frauen um den jungen Goethe
Autorenlesung:
Dagmar v. Gersdorff (Berlin)
Goethes Mutter und Schwester
Dr. Josef Mattausch (Leipzig)
Erleben und Fiktion
Goethes Jugendliebe Anna Katharina Schönkopf
80
Monika Schopf-Beige geht´s um Friedriken; aus
Platzgründen müssen wir hier leider zahlreiche
Details weglassen, aber die Willkommen-und-
Abschied-Geschichte ist ja doch allgemein ganz gut
bekannt.
In Dichtung und Wahrheit berichtet
Goethe später von seiner ersten
Begegnung mit Friederike: In
diesem Augenblick trat sie
wirklich in die Türe; und da
ging fürwahr an diesem ländli-
chen Himmel ein allerliebster
Stern auf. (…) Schlank und
leicht, als wenn sie nichts an sich
zu tragen hätte, schritt sie, und bei-
nahe schien für die gewaltigen blon-
den Zöpfe des niedlichen Köpfchens der Hals zu
zart.
Friederike wohnt sechs Reitstunden entfernt. Je
weiter weg, desto besser. Nichts entzündet
Goethes Phantasie mehr als das schwer Erreich-
bare. Er schreibt ihr leidenschaftliche Gedichte.
Bald ist sie sein Mädchen, dem er Hoffnung macht.
1770/1 entsteht eine Reihe von Gedichten und Lie-
dern, die er manchmal mit bemalten Bändern an die
Geliebte sendet. Die Sesenheimer Lieder gehören
maßgeblich zum Sturm und Drang und begründen
Goethes Ruf als Lyriker. Unter ihnen sind zum Bei-
spiel das Mailied, Willkommen und Abschied und
Das Heidenröslein.
Die Liebesbeziehung ist jedoch nicht von langer
Dauer. Schon im Frühsommer 1771 erwägt Goethe,
der seine unruhige Seele mit dem Wetterhähnchen
drüben auf dem Kirchturm vergleicht, die Bezie-
hung zu beenden. Am 7. August 1771 sieht er Frie-
derike vor seiner Heimkehr nach Frankfurt zum
letzten Mal: Als ich ihr die Hand noch vom Pferde
reichte, standen ihr die Tränen in den Augen, und
mir war sehr übel zumute.
Aus berufenem Munde, nämlich dem des Leiters
der Städtischen Sammlungen Wetzlar, Hartmut
Schmidt, der uns im Vorjahr bereits durchs Lotte-
haus geführt hat, erfahren wir, was wirklich ge-
schah in jenem Sommer 1772. Bekanntlich ist
vieles, was im Werther steht, erst 1½ Jahre später
zu Papier gebracht worden und lediglich Goethes
Phantasie entsprungen.
Goethe lernt Lotte, die Tochter des
verwitweten Wetzlarer Amtmanns
Buff, auf einem Tanzfest kennen.
Lotte bezaubert ihn sowohl durch
ihre äußerliche Er-
scheinung als auch
durch ihre offene
Art. Wie im Wer-
ther beschrieben,
tanzt er den ganzen
Abend mit ihr, und es imponiert
ihm sehr, wie Lotte die Festgesell-
schaft während des Gewitters mit
einem Spiel ablenkt.
Nicht nur mit Lottes Geschwistern versteht Goethe
sich bestens; selbst zu Albert, Lottes Verlobtem, hat
er nach dessen Rückkehr ein sehr gutes Verhältnis.
Dennoch belastet Goethe die Aussichtslosigkeit sei-
ner Beziehung so sehr, daß er Wetzlar vorzeitig
wieder den Rücken kehrt. Unfähig, Zuneigung und
Eifersucht zu zügeln, verläßt er nach einem brief-
lichen Abschied von beiden spontan die Stadt an der
Lahn. Erst als er 1½ Jahre später von dem Freitod
des gemeinsamen Wetzlarer Bekannten Jerusalem
erfährt, entscheidet er sich, das Lotte-Erlebnis lite-
rarisch zu verarbeiten.
Die Erstauflage des in
wenigen Tagen aufs
Papier gewühlten
Briefromans mit
dem Titel: Die Lei-
den des jungen
Werthers erscheint
1774 in einer ersten
Auflage von rd. 800
Exemplaren, vorsichts-
halber erst einmal
anoynym. Als Goethe
gewahr wird, daß er
damit den Nerv der Zeit
getroffen hat, bekennt
er sich als Autor.
Dr. Wolfgang Butzlaff (Kiel)
…einer einzigen angehören…
Goethes Verlobungen und Gelöbnisse
Monika Schopf-Beige (Ludwigsburg)
O Mädchen, Mädchen, wie liebe ich Dich…
Friedrike Brion
Dr. Hartmut Schmidt (Wetzlar)
So sei es denn, Lotte, Lotte lebe wohl!
Werthers Lotte – Wahrheit und Dichtung
81
Anna Elisabeth Schönemann geht in die
Literaturgeschichte als Goethes Ver-
lobte Lili ein. Sie ist die zweite Prota-
gonistin des Referats von Monika
Schopf-Beige, die uns faktenreich
auch diese nächste aussichtslose Be-
ziehung des jungen Advoka-
ten/Dichters schildert. Die
Tochter eines vermögenden
Frankfurter Bankiers lernt
Goethe im Frühjahr 1775 bei einem
Hauskonzert der Familie kennen. In
die musikalische Sechzehnjährige
verliebt er sich Hals über Kopf, ver-
lobt sich mit ihr nach nur wenigen
Wochen insgeheim, wie Goethe im 17.
Buch von Dichtung und Wahrheit schil-
dert, erwägt er sogar, mit ihr nach Amerika auszu-
wandern.
Beide stehen in einem eigenartigen Liebesverhältnis
zueinander, wie man ohne große Mühe aus Goethes
Gedicht Lilis Park herauslesen kann:
Ist doch keine Menagerie so bunt als meiner Lili ihre!
Sie hat darin die wunderbarsten Tiere
Und kriegt sie 'rein, weiß selbst nicht wie,
Die armen Prinzen allzumal,
In nie gelöschter Liebesqual!
Schon nach einem halben Jahr wird beider Ehe-
versprechen wieder gelöst, denn die Elternhäuser
stehen der Verbindung ablehnend gegenüber und
Goethe selbst empfindet Lili bald als Einengung
seiner Lebensplanung, will er doch der Einladung
des Herzogs Carl-August nach Weimar folgen.
Dennoch kann er Lili zeitlebens nicht vergessen
(wie in Dichtung und Wahrheit nachzulesen ist), hat
seinerzeit bei seiner ersten italienischen Reise sogar
ihr Konterfei in einem Medaillon um den Hals mit
über die Alpen genommen. Noch im Alter von 80
Jahren offenbart Goethe seinem Vertrauten Fried-
rich Soret Lili war die erste, die ich tief und wahr-
haft liebte, und vielleicht war sie auch die letzte.
Wie bereits im Goethe-Jahrbuch 103 sucht Otti
Lohss dem Wesen der tiefen Beziehung nach-
zugehen, die Goethe im ersten Weimarer Jahr-
zehnt mit Charlotte von Stein verbindet. Die
Eckdaten können ja wohl doch weitgehend als
bekannt vorausgesetzt werden.
Charlotte Albertine Ernestine Freifrau von Stein,
ist Hofdame der Herzogin Anna Amalia und ihre
enge Vertraute. Goethe lernt sie kurz nach seiner
Ankunft in Weimar im November 1775 kennen.
Die sieben Jahre Ältere ist verheiratet mit dem
Landedelmann Josias von Stein, dem Oberstall-
meister am Hofe. Sie hatte sieben Kinder mit ihm,
von denen noch drei leben, als Goethe sie kennen-
lernt. Die 1770 Briefe, Billette, Zettelgen und die
zahlreichen Gedichte, die Goethe an sie richtet, sind
die Dokumente einer außergewöhnlich innigen Be-
ziehung (Frau von Steins Briefe sind nicht erhalten).
Es wird darin deutlich, daß die Geliebte den Dichter
als Erzieherin fördert. Sie bringt ihm höfische Um-
gangsformen bei, besänftigt seine innere Unruhe
und stärkt seine Selbstdisziplin.
Fest steht nur, daß diese
Liebesbeziehung sowohl
für Goethe als auch für
Charlotte von Stein
von enormer lebens-
geschichtlicher Be-
deutung ist. Auch
kann es als nahezu
gesichert gelten, daß
Charlotte den Wunsch
von Goethe nach Sinn-
lichkeit, nach der der
Liebende auch immer wie-
der strebt, nicht zulassen kann.
Als Goethe 1786 heimlich zu einer fast zweijähri-
gen Reise nach Italien aufbricht, erleidet die Bezie-
hung einen tiefgreifenden Bruch. In Anbetracht von
Goethes Schweigen über sein Wegbleiben, wenigen,
schleierhaften Briefen von unbekanntem Ort und
ihrer Unkenntnis der für sie geschriebenen Reise-
tagebücher, wird die von ihr empfundene Frustra-
tion verständlich. Sie ist der Meinung, er habe sie
verlassen. Erst recht nicht verzeihen kann sie ihm
nach seiner Rückkehr die Liebesbeziehung zu der
um 25 Jahre jüngeren Christiane Vulpius.
Erst nach vielen Jahren gestaltet sich zwischen
beiden wieder ein gewisses Freundschaftsver-
hältnis, das bis zum Tode der Frau von Stein (1827)
andauert.
Monika Schopf-Beige (Ludwigsburg)
Herz, mein Herz, was soll das geben?
Lili Schönemann
Otti Lohss (München)
Kanntest jeden Zug in meinem Wesen…
Charlotte von Stein – Goethes Freundin
82
Die Herzogstochter und Nichte
Friedrichs des Großen heira-
tet als Sechzehnjährige den
zwei Jahre älteren Herzog
Ernst August Konstantin
von Sachsen-Weimar und
schenkt ihm zwei Söhne.
Als ihr Mann nach drei Jahren
stirbt, verwaltet Anna Amalia die
Regentschaft für ihren unmündigen
Sohn. In die Geschichtsbücher geht sie ein als
menschliche und sehr kunstsinnige Regentin, die ihr
Herzogtum mit einigem wirtschaftlichen Geschick
lenkte.
Neben ihren vielen offiziellen Pflichten pflegt Anna
Amalia die Künste; sie nahm Klavierunterricht, be-
gründete das deutsche Schauspiel in Weimar und
kann auch als eigentliche Initiatorin der Weimarer
Museen bezeichnet werden. Sie sammelte einen
Kreis wichtiger Musiker und Dichter wie Herder,
Wieland und Goethe um sich.
Friedmar Apel nimmt Corona Schröter und ihr
besonderes Verhältnis zu Goethe in den Fokus. Die
Sängerin, Schauspielerin und Komponistin wird ab
November 1776 auf Goethes Betreiben zur viel-
beschäftigten und bewunderten Sängerin der
Weimarer Hofkapelle. Sie ist vielseitige professio-
nelle Darstellerin und als solche die Hauptstütze
von Goethes Liebhaberaufführungen, eine fertige
Klavier- und Flötenspielerin, gewandte Gesell-
schafterin sowie künstlerisch und literarisch
ambitioniert. 1779 findet die erste Auf-
führung der Iphigenie mit Corona in
der Titelrolle und Goethe als Orest
statt, auch der Herzog wirkt mit.
Corona Schröter wird zu ihrer
Zeit auch als Liederkomponistin
gefeiert; vertont sie doch u.a.
auch Goethes Erlkönig.
Die Beziehung zwischen Goethe
und der Schauspielerin Corona
Schröter ist nach wie vor geheimnis-
voll. Unzweifelhaft aber scheint, daß sowohl
der Herzog als auch Goethe sich um sie bemühen.
Der Dichter aber entziffert an ihr spiegelbildlich
die Problematik des Künstlers im Dienst der
Macht.
Das ist auch ein Thema der Iphigenie. Auffallend
oft sagt Iphigenie im Eingangsmonolog »hier«.
So konnte das Stück dem Weimarer Publikum die
Selbstbehauptung des Künstlers der Obrigkeit
gegenüber vor Augen führen.
Prof. Dr. Friedmar Apel (Bielefeld)
und selbst Dein Name ziert, Corona, Dich...
Iphigenie in Weimar
Eckart Henscheid (Berlin)
Frauen unter Goethe (Lesung)
Dr. Franziska Schöffler (Freiburg i.B.)
Lehrjahre
Frauengestalten im Wilhelm Meister
83
Das Jahr beginnt mit einem Lichtbildervortrag im
Literaturhaus, in dem uns Siegfried Seifert die
Weimarer Primadonna Karoline Jagemann vorstellt.
Sie ist ein Weimarer Kind. Der Vater, Bibliothekar
der Herzoginmutter, sorgt 1790 dafür, daß die
Stimme seiner 13-jährigen Tochter Karoline am
berühmten Mannheimer Nationaltheater unter Iff-
lands strenger Leitung die gründlichste Ausbildung
erfährt. sechs Jahre später kehrt sie nach Weimar
zurück, nun eine Sängerin und Schauspielerin,
deren Sprechen so melodisch und geistreich akzen-
tuiert ist, wie ihr Gesang einem Nachtigallenton
gleicht, voll Süße, Rundung und Kraft.
Seiner Lehre, so Goethe 1824 zu Eckermann, habe
sie nie bedurft. Sie sondere klug die Charaktere und
bilde jede Einförmigkeit meidend, die eigene Indi-
vidualität der dichterischen Figur gemäß um«. Sie
sei »wie auf den Brettern geboren, in allem sicher
und entschieden, gewandt und fertig wie die Ente
auf dem Wasser gewesen.
Sie ist unbedingt ein
Gewinn für Weimars
Bühne, doch auch ein
Problem für einen In-
tendanten wie Goethe,
der selbst von der gro-
ßen Begabung den
Willen zur Einord-
nung in das Ensemble
erwartet. Karoline
aber neigt weder zur
Bescheidenheit noch
zur Selbstunterschät-
zung.
Die Situation verschärft sich, als sie dem jahrelan-
gen leidenschaftlichen Werben Carl-Augusts nach-
gibt und 1802, nachdem sie sicher sein kann, daß
Herzogin Luise großmütig zustimmt, in eine Ver-
bindung einwilligt, die sie als Nebenfrau an Carl
Augusts Seite rückt. Goethe sieht sich plötzlich mit
einer Primadonna konfrontiert, gegen die er nur
mühsam seinen Willen behaupten kann.
1809 legalisiert Carl August zudem den Bund mit
Karoline und deren Nobilitierung zu einer Frau von
Heygendorf. Noch im selben Jahr ernennt der Her-
zog sie zur Operndirektorin. Sie übernimmt, nach-
dem sie gegen Goethe intrigiert und 1817 dessen
Rückzug aus dem Theaterbetrieb bewirkt hat, die
alleinige Leitung des Hoftheaters. Als 1823, zur
Feier von Goethes Genesung von einer schweren
Herzerkrankung Tasso gegeben wird, krönt sie statt
Vergils Goethes Büste mit Lorbeer und bringt am
Ende der Aufführung, noch im Kostüm ihrer Rolle,
den Kranz dem Dichter.
Eckart Kleßmann, ausgewiesener Kenner der
Goethezeit, bereitet gerade ein Buch vor mit dem
Titel: Christiane – Goethes Geliebte und Gefährtin
und gewährt uns vorab schon einmal einen Einblick
in seine Recherchen. Zahlreich sind die überkom-
menen Klischees über Goethes langjährige Lebens-
gefährtin und spätere Ehefrau, die zunächst von der
Weimarer Gesellschaft, später von Generationen
von Literaturhistorikern als Bettschatz und Dumm-
chen tituliert wurde.
Mit dem schönen Elan der
Sympathie entwirft Kleß-
mann ein gerechteres
Bild der jungen Frau,
die mehr ist als die
sinnliche Geliebte,
die umsichtige Wirt-
schafterin und sor-
gende Mutter: für
Goethe ist sie die
unvergleichlich e
Partnerin im Reich
der guten Täglichkeit,
deren Liebe er mit Liebe
erwidert und für deren
Wärme er mit Wärme dankt,
des dauerhaften Vergnügens, das
sie ihm beschert, niemals überdrüssig.
Kleßmann geht es darum, durch eine Auswahl von
Urteilen und Briefen zum einen den Charakter
Christianes für uns schärfer zu konturieren sowie
zum anderen zu umreißen, wo und wie wir der lang-
jährigen Lebensgefährten Goethe in seinem Werk
wiederbegegnen.
2003
Die Frauen um den älteren Goethe
Siegfried Seifert (Weimar)
Goethes schöne Freundin?
Die Weimarer Primadonna Karoline Jagemann
(Dia-Vortrag)
Eckart Kleßmann (Hamburg)
Mein Liebchen Du…
Christiane Vulpius im Urteil der Zeitgenossen
und in Goethes Briefen und Gedichten
84
Dem Gedicht Gingko
biloba und seiner Ent-
stehunggeschichte.wid-
met sich Theo Buck.
Das Gedicht ist Mari-
anne von Willemer ge-
widmet und stellt das
Ginkgoblatt aufgrund
seiner Form als Sinnbild
der Freundschaft dar.
Die Erstfassung des Ge-
dichts ist datiert auf den
15. September 1815, als
Goethe während eines
fünfwöchigen Aufent-
haltes in Frankfurt dort
mehrmals mit Marianne
von Willemer am Main-
ufer verabredet ist. Er
wohnt sogar eine Woche im Roten Männchen, der
Willemerschen Stadtwohnung, die übrige Zeit in
der Gerbermühle.
Überliefert ist, daß Goethe die Blät-
ter des Ginkgo betrachtet und über
deren Form sinniert habe. Eines der
Blätter sendet er schließlich als
Ausdruck seiner Zuneigung an Ma-
rianne. Der mit Goethe befreundete
Kunstsammler und Schriftstel-
ler Sulpiz Boisserée erwähnt in
einer Tagebucheintragung vom 15.
September 1815: Heiterer Abend.
G. hat der Willemer ein Blatt des
Ginkgo biloba als Sinnbild der
Freundschaft geschikt aus der
Stadt. Man weiß nicht ob es eins das sich in 2 theilt,
oder zwey die sich in eins verbinden. So war der In-
halt des Verses.
Im Juni ist Katharina Mommsen, Expertin in Sa-
chen Divan, aus Palo Alto wieder einmal über den
Großen Teich gekommen und widmet sich in ihrem
Vortrag der Dichterin Marianne von Willemer.
Eine eingehende wissenschaftliche Beschäftigung
mit diesem Thema schien sich bisher weitgehend zu
erübrigen. Fast ausnahmslos werden die Gedichte
aus Mariannes Feder Goethe zugerechnet, in dessen
Divan sie sich so nahtlos einfügen; apostrophiert als
Goethes Suleika, erscheint sogar die Verfasserin
selbst als Goethes Geschöpf, als Dichterin allein
von Goethes Gnaden, aus deren Mund letztlich das
Genie selber spricht.
Dabei ist die Tatsache, daß Marianne einige Ge-
dichte zu Goethes großem Spätwerk beigetragen hat
seit 1869 durchaus bekannt, zumindest der Goethe-
Forschung. Ihr großes Geheimnis wurde allerdings
erst neun Jahre nach ihrem Tod ver-
öffentlicht. In einem Gespräch mit
dem Schriftsteller und Kunsthistori-
ker Herman Grimm, dem Sohn des
Märchensammlers Wilhelm Grimm,
bekennt sie sich dazu, als Suleika
dem Dichter auf seine Verse mit ei-
genen Gedichten geantwortet zu
haben.
Katharina Mommsen: In der Litera-
tur über Marianne von Willemer ist
es üblich, ihre Gedichte, soweit es
sich nicht um die des Buchs Suleika handelt, als
schwach zu kennzeichnen und als bloße Gebrauchs-
lyrik abzuwerten. Wie es scheint, hat sie selbst
durch die für sie charakteristische große Beschei-
denheit zur Unterbewertung ihres dichterischen Ta-
lents beigetragen. Bezeichnend für ihre Demut,
beginnt auch ihr erstes an Goethe gerichtetes Ge-
dicht mit dem Vers:
Zu den Kleinen zähl ich mich,
Liebe Kleine nennst Du mich.
Willst Du immer so mich heißen,
Werd ich stets mich glücklich preisen,
Bleibe gern mein Leben lang
Lang wie breit und breit wie lang.
Als den Größten kennt man Dich,
Als den Besten ehrt man Dich,
Sieht man Dich, muß man Dich lieben,
Wärst Du nur bei uns geblieben,
Ohne Dich scheint uns die Zeit
Breit wie lang und lang wie breit.
Dadurch gibt sie sich selbst auf den ersten Blick
einen fast schulmädchenhaften Anstrich. Doch wenn
man die Verse genauer betrachtet, so entdeckt man,
daß sie bei aller äußeren Einfachheit von unüber-
windbarem Raffinement sind.Das konnte allerdings
nur Goethe gewahr werden, während sich die übrigen
Leser durch den naiven Ton täuschen ließen.
Prof. Theo Buck (Aachen)
…sind es zwei, die sich erlesen...
Mariannne von Willemer und Goethe
im Spiegel des Gedichtes Gingko biloba
Prof. Dr. Katharina Mommsen (Palo Alto)
Zu den Kleinen zähl ich mich…
Die Dichterin Marianne von Willemer
85
Im März setzt uns Hans-Hellmut
Allers ins Bild über Goethes Verhält-
nis zu Bettine Brentano, der exzen-
trischen Tochter seiner Jugendliebe
Maximiliane, die stirbt, als Bettine
acht Jahre alt ist. Der Vortrag setzt
ein bei der Großmutter Sophie La
Roche, schildert die Freundschaft
der jungen Bettine mit Goethes
Mutter, deren Erzählungen aus der
Kindheit des Dichters letztendlich Goe-
the zur Niederschrift seiner Autobiografie anregen.
Als Bettine in Begleitung von Schwester und
Schwager Savigny Goethe das erste Mal in Weimar
gegenübertritt, ist sie 22 Jahre jung; er ist 57 Jahre
alt und seit sechs Monaten mit Christiane verhei-
ratet.
Was folgt, ist allgemein bekannt: Bettines zahlreihe
Briefe an ihn; seine meist spärlichen und recht sprö-
den Antworten; mehrere Begegnungen; ihre Verlo-
bung mit Achim von Arnim; ihr beharrliches Vor-
schlagen eines Treffens zwischen Goethe und Beet-
hoven, die sich ohne ihre Vermittlung vielleicht nie
persönlich begegnet wären; schließlich der vielfach
kolportierte Streit zwischen ihr und Christiane
– Bettine äußert sich hochmütig und abfällig über
die Werke vom Kunschtmeyer; Christiane reißt ihr
daraufhin die Brille von der Nase, worauf Bettine
sie bekanntlich eine wahnsinnige Blutwurst nennt.
Goethe erteilt ihr Hausverbot; es wird ein endgülti-
ger Bruch sein. Dem Referenten gelingt es, in der
restlichen halben Stunde Bettines Familienleben zu
schildern, ihr späteres soziales Engagement in Ber-
lin und einzugehen auf den von ihr nach Goethes
Tod veröffentlichten überwiegend fingierten Brief-
wechsel mit einem Kinde. Als Epilog sodann die
kurze Schilderung ihres Entwurfs für ein Goethe-
Denkmal: Dieses zeigt ihn als thronenden Olympier
gehüllt in eine griechische Toga mit nacktem Ober-
körper, in der Hand eine Lyra.
Viel ist schon über Bettine geschrieben worden,
deshalb faßt der Vorstand den Entschluß, Hans-
Hellmut Allers' Vortrag über Goethes Verhältnis zu
Bettine als Jahresgabe zu publizieren, der eine
Reihe weiterer aus seiner Feder folgen werden.
Im Oktober spricht der Historiker Detlef Jena, Ex-
perte für die napoleonische Ära, und bringt uns die
Zarentochter Maria Pawlowna näher, indem er sie
im historischen, geistigen, politischen und räumli-
chen Kontext zeigt und daher auch ihr Verhältnis zu
Goethe sehr lebensnah mit Kolorit versieht.
Wir lernen viel an diesem Abend: Die russische
Großfürstin Maria Pawlowna, Enkelin Katharina
der Großen, Tochter des unglückseligen, 1801 von
einer Adelsclique erdrosselten Zaren Paul, Schwes-
ter der Zaren Alexander und Nikolaus und spätere
Schwiegermutter des deutschen Kaiser Wilhelm I.,
heiratet 1804 den Erbherzog von Sachsen-Weimar-
Eisenach, Carl Friedrich. Vom weltstädtischen Ve-
nedig des Nordens – St. Petersburg – kommt die
18-jährige in das kleine, provinzielle, aber geistig
und literarisch hochgerühmte Weimar.
Maria Pawlowna, die neben Rus-
sisch und Französisch Deutsch,
Englisch und Italienisch
spricht, identifiziert sich mit
der Weimarer Klassik, verehrt
und unterstützt insbesondere
Goethe und Liszt und ruft eine
einmalige Symbiose von
Musik, bildender Kunst, Archi-
tektur und Dichtung ins Leben.
Zunehmend entwickelt sie sich zur sozial und
karitativ engagierten, lebenspraktisch orientierten
Landesmutter und setzt sich landesweit für eine
elementare Bildung und Ausbildung insbesondere
für Frauen und Kinder ein. Goethe zu Eckermann:
Ich kenne die Großfürstin seit dem Tage ihrer An-
kunft und habe in Menge Gelegenheit gehabt, ihren
Geist und Charakter zu bewundern. Sie sei eine der
besten und bedeutendsten Frauen ihrer Zeit und
würde es auch sein, wenn sie keine Fürsten wäre.
Und er fährt fort: Für dieses Land ist sie von jeher
wie ein guter Engel gewesen und wird es mehr und
mehr, je länger sie mit ihm verbunden ist.
Hans-Hellmut Allers (Berlin)
Du wunderliches Kind
Bettine von Arnim und ihre Beziehung zu Goethe
Prof. Detlev Jena (Eisenberg/Jena)
Die sehnlichst Erwartete
Goethes Verhältnis zur Großfürstin
Maria Pawlowna
Dr. Heike Spies (Düsseldorf)
Mariane, Philine, Aurelie….
Die Frauengestalten in Goethes Roman
Wilhelm Meisters Lehrjahre
86
Im November widmet sich
Klaus- Michael Koeppen
Goethes letzter Liebe, Ulrike
von Levetzow, und erläutert
dem Publikum, warum Goethe
1823 am Herzen erkranken
mußte, und daß dies ein gera-
dezu klassisches Beispiel von
psychosomatischen Leiden dar-
stelle.
Den Reigen beschließt im Dezember Monika
Schopf-Beige mit einem faktenreichen Vortrag über
Goethes Schwiegertochter. Diese, geborene Ottilie
von Pogwisch, lebt allein bei der Mutter und Groß-
mutter, einer geborenen Henckel von Donners-
marck. Von Zeitgenossen wird sie beschrieben als
klein und zierlich, sie hat ausdrucksvolle blaue
Augen, schönes Haar und kann gewandt plaudern;
sie singt, zeichnet, ist gefühlvoll und früh gewitzt,
gelehrig, begeistert sich für Byron, hat Freude am
Theater und dichtet auch ein wenig.
Goethe setzt große Hoffnungen in diese junge Frau,
um die sein Sohn August wirbt. Schließlich ent-
schließt sie sich im Juni 1817, also ein Jahr nach
Christianes Tod, mit knapp 21 Jahren nach einigem
Widerstreben die Frau August von Goethes zu wer-
den, doch vor allem die Schwiegertochter des
Weimarer Dichterfürsten.
In der Mansardenwohnung am Weimarer Frauen-
plan ist sie wohl mehr die mit dem berühmten Dich-
ter geistvoll plaudernde Schwiegertochter als die
sich dem Ehemann August liebevoll widmende
Gattin, dem sie immerhin drei Kinder gebärt:
Walther Wolfgang (1818), Wolfgang Maximilian
(1820) und das 1827 geborene Nesthäkchen Alma.
Während Ottilie sich neben dem Schwiegervater zu
behaupten weiß, ist August eher eine fatale Rolle
zugeteilt: Der Vater hat ihn herangezogen, damit er
Goethes Geschäfte verwaltet; für ihn die Honorar-
verhandlungen mit den Verlegern führt und über-
haupt alles übernimmt, was Goethe von seinen
wichtigen Hauptgeschäften, seinen Korresponden-
zen und seinem dichterischen Tun abhält.
Dies erfüllt er zwar alles zur Zufriedenheit des
Vaters, doch Ottilie entgeht dieser etwas entwürdi-
gende Status des Ehemanns quasi als Haushofmei-
ser am Frauenplan keinesfalls und das läßt sie
August auch spüren. Die Ehe ist alles andere als
harmonisch.
15 Jahre lang wird sie nun die
nächste Mitbewohnerin des
Dichters. Rasch entwickelt
sich die geistreiche Schwie-
gertochter zum Anziehungs-
punkt der internationalen
Gästeschar des alten Goethe.
1829 gründet sie die Zeit-
schrift Chaos, in der neben
Goethe und den Weimarer Freun-
den auch zahlreiche berühmte Zeitgenossen vertre-
ten sind.
Nach zwölf Ehejahren projiziert Ottilie ihre uner-
füllte Liebessehnsucht auf den neunzehnjährigen
Iren Charles James Sterling, der Goethe im Auftrage
Lord Byrons besucht.
Sterling bleibt ein Jahr lang in Weimar; zur selben
Zeit, da der 74-jährige Goethe seine Marienbader
Affäre mit Ulrike von Levetzow hat, bahnt sich zwi-
schen Ottilie und Sterling eine von Ottilie leiden-
schaftlich betriebene Beziehung an.
Dennoch erfüllt sie weiterhin ihre Pflichten als Mut-
ter und Schwiegertochter. Augusts Alkohol-
probleme und Ottilies Liebschaft belasten die Ehe
allerdings bald so schwer, daß August sich zu einer
Reise nach Italien entschließt, wo er 1830 in Folge
eines Nierenversagens stirbt.
Nach seinem Tod lebt Ottilie weiterhin bei ihrem
Schwiegervater; obwohl sie sich gelegentlich von
Goethe überfordert fühlt, gehört er, den sie liebevoll
Vater nennt, zu den wenigen stabilen Größen in
ihrem Leben.
Als Goethe 1832 stirbt, verfügt er in seinem Testa-
ment, daß an Ottilie eine Rente auf Lebenszeit nur
unter der Prämisse ausgezahlt wird, daß sie von
einer erneuten Heirat absieht.
Dr. Klaus-Michael Koeppen (Berlin)
Keine Liebschaft war es nicht
Ulrike von Levetzow –
Traum oder Wirklichkeit?
Monika Schopf-Beige (Ludwigsburg)
Was Du mir als Kind gewesen,
was Du mir als Mädchen warst
Ottilie von Goethe
87
Zum Auftakt führt uns Werner Busch Goethes Ver-
hältnis zur bildenden Kunst vor Augen. Seine ersten
bewußten Kunsteindrücke: Die Gemälde der zeit-
genössischen Frankfurter Malerschule deren Land-
schaften der Vater sammelt. Noch mehr
beeindrucken ihn die Renaissance-Kupferstiche im
Treppenhaus, die über drei Jahrzehnte seine Vor-
stellung von Rom prägen werden.
Der Leipziger Student nimmt Un-
terricht beim Kupferstecher
Adam Friedrich Oeser, doch mit
der arabesken Formensprache
des Rokoko vermag er wenig
anzufangen. Es folgt die Straß-
burger Sturm- und-Drang-Zeit,
in der der Zweiundzwanzig-
jährige den Aufsatz Von deut-
scher Baukunst verfaßt, in dem er
über die gotische Bauweise des
Münsters und seiner Details reflektiert.
Den entscheidenden Einschnitt markiert die Italien-
reise. Die dort gewonnenen Eindrücke werden
Goethes Kunstideal für die nächsten Jahrzehnte
prägen. An den aus der Geschichte der Antike und
der Renaissance gewonnenen Vorstellungen des
Menschenbildes, der Architektur- und Naturdarstel-
lung richtet Goethe nun seine kunsterzieherischen
Bemühungen in den nächsten Jahren aus. Sie prä-
gen in der Zeit um 1800 auch seine aktive Einfluß-
nahme gegen die Romantiker;
Erst im letzten Drittel seines Lebens – nach der
durch Sulpiz Boisserée herbeigeführten Wiederbe-
gegnung mit Motiven der altdeutschen Malerei –
wird Goethe versöhnlicher anderen Kunstauf-
fassungen gegenüber gestimmt. Sein hohes künst-
lerisches Schönheitsideal – die harmonische
Verbindung des Menschen mit der Natur – bildet
das Leitthema seiner Sammlung von über 17.000
Graphikblättern.
Im Februar gibt uns Hans-Hellmut Allers einen
detaillierten Einblick in das Bühnengeschehen hin-
ter den Kulissen des Weimarer Theaters, dessen
Leitung Goethe über 25 Jahre innehat. Von beson-
derem Interesse ist für viele Zuhörer auch die enge
Verbindung zu den Berliner Bühnen, die der Dra-
matiker, Intendant und Spieleiter Goethe Zeit seines
Lebens sucht.
Goethe steht mit Iffland, Devrient und vielen ande-
ren in engem Briefkontakt und läßt sich später
regelmäßig von seinem vertrauten Freund Zelter
berichten, wie das Publikum auf welche Inszenie-
rungen reagiert habe.
2004
Goethe und die Künste
Prof. Dr. Werner Busch (Berlin)
Goethe und die Künstler
Hans-Hellmut Allers (Berlin)
Erlaubt ist, was gefällt
Der Theaterleiter Goethe
Prof. Dr. Katharina Mommsen (Palo Alto)
vielleicht die kultivierteste Frau in Europa
Die Malerin Angelica Kauffmann
Michael Engelhard (Bonn)
Nichts Höheres, nichts Vollkommeneres…
Goethe und Palladio
Gottfried Eberle (Berlin)
Symbolik fürs Ohr
Goethe und die Musik
Prof. Dr. Ernst Osterkamp (Berlin)
Goethe als Leser
Johann Joachim Winckelmanns
88
89
Im italienischen Tagebuch (für Charlotte von Stein)
heißt es unter dem Datum 19. Oktober 1786: Zwey
Menschen, denen ich das Beiwort groß, ohnbedingt
gebe, habe ich näher kennen lernen: Palladio und
Raphael. Es war an ihnen nicht ein Haarbreit Will-
kürliches, nur das sie die Grenzen
und Gesetze ihrer Kunst im
höchsten Grade kannten und
mit Leichtigkeit sich darin
bewegten, sie ausübten,
macht sie groß!
Michael Engelhard bringt
uns rhetorisch beeindru-
ckend und kenntnisreich den
führenden Baumeister der
norditalienischen Renaissance
näher. Dessen Schriften mit Grundris-
sen und Stichen der antiken Tempelbauten erwirbt
Goethe in Padua und macht sich auf den Weg nach
Rom, dessen klassische Bauten er nun durch die
Augen Palladios zu sehen beginnt: Jetzt studier ich
das Buch und es fallen wie Schuppen von den
Augen, der Nebel geht auseinander und ich erkenne
die Gegenstände.
Im Mai ist zur Abwechslung die Musik an der
Reihe. 50 Mitglieder lauschen Gottfried Eberles
Ausführungen, betitelt Symbolik fürs Ohr in der
Dahlemer Geschäftsstelle. Wir erfahren viel Neues
und Wissenswertes über Goethes Verhältnis zur
Musik, im Besonderen zu zeitgenössischen
Musikern wie Mozart, Beethoven und Schubert, zu
Reichhardt und Zelter, der ihn in Weimar mit dem
jungen Felix Mendelssohn-Bartholdy bekannt
macht.
Eberle, jahrzehntelang Musikredakteur beim RIAS,
reichert seinen faktenreichen Vortrag immer wieder
mit Musikbeispielen am Klavier an, einprägsam er-
gänzt durch die junge Nachwuchssopranistin Ute
Eckert, die unter einem Zelter-Gemälde Vertonun-
gen Goethischer Gedichte vorträgt, neben den Ever-
greens Veilchen, Erlkönig, Rattenfänger und Wer
nie sein Brot mit Tränen aß eben auch solche, die
man nicht alle Tage zu hören bekommt.
Zur Einstimmung auf die
Schweizer Reisen reist in der
ersten Augusthälfte Jochen
Klauss aus Weimar an, um
uns über das Verhältnis Goe-
thes zum Künstlerfreund
Heinrich Meyer zu unterrich-
ten. Diesen hatte Goethe
1786 in Rom kennen und
bald als unentbehrlichen Rat-
geber schätzen gelernt. 1791 zog der Kunschtmeyer
ins Haus am Frauenplan mit ein, dessen Ausgestal-
tung Goethe dem Freund während seiner durch die
Teilnahme an den Feldzügen von Valmy und Mainz
bedingten Abwesenheit überläßt. 1795 überträgt
ihm Goethe die Leitung der Freien Zeichenschule.
Den Zeitgenossen ist ein wenig unverständlich,
warum Goethe sich ausgerechnet auf das Urteil die-
ses als Maler eher mittelmäßig talentierten Schwei-
zer Kunsthistorikers offenbar blindlings verläßt.
Relativ wenig schriftliche Zeugnisse von Dritten
sind überliefert, aus denen sich ein Charakterbild
Meyers ergibt. Goethe schätzt diesen kunstsinnigen
Hausgenossen so sehr, daß er einmal äußert: Wenn
er stirbt, so verlier ich einen Schatz, den wiederzu-
finden ich für das ganze Leben verzweifle. Meyer
hielt sich daran und überlebte Goethe um wenige
Wochen.
Im September beschert uns Hans-Wolfgang Kend-
zia neue Erkenntnisse über Goethes Portraitisten.
Zu Goethes Lebzeiten entstehen über 80 Portraits,
Schattenrisse, Bleistift-, Sepia-, Kreide- und Tusch-
zeichnungen, Radierungen, Kupferstiche, Minia-
turen sowie Reliefs, Skulpturen und mehr als ein
Dutzend Ölgemälde.
Der Vortragende konzen-
triert sich notabene auf
jene Portraits des Dich-
ters, die Goethes Natur
und seinem Wesen wohl
am nächsten kommen: die
Bleistiftzeichnung des
26-Jährigen etwa von
Georg Melchior Kraus;
Martin Gottlob Klauers
Büste von 1790, ferner die Altersbildnisse Heinrich
Kolbes und Joseph Karl Stielers und die Büste
Christian Daniel Rauchs. Interessantes ist zu erfah-
ren über Goethes Verhältnis zu seinen Portraitisten
und ihren »Hervorbringungen«, von denen er nur
den geringeren Teil gelten ließ.
Mit der ihm eigenen kunsthistorischen Kompetenz
und Detailkenntnis referiert Helmut Börsch-
Suphan über das Verhältnis Goethes zu dem Berli-
ner Architekten und Maler Karl Friedrich Schinkel,
den er persönlich erst 1816 kennenlernt.Vier Jahre
später trifft man sich in Jena, wo Schinkel ihm die
Pläne für sein neues Schauspielhaus in Berlin zeigt,
die bei Goethe auf großes Interesse stoßen, ent-
spricht doch die Art, wie der um 32 Jahre Jüngere
die griechische Baukunst den Bedürfnissen eines
modernen Theaters anzupassen versteht, ganz sei-
nem eigenen Kunstideal.
In seinen Annalen verzeichnet er:
...eine lebhafte, ja leidenschaftli-
che Kunstunterhaltung und ich
durfte diese Tage unter die
schönsten des Jahres rechnen.
Dr. Jochen Klauss (Weimar)
Wenn er stirbt, so verlier ich einen Schatz...
Johann Heinrich Meyer,
Goethes Künstlerfreund
Hans-Wolfgang Kendzia (Berlin)
Goethes Portraitisten
und sein Verhältnis zu ihnen
Dr. Helmut Börsch-Suphan (Berlin)
Mögen wechselseitige Zeugnisse dieses
glückliche Verhältnis immerfort beleben…
Goethe und Schinkel
90
Neue Einsichten bieten auch die Ausführungen
Norbert Millers über den Zeichner Goethe, in
denen er sich auf die Begegnung des Dichters mit
Jakob Philipp Hackert konzentriert, dem wohl
berühmtesten Landschaftsmaler seiner Zeit.
Goethe, der zuvor mehr oder minder als Autodidakt
...doch nicht ganz ohne Talent Thüringer Berge und
Burgen aufs Papier gestrichelt hat, geht nun hier
noch einmal in die Schule und studiert Kompositi-
onslehre- und Ausführung. Hackert verachtet den
bloßen Kunst-Enthusiasmus der Dilettanten; die
flüchtig schraffierte Impression ist ihm ebenso är-
gerlich wie die durch heftige zum Ereignis drama-
tisierte Naturansicht. Sein Credo Die Natur trägt
die Schönheit in sich macht Goethe sich zu eigen,
muß sich freilich alsbald eingestehen, daß der eige-
nen gestalterischen Begabung hier Grenzen gesetzt
sind.
Im Dezember schließt
sich der thematische
Reigen mit Manfred
Koltes Vortrag über
Das Verhältnis der
Gebrüder Boisserée
zu Goethe. Bevor wir
jene Baurisse des
noch unfertigen Köl-
ner Doms zu sehen
bekamen, mit denen
der Kunstsammler
Sulpiz Boisserée 1810 Goethe an den Rhein zu
locken versuchte, gab es erst einmal Außen-und
Innenansichten des Weimarer Goethe-Schiller-
Archivs zu sehen.
Dort nämlich befinden sich die Briefe Sulpiz Bois-
serées an Goethe, die – wie seit kurzem der gesamte
übrige Goethe-Bestand – von Manfred Koltes be-
treut werden. Erstaunt nehmen wir zur Kenntnis,
daß dem jungen Rheinländer häufig so das Herz
übersprudelte, daß er ganz vergißt, über seine Zei-
len eine Anrede zu setzen. 1814 endlich entschließt
sich Goethe die Boisserée’sche Sammlung in Hei-
delberg anzuschauen, deren Schätze altdeutscher
und niederländischer Meister einen tiefen Eindruck
auf ihn machen.
Prof. Dr. Norbert Miller
Der Dichter, ein Landschaftsmaler
(Dia-Vortrag)
Dr. Manfred Koltes (Weimar)
Das Verhältnis der Gebrüder Boisserée
im Spiegel ihrer Korrespondenz
91
1791 eröffnet das Weimarer Hoftheater. Goethe ist ein
strenger Theaterchef; er will den ganzen komödian-
tischen Stand und damit das deutsche Theater zu klas-
sischer Höhe treiben. Erstmals hat Weimar ein
eigenes Ensemble, erstmals einen eigenen Direktor.
Goethe, gerade von der zweiten Italienreise zurück,
ist voll Elan für einen neuen Anfang. Bisher gab es in
Weimar mit dem benachbarten Sommerbad Lauch-
städt nur das vom Hofadel und dem Herrn von Goethe
selbst gespielte Liebhabertheater oder fahrende Thea-
tertruppen ließen sich kurzfristig nieder. Deren Zeit
geht nun zu Ende. Überall in Deutschland entstehen
feste Hof- und Nationaltheater; Weimar will im 1776
erbauten Komödienhaus mithalten.
Alle sind angesteckt vom Goethes Ernst und Elan. Als
der erste Vorhang sich hebt, will man die Sache of-
fenbar bescheiden angehen. Goethes Prolog:
Der Anfang ist in allen Sachen schwer;
Bei vielen Werken fällt er nicht ins Auge.
Der Landmann deckt den Samen mit der Egge,
Und nur ein guter Sommer reift die Frucht;
Der Meister eines Baues gräbt den Grund
Nur desto tiefer, als er hoch und höher
Die Mauern führen will; der Maler gründet
Sein ausgespanntes Tuch mit vieler Sorgfalt,
Eh' er sein Bild gedankenvoll entwirft,
Und langsam entsteht, was jeder wollte.
Nun, dächten wir, die wir versammelt sind,
Euch manches Werk der Schauspielkunst zu zeigen,
Nur an uns selbst; so träten wir vielleicht
Getrost hervor und jeder könnte hoffen
Sein weniges Talent euch zu empfehlen.
Allein bedenken wir, daß Harmonie
Des ganzen Spiels allein verdienen kann
Von euch gelobt zu werden, daß ein Jeder
Mit jedem stimmen, alle mit einander
Ein schönes Ganzes vor euch stellen sollen:
So reget sich die Furcht in unsrer Brust.
Von allen Enden Deutschlands kommen wir
Erst jetzt zusammen; sind einander fremd,
Und fangen erst nach jenem schönen Ziel
Vereint zu wandeln an, und jeder wünscht
Mit seinem Nebenmann, es zu erreichen;
Denn hier gilt nicht, daß einer atemlos
Dem andern heftig vorzueilen strebt,
Um einen Kranz für sich hinweg zu haschen.
Wir treten vor euch auf, und jeder bringt
Bescheiden seine Blumen, daß nur bald
Ein schöner Kranz der Kunst vollendet werde,
Den wir zu eurer Freude knüpfen möchten.
Und so empfehlen wir mit bestem Willen
Uns eurer Billigkeit und eurer Strenge.
92
Drei Jahrzehnte später verrät er Eckermann, er sei
mit Vernügen an die Arbeit gegangen. Nicht ohne
wirtschaftliche Rücksichtnahme, ist dafür doch
nur wenig Geld vorhanden. Auch muß er dem
Geschmack des Publikums Rechnung tragen. Al-
lein 87 Titel von Kotzebue und 38 von Iffland
lässt Goethe während seiner Intendanz spielen,
die 25 Jahre später wegen der Intrige um den
legendären dressierten Hund auf der Bühne zu
Ende gehen soll. Das Publikum und die Schau-
spieler müssen zu Größerem erzogen werden, zu
Shakespeare, Calderon, Molière und nicht zuletzt
zu Goethe und Schiller.
Genauso wichtig wie das Sprechtheater ist ihm
das Musiktheater, das auch Herzenssache der
Herzoginmutter ist; eine besondere Freude für den
Theaterchef, wenn er vor allem Mozart spielen
lassen kann. 280 Mal kommen Mozarts Opern in
Goethes Intendantenzeit vor. Fasziniert ist er vor
allem von der Zauberflöte, die in Weimar mit dem
von ihm entworfenen Bühnenbild so auf die
Bühne kommt, daß an den Abenden die Türen
offen stehen müssen, da das Haus das Publikum
nicht fassen kann.
93
Katharina Mommsen präsentiert uns die vielleicht
kultivierteste Frau iher Zeit in Europa: die Malerin
Angelica Kauffmann, eine der wenigen begabten
Künstlerinnen des 18. Jahrhunderts, war eine
Ausnahmeerscheinung. Goethe war ihr in Rom
begegnet, hatte ihr Modell gesessen für ein Portrait,
das einen etwas effeminierten Dichter zeigt, der dazu
meint: ...ein hübscher Bursche, aber keine Spur von
mir.
In ihr lernt er zum ersten Mal eine Malerin von in-
ternationalem Ansehen kennen, zählt sie doch nicht
nur zu den gesuchten Portraitisten der Gesellschaft,
sondern gilt als anerkannte Historienmalerin. Sein
Urteil: Sie hat unglaubliches und als Weib wirklich
ungeheures Talent! quittiert das überwiegend weib-
liche Publikum im Auditorium mit vernehmlichem
Räuspern.
Er liest ihr aus Iphigenie und aus Egmont vor, die
sie illustriert. Sie faßt Vertrauen zu ihm und gibt zu
erkennen, daß sie gern aus ihrem Arbeitsalltag aus-
brechen und ein anderes Leben führen würde.
Bildnisaufträge machen zeitlebens den lukrativsten
Hauptbestandteil ihres künstlerischen Œuvres aus.
Neben Herrscherporträts für die neapolitanische
Königsfamilie und dem Bildnis für Kronprinz Lud-
wig von Bayern porträtierte sie Künstlerkollegen
wie Reynolds und Jakob Philipp Hackert sowie
zahlreiche Romreisende, unter ihnen Goethe und
Herder. Doch auch auf dem Gebiet der Historien-
malerei, welches Frauen aufgrund des Aktstudiums
nahezu verschlossen bleibt, genieß Angelica Kauff-
mann hohes Ansehen. Wichtige Aufträge führte sie
u.a. für Kaiser Joseph II. und für das russische Herr-
scherhaus aus.
Viele ihrer Werke, in denen sich trotz ihres rokoko-
haften, leichten Farbauftrags klassizistische Tenden-
zen spiegeln, werden bereits zu Lebzeiten in
Stichfolgen verbreitet und finden dekorative An-
wendung auf kunstgewerblichen Gegenständen. Die
zeitgenössische Begeisterung für Kauffmanns
Werke finden ihren Ausdruck im enthusiastischen
Ausruf: The whole world is angelicamad!
Die für eine bürgerliche Frau ungewöhnliche
Karriere zu einer angesehenen, hochdotierten
Künstlerin und zum Mitglied der Akademien von
London, Rom, Florenz, Bologna und Venedig ist
nicht nur auf Kauffmanns früh entwickeltes künst-
lerisches Talent zurückzuführen, sondern auch auf
ihre gesellschaftliche Akzeptanz und ihre viel ge-
rühmte zarte Seele, dem Inbegriff weiblicher Emp-
findsamkeit.
94
Ernst Osterkamp legt dar, wie früh bereits in
der Leipziger Studentenzeit Joachim Winckel-
manns Ideal der autonomen, körperlich wie
geistig schönen Persönlichkeit – vermittelt durch
den glühenden Winckelmann-Verehrer Oeser –
auf den 17-jährigen Goethe einwirkt. In Rom er-
wirbt er das Hauptwerk Winckelmanns in italie-
nischer Sprache und steht – wie auch sein
gesamter römischer Freundeskreis – von nun an
unter dem Eindruck von dessen Gedanken und
Idealen. Gewissenhaft stattet er auf Spuren sei-
nes Mentors in Sachen Antike den Zeugnissen
der Vergangenheit seinen Besuch
ab, wobei er insbesondere seiner
Begeisterung über den Apoll von Belve-
dere in Briefen an die Freunde hymnisch
Ausdruck verleiht: Gewaltiger Eindruck
eines göttlichen Marmorbildes.
Ähnlich wie sein Vorbild Winkelmann be-
ginnt auch Goethe bereits während seines
Italienaufenthalts den eigenen Bildungs-
weg als etwas Besonderes zu sehen, als ein
bewußt formbares Kunstwerk, das
auf das Leben zu übertragen sei. Goethes Refle-
xionen über die Totalität des Kunstwerks, in dem
sich die menschliche Schönheit verewigt, stellen
den Künstler zwar als zweiten Schöpfer dar, sein
Werk wird jedoch als autonome Schöpfung be-
trachtet und nicht mehr zu den Hervorbringun-
gen in der Natur gezählt.
Nach seiner Rückkehr aus Italien beginnt sich
Goethe intensiv mit Winckelmanns Kunstan-
schauungen im Einzelnen zu beschäftigen; er
verfaßt eine Reihe von Aufsätzen, in denen er
noch einmal alles resümiert, was er mit Moritz in Italien,
mit Meyer und auch mit Schiller über Antikes, Heidni-
sches und ihre jeweiligen Auffassungen zeitloser Schön-
heit durchgesprochen und durchgearbeitet hat.
Auf diese Weise entsteht eine einzigartige Aufsatzsamm-
lung, die neben Winkelmanns Briefen den Entwurf einer
Kunstgeschichte des 18. Jahrhundert umfaßt. Glanzstück
des Werkes ist jedoch Goethes Charakteristik Winkel-
manns, die in weit ausgreifenden Betrachtungen eine
Übersicht über die Erscheinung dieses Mannes als
eines großartigen Repräsentanten des Zeitalters bie-
tet.
Der Referent legt dem Auditorium wärms-
tens die Lektüre von Goethes Winckel-
mann und sein Jahrhundert ans Herz; man
sollte sich das Werk allerdings besser aus-
leihen, gehört es doch zu jenen Ausnah-
mepublikationen, die vom derzeitigen
Preisverfall bei Büchern nicht betroffen
sind; der Reprint mit Illustrationen kostet
nach wie vor im Buchhandel stolze € 98.
95
Seine Zeichnungen wirken bescheiden. Zart fließen
die wasserdünnen Farben in Aquarelltechnik inei-
nander, färben den Himmel blassblau, den Horizont
blassrosa, das Laub der Bäume blassgrün.
Wenn man Goethes Zeichnungen, auch die bekann-
teren von seiner Italienreise, betrachtet, könnte man
meinen, der Dichter nehme sich beim Zeichnen sehr
zurück. Es scheint das Kraftvolle zu fehlen, das
seine Dichtung so auszeichnet. Dieser Eindruck
deckt sich durchaus mit der Selbsteinschätzung
Goethes: Täglich wird mir's deutlicher, dass ich ei-
gentlich zur Dichtkunst geboren bin und dass ich
die nächsten zehen Jahre, die ich höchstens noch
arbeiten darf, dieses Talent exkolieren und noch
etwas Gutes machen sollte, da mir das Feuer der
Jugend manches ohne großes Studium gelingen
ließ. Von meinem längeren Aufenthalt in Rom werde
ich den Vorteil haben, dass ich auf das Ausüben der
bildenden Kunst Verzicht tue.
Selbst später, als er ein alter Mann und seines Ruh-
mes sicher war, schreibt er über sein Zeichentalent:
Was ich aber sagen wollte, ist dieses, dass ich in
Italien in meinem vierzigsten Jahre klug genug war,
um mich selber insoweit zu kennen, dass ich kein
Talent zur bildenden Kunst habe.
Doch was auf uns – und ihn selbst – manchmal so
unentschieden gewirkt haben mag, entspricht in vie-
lerlei Hinsicht der Technik und dem Verständnis der
Epoche. Freilich, Goethe schreibt selbst: Ich hatte
eine gewisse Furcht, die Gegenstände auf mich ein-
dringend zu machen, vielmehr war das Schwächere,
das Mäßige nach meinem Sinn. Machte ich eine
Landschaft und kam ich aus den schwachen Fernen
durch die Mittelgründe heran, so fürchtete ich
immer, dem Vordergrund die gehörige Kraft zu
geben, und so tat denn mein Bild nie die gehörige
Wirkung.
Doch betrachtet man Zeichnungen seines großen
Vorbilds und Lehrers in Italien Philipp Hackert,
wird die Verwandtschaft augenfällig. Hackert malt
keine Stimmungen, sondern Details. Er strebt da-
nach, in den Konturen eines Baumes, in der Struk-
tur der Rinde und der Form der Blätter noch die
Buche erkennbar zu machen. In dieser Detailver-
sessenheit kann der zeichnende Goethe sich wieder-
96
finden. So bringt er nicht nur Land-
schaften und Tempel aufs Papier, son-
dern auch anatomische Studien und
naturwissenschaftliche Skizzen – auch
als bildschaffender Künstler fühlt sich
Goethe den Anhängern Johann Joachim
Winckelmanns verbunden, den Klassi-
zisten.
2700 Zeichnungen Goethes sind erhal-
ten. Der zehnbändige Corpus der Goe-
the-Zeichnungen macht deutlich, daß
der Dichter durchaus einen überdurch-
schnittlich ausgeprägten Sinn für For-
men und Farben hatte. Sein Vater wäre
stolz auf ihn gewesen. Über ihn schrieb
Goethe in Dichtung und Wahrheit:
Zeichnen müsse jedermann lernen, be-
hauptete mein Vater. Auch hielt er mich
ernstlicher dazu an als zur Musik.
97
Auftakt des Vortragszyklus Das Goethe-Schiller-
Jahrzehnt bildet der Einführungsvortrag von Hans-
Hellmut Allers, der den 120 Zuhörern anschaulich
vor Augen führt, welch große Hindernisse zu über-
winden waren, bis die beiden so unterschiedlichen
Charaktere Goethe und Schiller zueinander finden
konnten, um schließlich über ein Jahrzehnt lang
gemeinsam jene dioskurische Dichterwerkstatt zu
betreiben, die in der Literaturgeschichte wohl ein-
zigartig ist.
Wer aus den letzten fünf Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts literarische Hervorbringungen für das
Theater in deutscher Sprache zu nennen wüßte, die
es mit den damals entstandenen Klassikern aufnah-
men könnten, der trete hervor.
Ein Experiment stellt das im Februar von
Monika Schopf-Beige veranstaltete Mär-
chen-Seminar samt Rollenspiel dar. 30 Mit-
glieder lassen sich davon überzeugen, daß
Goethes 1794 entstandenes Märchen eine
Botschaft an den Freund Schiller enthalte
– eine Entdeckung, die Katharina Momm-
sen bereits vor einigen Jahren pu-
bliziert hatte.
Der März-Vortrag von Rainer
Schmitz Weimarer Xenien, Berliner
Prügeleyen beschert den Zuhörern
interessante Einsichten hinsichtlich
der literarischen Streitkultur um
1800. Zwischen 1795-96 verfassen
die beiden Dichter nahezu tausend
Xenien, ironische Spitzen auf bor-
nierte Kritiker und andere medio-
kre, publizistisch tätige Zeit-
genossen wie etwa der Ber-
liner Buchhändler Friedrich
Nicolai, der seinerseits sa-
tirische Angriffe gegen
Goethe, Schiller und Her-
der geritten hatte und als
organisatorischer Mittel-
punkt der Berliner Auf-
klärung galt.
2005
Das Goethe-Schiller- Jahrzehnt
Hans-Hellmut Allers (Berlin)
Glückliches Ereignis…
Goethe und Schiller –
Freundschaft und Arbeitsgemeinschaft
Monika Schopf-Beige (Ludwigsburg)
Das Märchen –
Eine Botschaft Goethes an Schiller
Zweitägiges Seminar
Rainer Schmitz (München)
Weimarer Xenien, Berliner Prügeleyen...
Anmerkungen zur literarischen
Streitkultur um 1800
Prof. Dr. Rolf-Peter Janz (Berlin)
Die Braut von Messina und Iphigenie
Schillers und Goethes Annäherung
an das antike Theater
98
Im April unterrichtet uns der FU-Dozent Rolf-Peter
Janz über die unterschiedliche Herangehensweise
der beiden Dichter an das antike Theater . Dem Au-
ditorium ist manches neu, was Schillers dramati-
sche Kunstauffassung anbetrifft, etwa seine
Rechtfertigung, in der Braut von Messina wieder
den antiken Chor einzuführen: Ein poetisches Werk
muß sich selbst rechtfertigen, und wo die That nicht
spricht, da wird das Wort nicht viel helfen. Man
könnte es also gar wohl dem Chor überlassen, sein
eigener Sprecher zu sein.
Der Mai beschert uns ein weiteres Mal das Glück,
Katharina Mommsen als Referentin zu hören, die
uns überzeugend darlegt, daß der Tell eigentlich ein
Gemeinschaftswerk beider Dichter gewesen sei.
Seine Teilhabe am Entstehungsprozeß geht weit da-
rüber hinaus, daß er lediglich Schillers Aufmerk-
samkeit auf den Stoff lenkte. Ursprünglich gedachte
Goethe, den Stoff selbst zu bearbeiten; nun schildert
er dem Freund lebendig die Tell-Gedenkstätten in
den Ur-Kantonen. Aus Katharinas Mommsens Vor-
trag mehr auf der folgenden Doppelseite.
Im September erläutert Volker Hesse aus der Sicht
des erfahrenen Arztes die verschiedenen schweren
Krankheiten, die den Dichter seit der Jugend pla-
gen. Das Resumée: Nur Schillers starker Wille, der
in seinem Credo zum Ausdruck kommt: Es ist der
Geist, der sich den Körper baut, kann die erstaun-
liche Tatsache erklären, daß ein Mensch mit einer
derart labilen Gesundheit, die ihn häufig zur Arbeit
unfähig machte, überhaupt in der Lage ist, in einer
Lebensspanne von nicht einmal zwei Jahrzehnten
ein derartiges Werk zu schaffen.
Im Oktober erwartet uns ein Vortrag von
Hans-Jürgen Schings, betitelt: Die Wei-
marer Klassiker und das Böse am Bei-
spiel von »Wallenstein« und »Faust I.«
Thematischer Roter Faden: der Pakt
zwischen Gut und Böse, gewissermaßen
als Dreh- und Angelpunkt beider Stücke.
Der Disput zwischen den guten und
schlechten Kräften bleibt im Wallenstein
abstrakt und intellektuell. Faust dagegen
muß sich mit einem veritablen Teufel
herumschlagen.
Im November läßt uns Hans-Wolfgang-Kendzia
noch einmal teilhaben an der geistigen Atmosphäre,
die in diesem nach erheblichen Anlaufschwierigkei-
ten zustande gekommenen Arbeits- und Freund-
schaftsbund herrschte. Das Goethische Bekenntnis:
Ich bin Ihnen nah, mit allem, was in mir denkt und
lebt vermag uns dieser eindrucksvolle Abend bild-
haft vor Aug und Ohr zu führen, hat der Referent
doch noch eine Überraschung parat: Vom Band er-
klingt der Anfang des Briefwechsels, gelesen von
Will Quadflieg und Gerd Westphal.
Im Dezember haben sich Ulrich Ritter und Erwin
Schastok mit ihrem Live-Programm: Atemlos in
unserer Mitte zum Ziel gesetzt, einen inhaltlichen
Akzent auf jenen Zeitraum zu setzen, da beide
Dichter einander noch persönlich fremd waren und
im jeweils anderen zunächst allein den Konkurren-
ten sehen.
Wir werden Zeuge, wie der von einer anfänglichen
Hassliebe erfüllte Schiller gegen den älteren erfolg-
reichen Goethe zunächst polemisiert, um später –
nach Einsetzen der Korrespondenz – doch sehr
wohl zu registrieren, daß nicht nur er als Jüngerer
von Goethe lerne, sondern daß auch dieser nun sehr
wohl von seinen, Schillers Ratschlägen profitiere.
Prof. Dr. Volker Hesse (Berlin)
Ohne Gesundheit kann man nicht gut sein
Schiller, Goethe und die Medizin
Prof. Dr. Hans-Jürgen Schings (Berlin)
Die Weimarer Klassik und das Böse
Beispiele Faust und Wallenstein
Hans-Wolfgang Kendzia (Berlin)
Ich bin Ihnen nah mit allem,
was in mir lebt und denkt…
Anmerkungen zum Briefwechsel
zwischen Goethe und Schiller
Ulrich Ritter und Christian Steyer lesen:
Atemlos in uns’rer Mitte
Goethe und Schiller – eine Begegnung
99
In neuerer Zeit hört und liest man immer wieder die
Behauptung, Schiller habe den Stoff zu seinem
Wilhelm Tell nur aus Büchern geschöpft. Bei nähe-
rer Beschäftigung mit der Entstehungsgeschichte
von Schillers Tell stellt sich heraus, daß Goethes
Anteil weit größer ist, als bisher von der Forschung
bemerkt wurde. Goethes Teilhabe an der Konzep-
tion und dem Entstehungsprozess des Tell, gehört
zu den ergreifendsten Beweisen seiner Liebe zu
Schiller; er fördert den schwerkranken jüngeren
Freund, dem nur noch eine kurze Lebensspanne
vergönnt ist, insgeheim, um ihm mit dem Tell zum
größten Erfolg seines Lebens zu verhelfen.
Bekannt ist die Tatsache, daß Goethe im Herbst
1797 an Schiller schreibt, er habe sich die großen
Naturszenen, die den Vierwaldstättersee umgeben,
wieder recht genau vergegenwärtigt und plane, den
Tell-Stoff zu behandeln. Schiller weiß, daß Goethe
sich zum dritten Mal auf Tells Spuren befindet,
denn er kennt dessen frühere Briefe aus der
Schweiz von 1775 und 1779. Goethe hat sie ihm,
dem immer um Stoff verlegenen Herausgeber der
Horen, im Februar 1796 zur Verfügung gestellt, und
Schiller macht tatsächlich durch die Veröffentli-
chung der Briefe auf einer Reise nach dem Gotthard
von 1779 in den Horen von 1796 davon Gebrauch.
Goethe bezeichnet schon seine früheste Pilgerschaft
zu den Tell-Stätten, die er 1775 unternommen hat,
als eine längst ersehnte Wanderung. Goethe ist
bereits damals an der Tell-Figur intereressiert.
Aufgrund des Tagebuchs von 1775 berichtet Dich-
tung und Wahrheit noch vom Besuch der Tell-Ka-
pelle in der Hohlen Gasse: Nicht ohne manche neue
wie erneuerte Empfindungen und Gedanken ge-
langten wir durch die bedeutenden Höhen des Vier-
waldstätter Sees nach Küßnacht, wo wir landend
und unsere Wanderung fortsetzend, die am, Weg ste-
hende Tellen-Capelle zu begrüßen und jenen, der
ganzen Welt als heroisch, patriotisch-rühmlichen
Meuchelmord zu gedenken hatten.
Goethes primäres Interesse an der Gestalt des
Wilhelm Tell liegt allerdings nicht bei dessen poli-
tischer Befreiungstat. Schon damals ist er politisch
zu illusionslos, um sich für Tell als geheimen Ver-
schwörer und Freiheitskämpfer zu engagieren;
nein, was ihn schon im Juni 1775 in Altdorf bewegt,
darauf deutet ein Brief vom 19. Juni 1775 hin, den
er nach einer längeren Pause an Lotte und Albert
Kestner schreibt. Diesem ist zu entnehmen:
Goethes Interesse gilt Tell, dem Familienvater und
dem Phänomen, daß seelische Grausamkeit und
willkürlich ausgeübte Gewalt in den der Gewalt
Unterworfenen Gegengewalt weckt und sie zu
Handlungen bewegt, die sie normalerweise nie be-
gehen würden.
Genaueres über Goethes Interesse an der Tell-
Gestalt wissen wir erst seit 1797, als er mit Schiller
über seine Tell-Konzeption spricht. Dabei zeichnet
sich als Hauptzug von Goethes Wilhelm Tell ab, daß
er seinem ganzen Wesen nach kein Revolutionär
und Verschwörer ist, sondern nur für seine Familie
leben will.
In den Tag- und Jahresheften bestätigt Goethe:
Schiller war mein Plan wohlbekannt und ich war
zufrieden, daß er den Hauptbegriff eines selbstän-
Prof. Dr. Katharina Mommsen (Palo Alto)
Unser Tell...
Goethes Anteil an Schillers Wilhelm Tell
100
digen, von den übrigen Verschworenen unabhängi-
gen Tell benutzte.
Goethes Faszination durch die Lokalitäten der Tell-
Legende ist so stark, daß es ihn vier Jahre nach der
ersten Schweizer Reise wieder dorthin zieht. Auf
der 1779 mit Carl August zusammen unternomme-
nen zweiten Schweizer Reise sucht der inzwischen
30-jährige Goethe die Tell-Gedenkstätten in umge-
kehrter Richtung und Reihenfolge auf, worüber
Carl Augusts Reisetagebuch manche Einzelheiten
verrät.
1797, nach weiteren 18 Jahren durchwandert und
durchschifft der inzwischen 48-jährige Goethe zum
dritten und letzten Mal die Tell-Landschaft, diesmal
in Gesellschaft des gebürtigen Schweizers Heinrich
Meyer, des Malers und Kunsthistorikers, der ihm
als Begleiter besonders willkommen ist, weil er mit
seinem richtigen und scharfen Blick schon lange die
Verhältnisse kannte und in einem treuen Gedächtnis
bewahrte, wie Goethe im Brief aus Stäfa vom 14.
Oktober 1797 gegenüber Schiller rühmt.
Dort ist ausführlich von unmittelbarem Anschauen
von interessanten Gegenständen, von Einblicken in
die Naturhistorischen, geographischen, ökonomi-
schen und politischen Verhältnisse, wie auch der
Lektüre einer alten Chronik die Rede und von sonst
manchem Aufsatz der arbeitsamen Schweizer.
An das frohlockende Bekenntnis seiner Absicht, die
Fabel vom Tell (…) episch zu behandeln, schließt
Goethe die Bemerkung an, daß er die Charaktere,
Sitten und Gebräuche der Menschen in diesen Ge-
genden, so gut als in der kurzen Zeit möglich beob-
achtet habe, nun, komme es auf gut Glück an, ob
aus diesem Unternehmen etwas werden kann.
Es war auf dem Vierwaldstättersee und auf dem
Weg nach Altdorf in der freien Natur, wo Goethe
seiner eigenen Aussage nach den Plan eines Tell-
Epos konzipiert.
Dem wiederholten Anschauen der Örtlichkeiten und
Studium von Land und Leuten und der Schweize-
rischen Geschichte liegt Goethes Absicht zugrunde,
der poetischen Darstellung des Stoffes möglichst
viele realistische Züge und dadurch Überzeugungs-
kraft zu verleihen. Solche realistischen Züge der
helvetischen Existenz betrachtet er als wichtigste
Voraussetzung, um dem Tell-»Märchen« wahres
Leben einzugeben.
Betrachtet man nun Goethes Landschaftsnotizen
seiner drei Schweizer Reisen genauer, so findet man
viele Entsprechungen in Schillers Tell-Drama, so
daß es völlig überzeugend ist, wenn man in den
Eckermann-Gesprächen liest: In Schillern lag die-
ses Naturbetrachten nicht. Was in seinem Tell von
Schweizer Lokalität ist, habe ich ihm alles erzählt,
aber er war ein so bewundernswürdiger Geist, daß
er selbst nach solchen Erzählungen etwas machen
konnte, das Realität hatte.
Von vornherein begrüßt Schiller Goethes Tell-Pro-
jekt mit Begeisterung und spendet ihm auch weiter-
hin großen Beifall. Natürlich wird sofort nach der
Rückkunft aus der Schweiz darüber gesprochen, als
Goethe bei Schiller in Jena Station macht. Dieser
ist damals vollauf durch die Arbeit am Wallenstein,
101
an Maria Stuart, der Jungfrau von Orleans und der
Braut von Messina beansprucht.
Die Gespräche mit Goethe über den Tell-Stoff zie-
hen sich hin, mit Unterbrechungen, von 1798 bis
zur Aufführung von Schillers Tell im März 1804 .
Gegenüber Eckermann charakterisiert Goethe 1827
seinen gedachten Helden: Den Tell dachte ich mir
als einen urkräftigen, in sich selbst zufriedenen,
kindlich unbewußten Heldenmenschen, der (...)
überall gekannt und geliebt ist, überall hülfreich,
übrigens ruhig sein Gewerbe treibend, für Weib und
Kinder sorgend, und sich nicht kümmernd, wer
Herr oder Knecht sei.
Hier zeigt sich deutlich: Goethes Tell ist nicht der
übliche Freiheitsheld, Revolutionär und typische
Rebell gegen politische Mißstände, sondern ein
Mensch, der sich über Herrschaft oder Knechtschaft
überhaupt keine Gedanken macht. Darin unter-
scheidet sich Goethes Tell-Konzeption ganz ent-
schieden von den zahlreichen Darstellungen der
Schweizer Überlieferungen, die sämtlich Tell als
Verschwörer und Anführer auf dem Rütli darstel-
len.
Schiller schließt sich zwar darin der Schweizer
Tradition an, daß er den Helden als Alpenjäger auf
die Bühne stellt, aber im Gegensatz zur Tradition
sondert Schiller seinen Tell von den Verschwörern
ab. Dies ist ein ganz wesentlicher Zug, den Schiller
von Goethes Tell übernimmt.
Als Einzelgänger wie bei Goethe, der eben nicht aus
dem gleichen Holz wie die politischen Täter ge-
schnitzt war, läßt sich die Tell-Figur differenzierter,
gebrochener, interessanter gestalten. Goethe ist der
Zusammenhang zwischen seiner und Schillers Tell-
Konzeption völlig klar.
In seinen Annalen von 1804 drückt Goethe seine
Zufriedenheit darüber aus, daß der mit seinem Tell-
Plan vertraute Freund den Hauptbegriff eines selb-
ständigen, von den übrigen Verschworenen
unabhängigen Tell benutzte. Wenn man an einen
derartig selbstbestimmten Tell denkt, der keines-
wegs aus Büchern stammte, so ist die Behauptung,
Schiller habe den Stoff nur aus der Literatur ge-
schöpft, geradezu absurd.
Tatsächlich rücken Schillers Gestalten der wackeren
Zeitgenossen des Tell also ganz in die Nähe der Ge-
stalten, die Goethe vorgeschwebt haben und von
denen er Eckermann 1827 berichtet: Das Höhere
und Bessere der menschlichen Natur (...) Die Liebe
zum heimatlichen Boden, das Gefühl der Freiheit
und Sicherheit unter dem Schutze vaterländischer
Gesetze, das Gefühl ferner der Schmach, sich von
einem fremden Wüstling unterjocht und gelegent-
lich mißhandelt zu sehen, und endlich die zum Ent-
schluss reifende Willenskraft, ein so verhasstes Joch
abzuwerfen, alles dieses Höhere und Gute hatte ich
den bekannten edleren Männern Walther Fürst,
Stauffacher, Winkelried und anderen zugeteilt und
dieses waren meine eigentlichen Helden, meine mit
Bewußtsein handelnden höheren Kräfte.
Im Gespräch mit Eckermann erinnert sich Goethe,
wie er von diesem schönen Gegenstande (…) ganz
voll war und dazu schon gelegentlich seine Hexa-
meter summte und Schiller sich damals durch seine
Schilderungen nicht nur die Landschaften, sondern
auch die handelnden Personen einprägen.
102
Aber, so fährt Goethe fort, da ich andere Dinge zu
tun hatte und die Ausführung meines Vorsatzes
immer weiter verschob, so trat ich meinen Gegen-
stand an Schiller völlig ab, der denn daraus sein
bewundernswürdiges Gedicht schrieb.
Zur Überlassung des Stoffes an den Freund berich-
ten die Tag- und Jahreshefte zum Jahr 1804: Über
dieses innere Bilden und äußere Unterlassen waren
wir in das neue Jahrhundert
eingetreten. Ich hatte mit
Schiller diese Angelegenheit
oft besprochen und ihn mit
meiner lebhaften Schilderung
jener Felswände und gedräng-
ten Zustände oft genug unter-
halten, dergestalt daß sich bei
ihm dieses Thema nach seiner
Weise zurechtstellen und for-
men mußte. Auch er machte mich mit seinen Ansich-
ten bekannt, und ich entbehrte nichts an einem Stoff,
der bei mir den Reiz der Neuheit und des unmittel-
baren Anschauens verloren hatte und überließ ihm
daher denselben gerne und förmlich, wie ich schon
früher mit den Kranichen des Ibykus und manchem
andern Thema getan hatte; da sich denn aus jener
obigen Darstellung, verglichen mit dem Schilleri-
schen Drama, deutlich ergibt, daß ihm alles voll-
kommen angehört, und daß er mir nichts als die
Anregung und eine lebendigere Anschauung schul-
dig sein mag, als ihm die einfache Legende hätte
gewähren können.
Wann genau Goethe seinen epischen Tell dem dra-
matischen Tell Schiller zuliebe beiseite legt und den
Stoff seinem Freund abtritt, ist nicht überliefert.
Fassen wir abschließend noch ein mal zusammen,
worin Goethes Anteil an diesem Werk besteht:
1. in der Anregung, sich überhaupt mit dem Stoff
zu befassen,
2. in der suggestiven Schilderung der Schweizer
Lokalitäten,
3. in der Konzeption des Helden als eines Einzel-
gängers; die vaterländischen Verschwörungsmotive
überträgt Schiller – Goethes Konzeption entspre-
chend – auf die anderen Gestalten sowie auch auf
einzelne Frauen des Dramas.
Zu den Frauen im Tell sei noch ergänzend gesagt,
daß auch sie von Goethe wesentlich mitgeprägt
worden sind.
Wilhelm Tell ist Schillers letztes vollendetes Werk.
Als er wenige Monate nach dessen Vollendung
stirbt, plante Goethe eine Totenfeier, doch war er
selber so leidend, daß ihn die Vorstellung einer sol-
chen Feier zu sehr angriff und so sind nur wenige
Versfragmente von dem, was er als Freund sagen
wollte, übriggeblieben.
Goethes Reflexion: Das Gute was man Liebenden
erzeigt / Belohnet sich in dieser ernsten Stunde ruft
unwillkürlich seine Mitwirkung am Gelingen des
Wilhelm Tell ins Gedächtnis. Auch die trostlose
Frage: Soll ich ihm nicht mehr das leisten? läßt an
Goethes Teilhabe an diesem großen Werk denken.
In diesen Versfragmenten kommt das überwälti-
gende Gefühl der Einsamkeit nach dem Verlust
Schillers zum Ausdruck, das Bewußtsein, keinen
Partner mehr zu haben, den er so beschenken
konnte wie den geliebten Freund.
103
Die meisten Balladenschöpfungen, wie wir sie
heute kennen, verdanken ihre Entstehung in diesem
fruchtbaren Jahrzehnt ausschließlich jener einzig-
artig engen Zusammenarbeit zwischen zwei Dich-
tern, ihrer ständigen gegenseitigen Anregung, aber
auch konstruktiver Kritik, die dem Genius und der
Eigenart des Anderen jedoch stets freie Hand lässt.
Dies ist freilich nur dadurch möglich, daß beide
über derart viel kreatives Potential verfügen, daß sie
sich Ideen und Eingebungen eben mal auf einem
Zettelgen hinüber- und herüberschicken können.
Heute, im Zeitalter des Ideenklaus, da es ohnehin
allerorten an originellen und geistvollen literari-
schen Schöpfungen mangelt, erscheint dieser
Reichtum der dichterischen Produktion in nur
einem Jahrzehnt an nur einem Ort schier unglaub-
lich.
Unvergesslich wird allen Anwesenden sicher die
Juni-Veranstaltung in der Landesvertretung Baden-
Württembergs bleiben. Angelika Reimann, Litera-
turwissenschaftlerin aus Jena, hatte als Untertitel zu
ihren Ausführungen über Goethes und Schillers
Balladenschaffen das launige Zitat gewählt: Leben
Sie recht wohl und lassen Sie Ihren Taucher je eher,
desto besser ersaufen.
Neben der lebhaften Darstellung des Funktionierens
der gemeinsamen Jenenser Dichterwerkstatt, mal in
Schillers Garten, mal im Gasthof zur Tanne, erfreut
uns die Referentin auch noch durch professionelles
Deklamieren einiger Balladen Schillers.
In seiner Schrift Über naive und sentimentalische
Dichtung hatte Schiller vom modernen Dichter ge-
fordert, über den Zustand der Naivität hinauszuge-
hen, da die Darstellung des Ideals den Dichter
mache. Im Unterschied zur Volksballade solle
die Kunstballade bewußt sittliche Lehren vermit-
teln. Gestalten und Geschehnisse sind einer tragen-
den Idee zu unterwerfen, die Gestaltung soll mit
straffer Handlungsführung und sprachlichem
Schwung auf unmittelbare Wirkung beim Hörer
bzw. Leser zielen. Den Balladen weist er die Auf-
gabe zu, den Leser zu Anteilnahme und Wertungen
aufzufordern, ihm seine Möglichkeiten des mensch-
lichen Handelns zu zeigen und die Balladenwelt mit
seiner bisherigen Lebenserfahrung zu vergleichen.
Laut Goethe solle der Leser die Literatur urteilend
genießen. Außerdem sollen die Texte die Vielfalt
sprachlicher Schönheiten der deutschen Sprache de-
monstrieren.
Die beiden verabreden,
eine größere Zahl an Bal-
laden zu verfassen, um
ihre theoretischen Ab-
sichten literarisch zu ver-
wirklichen. Die Verse
entstehen in einer Art
künstlerischem Wett-
streit, werden jedoch
häufig vor ihrem Er-
scheinen brieflich disku-
tiert.
Das Jahr 1797 gilt als
die Geburtsstunde der
klassischen Kunstbal-
lade. Niemals vorher
und niemals danach
schreiben Goethe und
Schiller so viele Bal-
laden wie im Frühjahr
und im Sommer die-
ses Jahres. In kurzer
Folge entstehen Der
Taucher, Der Hand-
schuh, Ritter Toggen-
burg, Die Kraniche des Ibykus ebenso wie Der
Schatzgräber, Der Gott und die Bajadere oder Der
Zauberlehrling, die über Generationen zum unver-
zichtbaren Bestand unserer Nationalliteratur gehö-
ren.
Die Balladen dieses Sommers
erscheinen im Musenalma-
nach auf das Jahr 1798. Schil-
ler im Vorwort: Wir haben uns
vereinigt, in den diesjährigen
Almanach mehrere Balladen
zu geben und uns bei dieser
Arbeit über Stoff und Behandlung dieser Dichtungs-
art selbst aufzuklären.
Nach dem aufsehenerregenden Xenien-Almanach
im Vorjahr überraschen die beiden zusammen ar-
beitenden Dichter die literarische Öffentlichkeit
auch hierin. Die Einheit von Goethe und Schiller
offenbart sich in ihrer wechselseitigen Annäherung
ihrer künstlerischen Auffassung und in der Behand-
lung der Gattung.
Dr. Angelika Reimann (Jena)
Leben Sie recht wohl und lassen Sie
Ihren ‘Taucher’ je eher, je besser ersaufen…
Die Zusammenarbeit Goethe und Schillers
am Beispiel des Balladenschaffens
104
Goethes ältere Balladen
wie Der Fischer, Der Erl-
könig und Der König von
Thule, aber auch seine
späteren Balladen-Schöp-
fungen sind empfindungs-
reiche Stimmungsgedichte, Spiegelungen
geheimnisvoller Naturer-
scheinungen, Darstellung ma-
gischer Eindrücke, welche die
Elemente mit ihrer verlocken-
den, sinnbetörenden und zer-
störenden Macht auf unser
Gefühl und auf unsere Phan-
tasie ausüben.
Auch seine neueren Balladen von 1797 leugnen den
Ursprung aus der nordischen Volksdichtung nicht.
Auch hier walten dämonische Kräfte, Tod und
Grauen wie in Die Braut von Korinth oder in Der
Gott und die Bajadere. Im Zauberlehrling und
im Schatzgräber walten harmlosere Geister. Wäh-
rend Goethe also die Stimmung seiner alten Balla-
den beibehält, trifft er den Ton nun kunstvoller und
bewußter. Neu hingegen ist bei Goethe, daß seine
Ereignisse nun einer bestimmten Idee folgen. Hierin
macht sich der Einfluß von Schiller bemerkbar, der
seine Balladenstoffe ebenso zu behandeln pflegte.
Goethe bekennt in einem Brief an Meyer am 21.
Juli 1797, es komme darauf an, die Balladenform
mit würdigeren und mannigfaltigen Stoffen und mit
einem tieferen Gehalt zu erfüllen.
Schiller hingegen tritt immer mehr aus der Sagen-
welt in das geschichtlich bewußte Leben über. Seine
Balladen bilden eine besondere Kunstform, in der
das episch-dramatische Element das lyrische über-
wiegt. Dabei ist er immer bestrebt, die rein erfaßte
Idee sinnlich und gegenständlich erscheinen zu las-
sen. Den idealen Gehalt füllt er plastisch, zeichnet
ihn mit Klarheit und bringt ihn durch seine charak-
teristische Färbung zu lebendiger Anschauung.
Goethe bleibt hierin sein Vorbild.
Goethe ist wohl der erste, der den wahren Wert von
Schillers Balladen aufrichtig anerkennt, bewundert
und verteidigt – sogar gegen Schiller selbst. Schiller
erscheint in seinen Balladen als Volksdichter, der
den Geschmack der Gebildeten und das Auf-
fassungsvermögen der großen Menge durch die
Größe seiner Kunst aufzuheben versteht.
Schiller selbst bekennt zu Beginn des gemeinsamen
Balladen-Wettstreits am 18. Juni 1797, Goethe ge-
wöhne ihm immer mehr die Tendenz ab, vom All-
gemeinen zum Besonderen zu gehen. Er führe ihn
auf den umgekehrten Weg
vom Engen ins Weite, vom
einzelnen Fall zum großen
Gesetz, vom Bild und der An-
schauung zum Gedanken. Mit
wenigen Ausnahmen bringen
Schillers Balladen eine sittli-
che Idee zum Ausdruck.
Doch nirgends ergreift er das Wort zu lehrsamer
Mahnung oder fügt formelhaft eine moralische
Nutzanwendung hinzu. Aus seiner Darstellung
leuchtet der Grundgedanke hell und rein als orga-
nischer Bestandteil hervor. Die Balladen ergreifen
durch ihre Schönheit und Wahrheit als echte Kunst-
werke. Sie erschüttern das Gemüt durch das Schick-
sal, das sie offenbaren, und regen den Geist zu
ahnungsvollem Sinnen an.
105
2006
200 Jahre Goethes Faust
Hans-Helmut Allers (Berlin)
Vom Volksbuch bis zu Thomas Mann
Dr. Faustus in Historie und Literatur
Prof. Frank Möbus (Göttingen)
Der Teufel, den ich beschwöre,
gebärdet sich sehr wunderlich…
Zur Entstehungsgeschichte von Goethes Faust
Im Januar gibt uns Hans-Hellmut Allers einen an-
schaulichen Überblick über die Entwicklung der
Faustfigur Vom Volksbuch bis zu Thomas Mann.
Obwohl wir bereits im Vorjahr bei unserem Besuch
des Faust-Museums in Knittlingen mit dem histori-
schen Dr. Faustus und den zahlreichen ihn umgeben-
den Sagen und Gerüchten bekannt gemacht worden
waren, erfahren wir doch noch viel Neues, nicht nur
über die Faust-Historie, sondern auch über die diver-
sen Faust-Adaptionen von Christopher Marlowe bis
Thomas Mann.
Zur Entstehungsgeschichte von Goethes Faust teilt
uns im Februar der Göttinger Professor Frank
Möbus erstaunliche Details mit. Vielen Zuhörern
wird nun erst klar, daß die Faust-Figur in Deutsch-
land bis ins späte 18. Jahrhundert hinein eigentlich
mehr oder minder als Marionette mit holzsschnittar-
tigen Charakterzügen agiert, bei Jahrmärkten und
Messen auf Puppenbühnen, der Dr. Faustus als ein
berüchtigter Magier und Schwarzkünstler, der mit
dem Teufel wettet und ihm schließlich seine Seele
verschreibt.
Erst Goethe erkennt das dramatische Potential dieses
Charakters, der auf der metaphsysischen Suche ist
und wissen will, was die Welt im Innersten zusam-
menhält. Er läßt seinen Protagonisten bekanntlich in
Begleitung Mephistos die Reise in die Kleine und
die Große Welt antreten, reichert die wunderliche
Posse noch durch eine Liebesgeschichte an und
schafft damit aus der Puppenspielfabel einen Stoff
der Weltliteratur und aus Faust einen zeitlos moder-
nen Charakter, den seitdem jede Generation von
neuem für sich entdeckt und interpretiert.
106
Dr. Alwin Binder (Münster)
Nur Neuigkeiten ziehn uns an…
Visionen moderner Welt in Goethes Faust
vor und nach 1800
Dr. Michael Jaeger (Berlin)
Der Geist, der stets verneint…
Mephistos Modernität
Im März legt Alwin Binder mit seinem
Vortrag, Visionen moderner Welt in
Goethes Faust, dar, daß das Faust-
Drama im Grunde genommen von
Goethe bereits als Parabel auf die mo-
derne Welt zu verstehen sei. Faust sei
alles andere als ein positiver Charakter;
vielmehr zerstöre er alles um sich
herum, lasse alle ethischen Bedenken
beiseite; kurzum, ein Spiegelbild des
modernen Menschen
Etwas schlucken müssen hier all jene,
die noch Inszenierungen vor ihrem gei-
stigen Auge haben wie etwa jene be-
kannte des Hamburger Schauspiel-
hauses von 1961 mit Gustav Gründgens
und Will Quadflieg, der als idealisti-
scher Faust agiert, glaubhaft als ein
guter Mensch in seinem dunklen
Drange, der sich des rechten Wegs doch
stets bewußt ist.
Unter dem Titel: Der Geist, der stets ver-
neint widmet sich der April-Vortrag Me-
phistos Modernität. Michael Jaeger geht
es darum, aufzuzeigen, daß das mephis-
tophelische Prinzip der Beschleunigung
und Rastlosigkeit bereits von Goethe
quasi vorausgeahnt worden sei: Konsum-
orientiertheit, schnelle Bedürfnisbefrie-
digung und die Seelenlosigkeit der
Maschinengesellschaft seien als Meta-
phern einer industriellen anti-kontem-
plativen Arbeitsgesellschaft zu verstehen,
deren opferreichen Anfang Goethe ins-
besondere im Faust II kritisch darstelle
und deren Scheitern wir Heutigen gerade
erlebten.
Die hochkomplexen Ausführungen und
Thesen Jaegers sind nachzulesen in sei-
ner materialreichen Habilitationsschrift,
die unlängst unter dem Titel Fausts
Kolonie erschienen ist.
107
Mitte Mai setzt sich der Faust-Zyklus fort mit
Manfred Osten. Hier der Grundtenor seines re-
ferierten Credos: Daß unsere Zivilisation aus
Mangel an Ruhe in eine neue Barbarei ausläuft,
bemerkt Goethe bereits 1778 in Berlin, mit dem
Ergebnis, daß er sein Leben lang ein konsequen-
ter Berlinverweigerer geblieben ist.
Fast ein halbes Jahrhundert später schreibt er im
November 1825 an den preußischen Juristen Ni-
colovius: Für das größte Unheil unsrer Zeit, die
nichts reif werden läßt, muß ich halten, daß man
im nächsten Augenblick den vorhergehenden ver-
speist, den Tag im Tage vertut, und so immer aus
der Hand in den Mund lebt, ohne irgend etwas
vor sich zu bringen. Haben wir doch schon Blät-
ter für sämtliche Tageszeiten. Dadurch wird alles,
was ein jeder tut, treibt, dichtet, ja was er vorhat,
ins Öffentliche geschleppt. Niemand darf sich
freuen oder leiden, als zum Zeitvertreib der übri-
gen; und so springt's von Haus zu Haus, von
Stadt zu Stadt, von Reich zu Reich und zuletzt von
Weltteil zu Weltteil, alles veloziferisch.
Goethe geniale Wortschöpfung veloziferisch be-
zeichnet die Verschränkung von Velocitas (die
Eile) mit Luzifer. Faust erscheint als der moderne
Blitzkrieger der Erfüllung jener Wünsche einer
Anspruchsgesellschaft, die alles will, und zwar
sofort. Und was Luzifer alias Mephisto der Un-
geduld Fausts andient, sind denn auch schon jene
Instrumente des Veloziferischen, die am Ende des
20. Jahrhunderts zwar andere Namen tragen, aber
dieselben Dinge meinen: die schnelle Liebe, der
schnelle Mantel, das schnelle Geld und zum
Schluß: der schnelle Mord an Philemon und Bau-
cis. Fausts globales Dorf, von Mephistos Gnaden,
gebietet bereits perfekt über virtuelle Welten, wie
wir sie heute mit Videoclips und beim Zappen
zwischen TV-Kanälen kreieren. Sein virtuelles
Arsenal reicht von Walpurgisnächten aller Art bis
zur heraufzitierten schönen Helena.
Es sind immer rascher wechselnde Filmschnitt-
sequenzen einer Beschleunigungskultur mit Lu-
zifer als omnipotentem Artifex einer
Unterhaltungsgesellschaft, die sich bereits im
Zeichen grandioser Oberflächlichkeit und eines
perfekten Zeitmanagements zu Tode amüsiert.
Im Juni brechen über 60 Berliner Goethefreunde
auf, um sich in der Ruine des ehemaligen St.-
Pauli-Klosters in Brandenburg an der Havel die
Faust I-Premiere des dortigen Event-Theaters an-
zuschauen; eine frische Inszenierung mit nur zehn
Akteuren, von denen – mit Ausnahme der beiden
Protagonisten – alle mehrere Rollen übernehmen,
unterstützt vom Brandenburger Kammerchor, der
beim Osterspaziergang und Walpurgisnacht dem
Bühnengeschehen Vehemenz und Turbulenz ver-
leiht.
Faust I in einem gotischen Kirchenschiff mit
Backsteinwänden, das ist eine Erfahrung der be-
sonderen Art. Ein junges Ensemble – darunter ein
wahrhaft entzückendes ungestümes Gretchen –
beschert uns drei unterhaltsame Stunden; eigen-
willige und sonderbare Regieeinfälle, wie sie
heute eigentlich an sämtlichen deutschen Thea-
tern die Klassiker zu aktualisieren suchen, halten
sich in Grenzen. Eine Hexen-Gulaschsuppe und
ein Premieren-Prosecco tun das ihrige, um die
Berliner nach einem gelungenen Abend in ver-
gnügter Stimmung wieder heimfahren zu lassen.
Dr. Manfred Osten (Bonn)
Fluch vor allem der Geduld…
Zur Aktualität der Faust-Tragödie
Prof. Dr. Volker Hesse (Berlin)
Habe nun ach, Philosophie, Juristerey
und Medizin studiert...
Dr. Faustus u. Dr. med Johann Wolfgang Goethe
Premierenbesuch Faust I
in Brandenburg a.d. Havel
Verweile doch, Du bist so schön!
Inszenierung des Event Theaters Brandenburg
in der Ruine des St.-Pauli-Klosters
108
Der Figur des Gretchens widmet sich Angelika
Reimann in ihrem Vortrag Goethes Gretchentra-
gödie und der Kindsmord im 18. Jahrhundert. Sie
legt dar, welche Gründe den jungen Goethe veran-
laßt haben dürften, das Thema des Kindsmordes
mit der Liebesbeziehung von Faust und Margarete
zu verknüpfen, ein Thema, das ihn auch später
noch in seiner Eigenschaft als Mitglied des Gehei-
men Consiliums beschäftigt. Viel Wirbel hatte ei-
nige Jahre zuvor Sigrid Damm mit ihrer
Christiane-Biografie verursacht, in der sie fälsch-
licherweise behauptet hatte, Goethe habe hier als
Minister das entscheidende Votum zur Hinrichtung
einer Kindsmörderin abgegeben und dadurch deren
Todesstrafe veranlaßt. Angelika Reimann stellt dies
notwendigerweise richtig. Ihr Fazit: Gesellschaft-
liche und individuelle Handlungen jeder Epoche
können immer nur vor dem Hintergrund der dama-
ligen gesellschaftlichen Zustände erklärt und ge-
deutet werden.
Im September erläutert uns Theo Buck die Entste-
hungsgeschichte des Faust unter einem ganz neuen
Aspekt; wir erfahren, welche Bezüge diese oder
jene Szenen zu Goethes Lebenswirklichkeit auf-
weisen. Ein tief Theater scheint sich aufzustellen,
geheimnisvoll ein Schein uns zu erhellen, und ich
besteige das Proszenium. Dieses Zitat hat der Re-
ferent gewählt, um uns die Dramaturgie der gesam-
ten Faust-Dichtung noch einmal zu verdeutlichen
und durch ausgewählte Beispiele darauf hinzuwei-
sen, daß es sich insbesondere bei vielen Szenen des
2. Teils um Allegorien und Traumbilder handelt,
die im Leser und Zuschauer Assoziationen wecken
sollen. Dieser von Goethe beabsichtigte Kunstgriff
der Andeutung des Unausgesprochenen, der inter-
pretierbaren Metapher, bewirkt jenes Geheimnis
des wunderlichen Hexenwerkes, wie Goethe die
Dichtung zuletzt selbst nannte, das den Faust zum
zeitlosen Gesamtkunstwerk werden läßt.
Fausts Tod – ein tragisches Ende? mit dieser
durchaus ernst gemeinten Frage beschließt Alfred
Behrmann im November den diesjährigen The-
men-Zyklus: Bei allem tragischen Geschick, das
Gretchen und ihrer Familie widerfahre, handele es
sich – so der Referent – beim Faust mitnichten um
eine Tragödie im griechischen Sinne, in welcher
der Held gefälligst mit den Schicksalsmächten zu
hadern habe und auch selbst mindestens einige
heroische Taten zu vollbringen oder wenigstens
derartige Gedanken und Absichten zu äußern habe.
Ganz im Gegenteil: Der Faust weise über weite
Strecken burleske, groteske, gar komödiantische
Szenen auf, die der sarkastisch angelegten Rolle
des Mephisto geschuldet seien, einem Unterteufel,
vom Herrn lediglich ausgestattet mit beschränkter
satanischer Handlungsvollmacht.
Ein vierfach schuldhaft gewordener Protagonist,
ein mehrfacher Mörder gar, dessen Seele am Ende
des Stücks Engel, schwebend in der höhern Atmo-
sphäre, dem leer ausgegangenen, sich betrogen
fühlenden Mephisto entführen; eine Aktion, vom
Chor seliger Knaben kommentiert mit Gesängen
wie: Gerettet ist das edle Glied der Geisterwelt
vom Bösen: Wer immer strebend sich bemüht, den
können wir erlösen. Das – so der Referent –sei eine
geniale Dichtung mit Happy-End, ein Drama, eine
Tragödie nie und nimmer.
Dr. Angelika Reimann (Jena)
Schon zuckt nach jedem Nacken die Schärfe,
die nach meinem zuckt…
Goethes Gretchentragödie und der Kindsmord
im 18. Jahrhundert
Prof. Dr. Theo Buck (Aachen)
Ein tief Theater scheint sich aufzustellen,
geheimnisvoll den Schein uns zu erhellen
und ich besteige das Prozsenium...
Fausts Tod, ein tragisches Ende?
Prof. Dr. Alfred Behrmann (Berlin)
Löset die Flocken los, die ihn umgeben!
Schon ist er schön und groß voll heiligen Leben
Die Dramaturgie der Faustdichtung
109
Der Herzog mit dem ich nun
schon an die neun Monate in
der wahrsten und innigsten
Verbindung stehe, hat mich
endlich auch an seine Ge-
schäffte gebunden, aus uns-
rer Liebschaft ist eine Ehe
entstanden, die Gott seegne.
So beschreibt Goethe 1776
seine Beziehung zu Carl Au-
gust. Diese dreiundfünfzig Jahre lange Männer-
freundschaft zwischen den beiden Charakteren
prägte Weimar sehr. Eine solch lange Freundschaft
zwischen zwei Männern ist für uns fast unvorstell-
bar. Da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit
diese Freundschaft ernst zu nehmen war, wie inten-
siv sie war und wie es überhaupt dazu kam.
Am 7. November 1775, morgens
um 5 Uhr, trifft Goethe in Wei-
mar ein. August von Kalb
bringt ihn im Hause seines
Vaters, Karl Alexander von
Kalb, unter – gleich gegen-
über der Herderkirche – es
steht noch heute. Dies bleibt
für ein halbes Jahr Goethes
erste Wohnung in Weimar.
Viele Menschen in Weimar sind gespannt auf den
jungen Dichter des Sturm und Drang, der die lite-
rarisch interessierte Jugend so beeindruckt hat.
Zu diesen gehören die Herzogin-Mutter Anna Ama-
lia, damals 36 Jahre alt, der Schriftsteller Christoph
Martin Wieland, Herausgeber des Teutschen Mer-
kur, der bald zur wichtigsten deutschen Literatur-
zeitschrift wurde, der
Lyriker und Überset-
zer Carl Ludwig von
Knebel sowie zahl-
reiche Hofdamen,
darunter Charlotte
von Stein und Louise
von Göchhausen,
Friedrich Justin Ber-
tuch, der reiche
Kaufmann und Ver-
walter der Staats-
kasse, ferner Johann
Carl August Musäus,
der Literat, Pädagoge
und Philologe, Leiter
des Gymnasiums in Weimar, und zahlreiche andere.
Goethe wird noch am selben Tage
vom Herzog und Anna Amalia
zum Mittagessen eingeladen.
Wieland ist anwesend und gibt
seiner Verehrung für den jun-
gen Dichterkollegen in mehre-
ren Briefen temperamentvoll
Ausdruck. So schreibt er Fried-
rich Jacobi drei Tage später: Was
ganz der Mensch beim ersten An-
blick nach meinem Herzen war... Seit dem heutigen
Morgen ist meine Seele so voll von Goethen wie ein
Tautropf von der Morgensonne...
An Lavater heißt es am gleichen Tage: Ich habe die-
sen herrlichen Menschen binnen dieser drei Tage
so herzlich lieb gewonnen und bedaure nur, ihn
noch nicht allein gesehen und gesprochen zu
haben...
2007
Zwischen Musenhof und Ministeramt
Hans-Hellmut Allers (Berlin)
Meine Schrifstellerey subordiniert sich dem Leben
Goethe 1775- 1786 – Von Frankfurt nach Weimar
Einführungsvortrag
Dr. Jochen Golz (Weimar)
Erhabenes verehrend, Schönes geniessend…
Ein Portrait der Herzogin Anna-Amalia
Dr. Thomas Franzke (Gera)
Hab Dank für Dein entzückend Spiel…
Goehte und das Weimarer Liebhabertheater
Prof. Dr. Jan Philipp Reemtsma (Hamburg)
Wer ist berechtigt, die Menschheit
aufzuklären? Wer es kann!
Osmantinische Aufklärung –
Wieland in Oßmannsstedt
Dr. Manfred Osten (Bonn)
Ein Kind des Friedens?
Goethe als Leiter der Kriegskommission
Dr. Angelika Reimann (Jena)
Daß des Menschen Leben nur insofern etwas wert ist,
als es Folge hat…
Goethes amtliche Tätigkeit vor und nach
der italienischen Reise
Prof. Dr. Theo Buck (Aachen)
Sowie ein Dichter politisch wirken will,
ist er als Poet verloren
Goethe – ein politischer Schriftsteller?
110
Für die weitere Entwicklung in Weimar ist entschei-
dend, daß zwischen dem jungen Herzog und dem
acht Jahre älteren Goethe bald ein freundschaftli-
ches Verhältnis entsteht. Carl August ist ein sehr
selbstbewußter, eigensinniger junger Mann, der sich
seiner neuen Würde und der damit verbundenen
neuen Freiheiten gern erfreut.
Zu Beginn seiner Regierungszeit genießt er es, seiner
Lust an ausschweifenden Vergnügungen freien Lauf
zu lassen, seine Sturm- und Drang-Zeit auszuleben.
Deshalb sieht es Anna Amalia sehr gern, daß der äl-
tere und mittlerweile doch sehr viel reifere Goethe
mäßigend auf ihn einzuwirken versucht, nicht als of-
fiziell beauftragter Erzieher, sondern
als Vertrauter und Freund.
Dennoch erregt das genialische
Treiben der jungen Leute beträcht-
liches Aufsehen im Land, zumal
höfische Ordnung und Etikette aus-
gedient zu haben scheinen. Da wird
übermütig geritten, Schlittschuh ge-
laufen, im kalten Fluss gebadet, mit
den Dorfmädchen – besonders in
Stützerbach und Ilmenau – gefeiert
und wohl nicht nur das.
Die Kunde von solchem Tun er-
reicht auch Klopstock in Hamburg,
der Goethe im Mai 1776 einen
Mahnbrief schreibt. Goethe ant-
wortet tags darauf kurz, aber ent-
schieden: Verschonen Sie uns
künftig mit solchen Briefen, lieber
Klopstock...
Nun, auch diese Zeit überlebt sich. Wie man auch
immer damals und heute darüber urteilen mag:
Geistlos sind diese Späße und Spiele nie – und da-
neben beschäftigt man sich wie selbstverständlich
ganz ernsthaft mit philosophischen Gesprächen und
musischem Tun. Goethe berichtet, wie er oft näch-
telang mit Carl August über ernsthafte Themen dis-
kutiert habe.
Werfen wir einen Blick auf die Menschen, die da-
mals zum Hofleben gehörten und das Geschehen im
sogenannten Musenhof mitbestimmten. Neben den
oben Genannten gehören dazu natürlich auch die
Herzogin Luise sowie der Jurist Friedrich von Ein-
siedel, seit 1775 Hofrat in Weimar
und Kammerherr bei Anna Ama-
lia.
Ein Ereignis besonderer Art ist die
Ankunft Johann Gottfried Herders
in Weimar. Gegen beträchtlichen
Widerstand hat Goethe mit Hilfe
des Herzogs durchgesetzt, daß
Herder – damals Hofprediger in
Bückeburg – die vakante Stelle
des Superintendenten in Weimar
erhält. Damit hat Goethe den
Mann in seine Nähe geholt, dem
er seit den Straßburger Tagen so
viel zu verdanken hat. Herder
bleibt wie Goethe Zeit seines Le-
bens in Weimar.
Im April 1776 erwirbt Carl Au-
gust das Gartenhaus an der Ilm
und schenkt es Goethe. Mehrere
Jahre bleibt es zunächst sein
Hauptwohnsitz, bis er im Juni 1782 in das Haus am
Frauenplan umzieht.
Im Juni 1776 will der Herzog seinen Freund Goethe
in das Geheime Consilium, das oberste Gremium
der Staatsregierung, aufnehmen. Carl August
möchte damit Goethe politische Verantwortung
übertragen, weil er seinen Rat schätzt und wohl
auch, um ihn an Weimar zu binden. Er setzt dies
gegen starken Widerstand durch, insbesondere
gegen den Freiherrn von Fritsch, der erst durch
Anna Amalias Eingreifen vom Rücktritt zurückge-
halten werden kann. Mit Goethes Vereidigung und
seiner Ernennung zum »Geheimen Legationsrat«
beginnt seine staatsmännische und administrative
Tätigkeit, die er sehr ernst nimmt und die bis an sein
Lebensende dauern wird.
Prof. Dr. Ekkehart Krippendorff (Berlin)
Das Publikum nicht wie Pöbel behandeln…
Politische Dimensionen der
Weimarer Theaterarbeit
Prof. Dr. Katharina Mommsen (Palo Alto)
Dem alten Fritz bin ich recht nah geworden…
Goethes berufliche Auseinandersetzung
mit Friedrich II.
111
Die fast elf Jahre des
ersten Weimarer Jahr-
zehnts vom November
1775 bis zum 3. Sep-
tember 1786 – seinem
Aufbruch nach Italien –
sind ein Abschnitt von
besonderer Bedeutung
für Goethe. Seine kom-
munale und staatspoli-
tische Tätigkeit wird
nun immer mehr zum
Mittelpunkt seines Le-
bens, wohl nicht ganz ungewollt, denn letztendlich
ist dies auch der Grund, in Weimar zu bleiben. Er
will an der Gestaltung des Gemeinwesens mitwir-
ken.
Bleiben wir vorerst noch beim »Musenhof«: Anna
Amalia bewohnt seit dem Schlossbrand von 1774
das Wittumspalais, das vorher dem Freiherrn
von Fritsch gehört hatte und nach einem
Umbau für Jahre ihr Hauptwohnsitz wird.
Später kommen Tiefurt und Schloss Belve-
dere dazu.
Hier finden nun allwöchentlich die berühm-
ten Tafelrunden statt, die Georg Melchior
Kraus in seinem bekannten Gemälde festge-
halten hat. Anna Amalia, Goethe, Herder,
Graf Einsiedel, Fräulein von Göchhausen u.a.
sind darauf zu sehen. Diese Zusammenkünfte
werden zum Symbol für alle musischen Un-
ternehmungen am Hofe zu Weimar. Man
trifft sich zu Gesprächen über Kunst, Musik,
Literatur, Malerei und Theater; auch gesell-
schaftspolitische Themen werden angesprochen,
und nicht selten prallen auch die Meinungen auf-
einander.
Den Mittelpunkt des »Musenhofes« bildet das so-
genannte Liebhabertheater, in dem ausschließlich
Laien die Akteure sind. Seit Goethes Ankunft
kommt es nun so richtig in Schwung. Hat man Lust
zu spielen, dann trifft man sich. Goethe kümmert
sich sofort nach seiner Ankunft um die Inszenierun-
gen, führt zwei unterschiedliche Gruppen zusam-
men und ist bald zuständig für die Planung, die
Proben, die Dekorationen, die Stücke, die geschrie-
ben werden müssen, und bald ist er selbst auch als
Schauspieler aktiv.
Da das einstige Schloßtheater mit dem Brand von
1774 zerstört war, spielt man zuerst im sogenannten
Redoutenbau, später im Saal des Wittumspalais, in
Schloß Ettersburg auf dem Ettersberg oder in Tie-
furt, in Belvedere oder an der Ilm im Park zu Wei-
mar, auch in den Dornburger Schlössern.
Die aufgeführten Stücke sind bunt gemischt:
Possen, Schwänke, Singspiele, aber auch an-
spruchsvolle Theaterstücke. Von Goethe standen
auf dem Spielplan u.a.: Erwin und Elmire, Die
Geschwister, Die Mitschuldigen, Lila, Das Jahr-
markstfest von Plundersweilern, Triumph der
Empfindsamkeit, Iphigenie, Die Laune des
Verliebten, Proserpina, Jery und Bätely, Die
Vögel, Die weiblichen Tugenden, Die Fische-
rin. – Diese Liste ist keineswegs vollständig.
Zwischen 1775 und 1782 werden etwa 60 In-
szenierungen des Liebhabertheaters realisiert;
also neun neue Stücke pro Jahr auf den ver-
schiedenen Bühnen und in freier Natur.
Goethe gelingt es, im November 1776 die
Sängerin und Schauspielerin Corona Schröter
nach Weimar zu holen, die er schon während
seiner Leipziger Zeit kennen und schätzen ge-
lernt hat. Sie wird sehr bald die einzige pro-
fessionelle Stütze des Liebhabertheaters sein.
112
Die schöne Schauspie-
lerin, die auch mehrere
Sprachen beherrscht,
malt und mehrere Mu-
sikinstrumente spielt,
beschäftigt die Phanta-
sien des Herzogs und
Goethes ganz erheb-
lich. Schließlich läßt
der Herzog gegenüber
dem Wittumspalais ein
neuesTheater erbauen.
Besonders die Zeichenkunst zählt zu den tragenden
Säulen des »Musenhofes«. Die Begeisterung für die
Darstellung der Natur mit dem Zeichenstift teilt
Anna Amalia mit Goethe. Dieser zieht häufig mit
der Zeichenmappe
durch die Weimarer
Umgebung und hält die
Natur mit dem Stift fest.
Zuweilen schwankt
Goethe zwischen seinen
literarischen Ambitionen
und denen zur bildenden
Kunst, glaubt er doch
durch Übung und Unter-
richt bei erfahrenen Meistern der Zeichenkunst die
gleichen Erfolge haben zu können wie in der Lite-
ratur.
Seine kommunal- und staatspolitische Tätigkeit
nimmt Goethe von Anbeginn sehr ernst. Er will den
Einfluß auf den Herzog behalten und ihm ist nicht
nur daran gelegen, die praktische Politik zu beein-
flussen., sondern er will auch Ergebnisse erreichen,
wie etwa die erneute Inbetriebnahme des Ilmenauer
Bergwerks.
Zwar werden im mindestens
einmal wöchentlich tagenden
Consilium – mit den drei Mit-
gliedern und dem Herzog –alle
kommunalen Angelegenheiten
gemeinsam besprochen, den-
noch gibt es konkrete Auf-
gabenverteilungen. Goethes
Beamtentätigkeit erstreckt sich ab dem Jahre 1777
auf die Erneuerung des Bergbaus und ab 1779 auf
den Vorsitz zweier ständiger Kommissionen, der
Wegebaukommission und der Kriegskommission,
mit der Zuständigkeit für die Aushebung der Rekru-
ten für die Weimarer Armee.
Sein Hauptanliegen ist es, durch Einschränkung der
öffentlichen Ausgaben bei gleichzeitiger Förderung
der Wirtschaft den völlig verschuldeten Staatshaus-
halt zu sanieren. Dies gelingt zumindest teilweise,
z. B. führt die Halbierung der »Streitkräfte« zu Ein-
sparungen. Schwierigkeiten und die Erfolglosigkeit
seiner Bemühungen im Staatsdienst bei gleichzei-
tiger Arbeitsüberlastung lassen ihn zuweilen resig-
nieren. Goethe notiert 1779 im Tagebuch: Es weis
kein Mensch was ich thue und mit wieviel Feinden
ich kämpfe um das wenige hervorzubringen.
Durch Reisen mit dem Herzog macht sich Goethe
mit Land und Leuten vertraut. Seine Tätigkeiten
führen ihn unter anderem nach Apolda, dessen Not
er beschreibt, wie auch in andere Gebiete des Her-
zogtums. Zumeist im Rahmen dienstlicher Pflichten
unternimmt Goethe in seinem ersten Weimarer
Jahrzehnt mehrere Reisen auch über die Landes-
grenzen hinaus, darunter im Frühjahr 1778 eine
Reise nach Dessau und Berlin, von September 1779
bis Januar 1780 in die Schweiz sowie mehrmals in
den Harz.
1782 wird er vom Herzog zum Kammerpräsidenten
(Finanzminister) ernannt, in der Hoffnung, den
Staatshaushalt weiter zu konsolidieren. Er fördert
die Landwirtschaft, ist in der Kriegskommission,
der Wege- und Wasserbaudirektion sowie der Berg-
werkskommission tätig. Ab 1784 leitet er die Steu-
errevision im Kreis Ilmenau, außerdem ist er
Berater des Herzogs in Fragen der Außenpolitik
Hier noch kurz seine Entwicklung: im Juni 1776
wird er Legationsrat, im September 1779 Geheimer
Rat, im April 1782 wird er nobilitiert. Im gleichen
Jahr beschreibt Goethe im Gedicht Ilmenau das
Leben des Herzogs Carl August – vom zügellosen
Jugendtreiben zum jetzigen Wirken im Interesse des
Landes.
113
Wie dank' ich, Musen, euch!
Daß ihr mich heut auf einen Pfad gestellet,
Wo auf ein einzig Wort die ganze Gegend gleich
Zum schönsten Tage sich erhellet;
Die Wolke flieht, der Nebel fällt,
Die Schatten sind hinweg. Ihr Götter,
Preis und Wonne!
Es leuchtet mir die wahre Sonne,
Es lebt mir eine. schönre Welt;
Das ängstliche Gesicht ist in die Luft zerronnen,
Ein neues Leben ists, es ist schon lang begonnen.
So mög, o Fürst, der Winkel deines Landes
Ein Vorbild deiner Tage sein!
Du kennest lang die Pflichten deines Standes
Und schränkest nach und nach die freie Seele ein.
Der kann sich manchen Wunsch gewähren,
Der kalt sich selbst und seinem Willen lebt;
Allein wer andre wohl zu leiten strebt,
Muß fähig sein, viel zu entbehren.
So wandle du – der Lohn ist nicht gering –
Nicht schwankend hin, wie jener Sämann ging,
Daß bald ein Korn, des Zufalls leichtes Spiel,
Hier auf den Weg, dort zwischen Dornen fiel;
Nein! streue klug wie reich, mit männlich steter Hand,
Den Segen aus auf ein geackert Land;
Dann laß es ruhn: die Ernte wird erscheinen
Und dich beglücken und die Deinen.
Ilmenau am 3. September 1783
Goethes Freundschaft mit dem Herzog ermöglicht
das Einfließen aufklärerischen und liberalen Gedan-
kengutes auf einen regierenden Souverän.
Des Herzogs große Passionen, die Goethe beide
nicht teilt, sind die Jagd und das Militärwesen. Er
ist bestrebt, dem Vorbild seines Großonkels Fried-
rich II. nachzueifern und an seiner Seite militärische
Lorbeeren zu ernten. Daß er auf diesem Gebiet
gemäßigt wird, ist mit Sicherheit auf Goethes Ein-
fluß zurückzuführen.
Das anfängliche Sturm- und Drangtreiben, später
die Jagdleidenschaft des Herzogs, das Theaterspie-
len, die literarischen Unternehmungen der Hofge-
sellschaft, die Übungen im Zeichnen stellen Goethe
nach einigen Jahren nicht mehr zufrieden, zumal
seine schriftstellerischen und poetischen Aktivitäten
durch seine unzähligen Verpflichtungen immer wei-
ter eingeschränkt sind.
Im September 1783 bricht Goethe auf zu einer
Reise in den Harz. Die erste Nacht unterwegs ver-
bringt er auf einer kleinen Jagdhütte auf dem
Kickelhahn bei Ilmenau: Dort entstehen die be-
rühmten Verse:
Über allen Gipfeln ist Ruh
in allen Wipfeln spürest Du
kaum einen Hauch
Die Vöglein schweigen im Walde
warte nur: balde – ruhest Du auch.
Fast ein halbes Jahrhundert später wird Goethe am
Vorabend seines letzten Geburtstages noch einmal
die Hütte aufsuchen und die von ihm in die Bretter-
wand geritzten Verse lesen.
Wenig später wird er zu Eckermann bemerken: In
den ersten zehn Jahren meines Weimarer Lebens
habe ich so gut wie nichts gemacht; eigentlich war
es die Verzweiflung, die mich nach Italien trieb...
In Goethes Briefen der nächsten Monate schwingt
zuweilen nun ein mißvergnügter Unterton mit; als
Dichter hat er in diesen Jahren kaum noch etwas zu-
stande gebracht. Der Faust, die Iphigenie, der Tasso
und der Egmont liegen als Fragmente in der Schub-
lade. Die Amtstätigkeit im Dienste des Herzogs be-
lastet ihn zunehmend.
Ich darf mich nicht säumen, ich bin schon weit in
den Jahren und vielleicht bricht mich das Schicksal
in der Mitte und der Babylonische Turm bleibt
stumpf, unvollendet, schreibt er an einen Freund.
114
Meine Schriftstellerei subordiniert sich dem Leben,
schreibt er am 14. Mai 1784 an Kestner, doch er-
laube ich mir, setzt er mit einiger Ironie hinzu, nach
dem Beispiel des großen Königs, der täglich einige
Stunden auf die Flöte wandte, auch manchmal eine
Übung in dem Talente, daß mir eigentlich eigen ist.
Ab Mitte der 1780er Jahre,
auf dem Gipfel seiner Amts-
karriere, gerät Goethe in
eine Krise. Seine amtli-
chen Tätigkeiten bleiben
ohne Erfolgserlebnisse,
die Belastungen seiner
Ämter und die Zwänge des
Hoflebens werden ihm lästig,
die Beziehung zu Charlotte von
Stein gestaltet sich zunehmend unbefriedigend.
Als ihm der Verleger Göschen 1786 das Angebot
einer Gesamtausgabe macht, wird ihm schockartig
klar, daß von ihm in den letzten zehn Jahren nichts
Neues erschienen ist. Im Blick auf seine dichteri-
schen Fragmente Faust, Egmont, Wilhelm Meister,
und Tasso verstärkten sich die Selbstzweifel an sei-
ner Doppelexistenz als Künstler und Amtsmensch.
Nach der ernüchternden Erfahrung seiner dichteri-
schen Stagnation im ersten Weimarer Jahrzehnt
entzieht er sich schließlich dem Hof durch eine für
seine Umgebung unerwartete Bildungsreise nach
Italien.
Den Herzog hat er vor dem letzten persönlichen Zu-
sammensein in Karlsbad schriftlich um unbe-
fristeten Urlaub gebeten. Am 24. Juli schreibt er
ihm: Die Hoffnung den heutigen Tag noch mit Ihnen
zuzubringen hat mich nicht allein getäuscht, son-
dern auch um ein Lebe wohl gebracht. (…)
Ich dancke Ihnen daß Sie mich noch mit einem
freundlichen Worte beurlauben wollen. Ich gehe al-
lerley Mängel zu verbessern und allerley] Lücken
auszufüllen, stehe mir der gesunde Geist der Welt
bey! Behalten Sie mich lieb, empfehlen Sie mich
Ihrer Frau Gemahlinn, die ich mit herzlichen Freu-
den wohl verlassen habe, und leben selbst gesund
und froh.
Am 3. September 1786 bricht er ohne Abschied von
einer Kur in Karlsbad auf. Nur sein Sekretär und
vertrauter Diener Philipp Seidel ist eingeweiht.
Für die Zurückbleibenden mußte es wie eine Flucht
erscheinen. Goethe schreibt: Früh drei Uhr stahl
ich mich aus Karlsbad weg, man hätte mich sonst
nicht fortgelassen..., denn die Gesellschaft hatte
noch am 28. August auf sehr freundliche Weise mei-
nen Geburtstag gefeiert...
Aber er wird nach zwei Jahren wiederkommen und
bis an sein Lebensende in Weimar bleiben. Doch
auch nach seiner Rückkehr wird Goethe bis nahezu
an sein Lebensende die doppelte Herausforderung
annehmen: einerseits als Staatsminister zu wirken,
und gleichzeitig das wohl umfassendste dichteri-
sche Werk deutscher Sprache zu schaffen.
Hans-Hellmut Allers
115
2008
Goethes lebenslange Suche
Hans-Hellmut Allers (Berlin)
...daß ich erkenne, was die Welt
im Innersten zusammenhält.
Einführungsvortrag zum Jahresthema
Goethes lebenslange Suche
Prof. Dr. Ludolf von Mackensen (Kassel)
...die Chymie ist noch immer
meine heimlich Geliebte...
Goethe und die Alchemie
Prof. Dr. Hans-Jürgen Schings (Berlin)
Kommst Du nur immer anzuklagen –
Ist auf der Erde ewig Dir nichts recht?
Faust- die alte und die neue Schöpfung
Goethes 259. Geburtstag
in Schuberts Garten
Jürgen Thormann liest Johann W. Goethe
Meine Religion, mein Glaube
Daß ich erkenne, was die Welt
im Innersten zusammenhält...
Als Goethe seinen Doktor Faust im
Studierzimmer gleich zu Beginn
diesen Wunsch aussprechen lässt,
geht es keineswegs um die Erfor-
schung der Erdrinde, die ihn auch
sehr beschäftigt hat; vielmehr ist
mit dem Innersten hier die Esoterik
gemeint, die Suche nach der inne-
ren, spirituellen Erkenntniswahr-
heit, auf der sich Goethe sein
gesamtes Leben lang befindet.
Sein Protagonist ist ja auch nicht
von ungefähr kein Naturwissen-
schaftler, sondern ein Pendler zwi-
schen den Fakultäten; hat mit
heißem Bemühn studiert Philoso-
phie und sogar Theologie, auch ein
wenig Jura und Medizin, hat offen-
bar sogar als Arzt praktiziert wie
sein historisches Vorbild, der Alche-
mist, Astrologe, Magier und Wun-
derheiler Doktor Johann Faust. Und
nun erleben wir gerade, wie er sich
erklärtermaßen der Magie ergeben
hat und kabbalistische Zeichen in
einem Folianten von Nostradamus
eigener Hand studiert, um den Erd-
geist anzurufen.
Nun gut, dichterische Phantasie
könnte man meinen, doch weit ge-
fehlt. Als der 21-jährige Goethe
1770 in Straßburg diese Verse zu
Papier bringt, hat er gerade mehrere
Monate hinter sich, die er im elter-
lichen Hause, genesend von einer
lebensbedrohlichen Krankheit, mit
dem Studium der Alchemie und
Kabbalistik sowie der Kirchen- und
Ketzergeschichte verbracht hat.
Die intensive Beschäftigung mit
dem Vorhandensein einer unsicht-
baren geistigen Welt und deren
mannigfache Einwirkung auf unser
tägliches Leben ist keine Marotte
des jungen Studiosus. In allen Le-
bensabschnitten wird sich Goethe
mit übersinnlichen und mysthischen
Phänomenen beschäftigen, mit den
Themen Prophezeiungen und Wie-
dergeburt; er liest Jacob Böhme,
Swedenburg und Spinoza und be-
kennt sich als zutiefst gottgläubig;
nur mit der Kirche hat er´s nicht so,
manifestiert sich für ihn doch der
allgegenwärtige Schöpfer in der
Natur und ihren sämtlichen Hervor-
bringungen.
Sein ausgeprägter Hang zu spiritu-
ellen Wahrheiten, zu einer jenseiti-
gen Geisterwelt, zu Aberglauben
und Astrologie durchzieht sein ge-
samtes dichterisches Werk.
Seine Autobiografie Dichtung und
Wahrheit leitet er ein mit einem Be-
kennntnis zur Astrologie, ausklin-
gend mit einer Darstellung des
Dämonischen. Zufall? Nach Goe-
thes Überzeugung gibt es keine Zu-
fälle, sondern nur Fügungen. B.S.
116
Prof. Dr. Volker Hesse (Berlin)
...doch im Innern scheint ein Geist
gewaltig zu ringen...
Goethes Ergründung der
Naturwissenschaften
Dr. Otto Krätz (Starnberg)
Wenn weise Männer nicht irrten,
müßten die Narren verzweifeln…
Chemische und physikalische Experimente
bei Goethe
Beate Schubert (Berlin)
Ein Wandelndes, das mit und um uns wandelt...
Esoterik in Goethes Leben und Werk
Prof. Dr. Theo Buck (Aachen)
Stirb und Werde!
Goethes Entelechie
Auszug aus dem Einführungs-
vortrag von Hans-Hellmut Allers:
Goethes Grundauffassung, seine per-
sönlichen Vorstellungen bezüglich der
bedeutendsten und wichtigsten Le-
bensthemen des Menschen, sein le-
benslanges Suchen nach Antworten
auf die großen Fragen, die sich Men-
schen stellen, sind nicht allein durch
Darstellen und Interpretieren biogra-
phischer Daten und Abläufe aufzuspü-
ren. Obwohl Goethe an der
Philosophie seiner Zeit trotz intensiver
Auseinandersetzung wenig Freude
hat, ist er doch ein wirklicher Philo-
soph, ein Freund der Weisheit im an-
tiken Sinn.
Die Philosophie der Antike verbindet
das Erkennen naturwissenschaftlicher,
mathematischer oder geisteswissen-
schaftlicher Zusammenhänge mit
allem, was menschliche Neugier und
menschliches Denken auf allen Gebie-
ten hervorbrachte. Goethe ist jedoch
kein Freund philosophischer Systeme,
sie erscheinen ihm künstlich oder kon-
struiert. Ihn treibt die Liebe zur Natur,
zu einer immer eingehenderen Be-
schäftigung mit naturwissenschaftli-
chen Fragen. In den Zahmen Xenien
heißt es: mein Kind, ich habe es klug
gemacht, ich habe nie über das Den-
ken gedacht.
Für Goethe ist die Erfahrung der Weg
zur Erkenntnis, nicht das Nachdenken
über das Denken. Zu den
Naturwissenschaften kommt Goethe
als Autodidakt. Er betreibt Wissen-
schaft so, wie er Wissenschaft von An-
beginn auffasst: Erfahren durch
Betrachten und Begreifen. Für Goethe
zählt, was sich aus sinnlich Erfahrba-
rem ableiten lässt. Natürlich spielt
auch das Experiment bei ihm eine
Rolle, aber eben nicht ausschließlich.
Als Bergbauminister kriecht er in
Stollen und Bergwerke, um Gesteine
und Mineralien zu betrachten und zu
begreifen. Er untersucht die Phäno-
mene des Magnetismus und der Elek-
trizität. Er notiert Barometerstände
und versucht, ein Netz zur Wetterbe-
obachtung und Wettervorhersage im
Herzogtum aufzubauen und er betreibt
anatomische Studien.
Goethes Haltung gegenüber der
Newtonschen Theorie der Lichtbre-
chung kann man getrost als feindselig
beschreiben. Er verteufelt alles, was
mit Zerlegen und Zerstückeln zu tun
hat. Für die Farben findet er die
schöne poetische Formulierung: Far-
ben sind Taten und Leiden des Lichts.
117
Nun sag! Wie hast du's mit der Religion? fragt Gret-
chen ihren Heinrich, den Doktor Faust, und dieser,
der in seiner Studierstube in der Osternacht einige
Szenen zuvor bekannt hat: Die Botschaft hör ich
wohl, allein mir fehlt der Glaube, weicht aus und
bequemt sich schließlich zu der Antwort: Gefühl ist
alles. Name ist Schall und
Rauch, Umnebelnd Himmelsglut.
– Wie aber hielt es Goethe selbst
mit Religion und Christentum?
Die Meinungen sind gespalten
und widersprechen einander.
Goethe war weder ein Religions-
verächter noch ein religiöser
Mensch im konfessionellen Sinn.
In einem Brief an Sulpiz Boisse-
rée vom 22. März 1831 schreibt
er, er habe keine Konfession ge-
funden, zu der ich mich völlig hätte bekennen
mögen. Stattdessen übte er schon früh Kritik an den
positiven Formen geoffenbarter Religion und der
Kirche und hielt sich schon in der Jugend an die
Vorstellung einer natürlichen Religion, nach der ein
höheres ordnendes Wesen nur in der Natur verbor-
gen spürbar sei.
Sein Leben lang suchte Goethe nach der wahren
Religion und fand sie zunächst und am ehesten in
der Natur. Alle Schöpfung ist Werk der Natur. Von
Jupiters Throne / Zuckt der allmächtige Strahl,
nährt und erschüttert die Welt.
(Vier Jahreszeiten)
Religion erschöpfte sich für Goethe nicht in mytho-
logischen Bildern und in austauschbaren Mytholo-
gemen, sondern galt ihm als eine besondere Sicht
auf die Welt, den Menschen und die Natur.
Schon früh hat sich der Dichter dazu bekannt: Gott
in der Natur, die Natur in Gott zu sehen. Bei der
Betrachtung von Schillers Schädel widmete er sei-
nem früh verstorbenen Freund einen Nachruf, an
dessen Schluss es heißt: Was kann der Mensch im
Leben mehr gewinnen, / Als daß
sich Gott-Natur ihm offenbare? /
Wie sie das Feste lässt zu Geist
gerinnen, / Wie sie das Geister-
zeugte fest bewahre.
Der Natur, der Goethe eine gera-
dezu religiöse Verehrung entge-
genbrachte, weil er sie mit Gott
gleichsetzte, ordnete er Willen,
Vernunft, Weisheit, Güte und
Liebe zu. Er war überzeugt von
dem Wirken einer höchsten
Macht in ihr und von dem schöpferischen Prinzip
der Polarität als einer dynamischen Kraft alles Wer-
dens, dem Naturgesetz von Anziehung und Absto-
ßung bei fortwährender Steigerung des Einfachen
auf die jeweils vollendete Form. Goethe war voll
Ehrfurcht vor dem Lebendigen in all seinen wahr-
nehmbaren Aspekten wie auch vor dem letztlich un-
erforschlichen Wirken des Göttlichen, in dem Welt
und Leben aufgehoben sind.
Religion ist für Faust wie für Goethe eine Sache des
Gefühls. Auch Faust blieb, nachdem er die Uner-
füllbarkeit seines Wunsches, daß ich erkenne, was
die Welt im Innersten zusammenhält, erkannt hat,
am Ende nur die Ehrfurcht vor dem unerforschli-
chen und unbegreiflichen Wesen der Welt, die Ehr-
furcht vor dem unfassbaren Gott, für den Faust
keinen Namen hat und den in Begriffe zu fassen, er
ablehnt.
Da die Religion für Goethe in erster Linie eine
Sache des Gefühls ist, bleibt sein Glaube auch wei-
terhin überwiegend ein gefühlsmäßiges Erfassen
und Erfaßtsein der Seele, weshalb er jede rationale
Bestimmung und Deutung der religiösen Gegen-
stände und Erlebnisse ablehnt.
Im Laufe seines Lebens entwickelte Goethe panso-
phistische, mystische und auch pantheistische Vor-
stellungen – wonach Gott identisch sei mit allem,
was ist. Das freilich sind Vorstellungen, die im
scharfen Gegensatz stehen zum christlichen und jü-
dischen Glauben. Goethe sieht sich daher wieder-
holt dem Vorwurf des Atheismus ausgesetzt,
obwohl er doch nur die Gegensätze zu vereinen ver-
suchte.
Für Goethe hat die Natur in die Existenz eines jeden
lebendigen Wesens so viel Heilungskraft gelegt,
daß es sich, wenn es an dem einen oder dem ande-
ren Ende zerrissen wird, selbst wieder zusammen-
flicken kann; und was sind die tausendfältigen
Religionen anders als tausendfache Äußerungen
dieser Heilungskraft, die ihnen innewohnt?
Die Frage, die Goethe gegenüber allem Religiösen
bewegt, ist das Problem, ob der Mensch in seiner
Identität durch religiöse Ansprüche vergewaltigt
werde oder ob er dabei er selbst bleiben dürfe. Ge-
Ursula Homann (Arnsberg)
Wie hältst Du´s mit der Religion?
Goethes Glaube und Gottesvorstellung
118
rade im Hinblick auf sein Ringen mit dem Chris-
tentum kreiste sein Denken immer wieder um die
Frage, ob und inwieweit das Christentum der Tra-
dition vom einzelnen Menschen angeeignet werden
könne, ohne die eigene Natur zu bedrohen.
Obwohl das Christentum
für Goethe eine in der
Regel mit Respekt regis-
trierte Religion ist und
die Luther-Bibel sein
Denken, seine Bilder-
und Gleichniswelt, ja
sogar seine Sprache zeit-
lebens tiefer geprägt und
ihn mehr gebildet hat als
irgendein anderes Werk,
so war das Christentum
für ihn später doch nur eine von mehreren Möglich-
keiten, der eigenen Existenz ein Fundament zu
geben.
Goethes Denken besaß in ihrer Vielschichtigkeit
und in ihrem Geistesreichtum eine ozeanische
Weite, die sicher größer war als die vieler anderer
Geistesgrößen. Er hat nicht nur eine einzige Reli-
gion vor Augen gehabt, sondern die Vielfalt aller
Religionen, die auf Gott und zugleich auf die
Menschheit – auf das Divinum und das Humanum
– ausgerichtet sind. Sein Humanismus wurzelt
ebenso in der griechisch-römischen Klassik wie im
Judentum und im Christentum. Ja, selbst fern-
östliche Motive sind dem Verfasser des West-östli-
chen Divans nicht fremd. Da gibt es weder
Einlinigkeit noch sind eindeutig Brüche und Abbrü-
che auszumachen.
Am 6. Januar 1813 schreibt Goethe in einem Be-
kenntnis zur Fülle des Seins und zur Vieldimensio-
nalität des religiösen Ich: Ich für mich kann bei den
mannigfachen Richtungen meines Wesens nicht an
einer Denkweise genug haben; als Dichter und
Künstler bin ich Polytheist, Pantheist hingegen als
Naturforscher und eins so entschieden als das an-
dere. Bedarf ich eines Gottes für meine Persönlich-
keit als sittlicher Mensch, so ist dafür auch schon
gesorgt. Die himmlischen und irdischen Dinge sind
ein so weites Reich, daß die Organe aller Wesen zu-
sammen es nur erfassen mögen.
Goethe strebte danach, die religiöse Enge, in der er
aufgewachsen war und die ihn immer umgab, durch
eine umfassende lebensverbundene und Hoffnung
kündende Weite zu sprengen. Das Gefühl von
Größe und Freiheit war ihm wichtig. Daraus ergibt
sich auch, daß er sich ungern festlegte, noch weni-
ger, daß er sich festlegen ließ. Ob man ihn Pan-
theist, Atheist oder Christ nennen wollte, galt ihm
gleich viel, weil niemand recht wisse, was das alles
eigentlich heißen sollte.
Die lebenslange Beschäftigung mit der christlichen
Religion, den Religionen der Welt und mit kontro-
versen theologischen Interpretationen zeigt sich
nicht nur in seinem Werk, sie bestimmt auch Goe-
thes Leben insgesamt. Seine Sprachmächtigkeit,
seine Kunst und Ästhetik sind ohne die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Religion nicht zu ver-
stehen. Das erklärt auch, bei all seiner Ablehnung
des orthodoxen Protestantismus, Goethes ausdrück-
liche Bewunderung der sprachgeschichtlichen Leis-
tung Luthers.
Für Goethe, der mit den Entwicklungen der protes-
tantischen Theologie schon früh wohl vertraut war,
hatte der protestantische Gottesdienst jedoch »zu
wenig Fülle und Consequenz, als daß er die Ge-
meinde zusammen halten könnte« und: zu wenig
Sacrament.
Im Tagebuch vom 7. September 1807 notierte
Goethe: Der Protestantismus hält sich an die mora-
lische Ausbildung des Individuums, also ist Tugend
sein erstes und letztes, das auch in das irdische bür-
gerliche Leben eingreift. Gott tritt in den Hinter-
grund zurück, der Himmel ist leer und von
Unsterblichkeit ist bloß problematisch die Rede.
Dennoch hat er die geistesgeschichtliche Bedeutung
des Protestantismus erkannt und ihn überkonfessio-
nell gewürdigt: als Anre-
gung, als Widerstand
gegen Autoritäten, als
Befreiungsversuch und
als Aufklärung. Vor allem
als Befreiung der Geister
hat er ihn und Luther sehr
geschätzt. Religiöses
Denken im weitesten
Sinne grundiert mithin
Goethes Leben und Werk
und bestimmt seine Welt-
anschauung und Sprache.
Doch verfolgen wir erst einmal die Stufenfolge sei-
ner religiösen Erfahrung, von der frühen Protestan-
tismuskritik über pantheistische Glaubensinhalte
bis hin zum späteren Humanitätsideal und zur
Altersmystik.
119
Goethes Kindheit und Jugend waren streng luthe-
risch geprägt. Im Haus des Kaiserlichen Rates Jo-
hann Caspar Goethe waren der Kirchgang, der
Gebrauch des Gesangbuches und der Bibel selbst-
verständlich. Hinzu kamen die naive Frömmigkeit
der Mutter und der regelmäßige Religionsunter-
richt, den Goethe durch private Hebräischstunden
vertiefte. Außerdem regten ihn die biblischen Ge-
schichten, die er hörte und las, schon früh zu eige-
nen dichterischen Versuchen an.
Goethes Kindheit und Jugendzeit fielen in eine
Epoche des Umbruchs, in der religiöse Vorbilder,
Legenden und Heiligenviten ihre schützende Wirk-
kraft zu verlieren begannen und dem Individuum
mehr und mehr die Aufgabe des Mündigwerdens
übertragen wurde. Dennoch behielt die Religion,
obwohl man sie jetzt historisierend oder psycholo-
gisch zu deuten begann, auch an der Epochen-
schwelle und bei aller Kritik am Dogmatismus ihre
fundamentale Bedeutung noch lange Zeit bei.
Erste Erschütterung seines an den Katechismus ge-
bundenen naiven Kinderglaubens erfuhr Goethe
durch das Erdbeben von Lissabon im Jahr 1755.
Stellte dieses doch die damals allgemeine Überzeu-
gung in Frage, daß der Mensch sein Schicksal ganz
in der Hand habe. Der Glaube an die unerforschli-
che Güte Gottes wurde ebenso erschüttert wie die
optimistische Ansicht von dieser Welt als der besten
aller möglichen.
Wo waren noch Gerechtigkeit und Menschenliebe
Gottes, wenn er es zuließ, daß unterschiedslos
Schuldige und Unschuldige, Säuglinge und Greise,
Männer und Frauen, ohne gewarnt worden zu sein
und ohne sich wehren
zu können, im Nu da-
hingerafft werden?
Damit begann auch
bei Goethe ein erstes
Nachdenken über den
Sinn des Lebens.
Goethe übte schon früh Kritik an der protestanti-
schen Orthodoxie und an der für ihn enttäuschenden
Form des Luthertums, insbesondere an dem vom
Protestantismus geforderten Sündenbewusstsein.
Der kirchliche Protestantismus, wie er ihn in seiner
Jugend kennengelernt hatte, war ihm nur eine Art
trockener Moral.
Goethe schildert weiter, wie er – gegen den protes-
tantischen Konservatismus vor allem des Vaters –
mit eigenen Erfahrungen seine Weltanschauung
formte.
Goethes spätere Weltfrömmigkeit kündet sich über-
dies in dem Naturopfer des Knaben an, von dem
Goethe in seinen Erinnerungen ausführlich berich-
tet, wobei er allerdings
erfahren musste, wie ge-
fährlich es überhaupt
sei, sich Gott auf derglei-
chen Wegen nähern zu
wollen. Denn die Räu-
cherkerzen hatten bei
einer dieser Opferhand-
lungen in einem Zimmer
des Elternhauses be-
trächtlichen Schaden an-
gerichtet.
Goethe nahm in jungen Jahren beim Rektor
Albrecht Hebräischstunden, die ihn wiederum an-
regten, sich mit dem Alten Testament intensiver zu
beschäftigen. Das Resultat war, wie Goethe
schreibt, daß von den biblischen Völkern und Ge-
schichten eine lebhaftere Vorstellung in seiner Ein-
bildungskraft hervorging. Aber nicht nur das, er
begann auch, manche der alten Geschichten nach-
zudichten. Viele seiner leider nicht erhaltenen Ju-
gendwerke haben biblische Themen: Belsazar,
Isabel, Ruth, Selima.
Goethe verfaßte geistliche Oden und ahmte das
Jüngste Gericht von Elias Schlegel nach. Auch eine
Ode Zur Feier der Höllenfahrt Christi erhielt von
meinen Eltern und Freunden viel Beifall, und sie
hatte das Glück, mir selbst noch einige Jahre zu ge-
fallen. Das lange sechszehnstrophige Gedicht von
1765, das gegen Goethes Willen in der Frankfurter
Wochenschrift Die Sichtbaren gedruckt wurde, ver-
harrt in Thematik und künstlerischer Ausgestaltung
noch ganz im Bann der Tradition.
Im Oktober 1765 ging Goethe zum Studium nach
Leipzig. Dort ergriff ihn Skepsis in einer Stadt, die
sich gegenüber dem engen und provinziellen Frank-
furt als Zentrum der deutschen Aufklärung und des
Rokoko durch weltläufige Eleganz auszeichnete.
Mit Freunden führte er Gespräche über Fragen der
Ästhetik, der Gesellschaft, der Psychologie und der
Religion. Besonders die pietistischen Thesen, die
der angehende Theologe Ernst Theodor Langer in
manchen nächtlichen Zusammenkünften vortrug,
bei denen eifrig über Bibel und Christentum disku-
tiert wurde, wirkten über viele Jahre noch in Goethe
nach.
120
Eines Nachts bricht Goethe mit einem Blutsturz zu-
sammen. Langer, der mit Goethe auf dem gleichen
Flur wohnt, nimmt sich seiner an. Er kehrt 1768
nach Frankfurt zurück als ein an Körper und Seele
Leidender.
Goethe war gleichsam als ein Schiff-
brüchiger in das Elternhaus zu-
rückgekommen und befand sich
weiterhin auf der Suche nach um-
fassenden Antworten auf die
Frage nach dem Sinn des Daseins
und intensivierte seinen Kontakt
mit der Pietistin Susanna Katharina
von Klettenberg, die in ihm ein nach
einem unbekannten Heile strebendes Wesen ent-
deckte.
Bei Frau von Klettenberg las
er auch mystische, che-
misch-alchimistische Bü-
cher der Neuplatonischen
Schule, um die Geheimnisse
der Natur im Zusammen-
hang kennen zu lernen. Von
großem Einfluß war Gott-
fried Arnolds Kirchen-und
Ketzer-Geschichte, deren
geschichtsspekulative Leh-
ren Goethes weitere Religi-
onsentwicklung nachhaltig bestimmten und
vielfach in seinem Werk aufzuspüren sind, vom
Werther bis zur Farbenlehre.
Die pietistische Phase fand in Goethes späterem
Leben allerdings keine Fortsetzung, im Gegenteil.
Goethe fühlte sich auf die Dauer zunehmend abge-
stoßen von Heuchelei, Schwärmertum und der
Weltabkehr der Stillen im Lande, wie sie halb im
Scherz, halb im Ernst genannt wurden, jener from-
men Seelen, welche ohne sich zu irgend einer Ge-
sellschaft zu bekennen, eine unsichtbare Kirche
bildeten.
Bewußt bildete Goethe sich nun mehr und mehr
seine eigene Religion, welcher der neue Platonis-
mus zu Grunde lag. Das Hermetische, Mystische,
Kabbalistische gab auch seinen Beitrag her, und so
erbaute ich mir eine Welt, die seltsam genug aus-
sah.
(Dichtung und Wahrheit, 8. Buch, S. 350).
Mehr und mehr fühlte er sich vom Neuplatonismus
Plotins angezogen, der lehrte, daß sich die Seele des
Menschen durch Ekstase und mystische Vision mit
dem Ursprung, mit dem Allwesen wiedervereinigen
könne.
Nach Überwindung seiner Krankheit ging Goethe
nach Straßburg, wo er sein Jurastudium beendete.
Dort lernte er den pietistischen
Schriftsteller und Arzt Johann
Heinrich Jung-Stilling kennen,
den Autor Jakob Michael Rein-
hold Lenz, den Theologen Franz
Christian Lersé und Zinzendorfs
Nachfolger in Marienborn, Au-
gust Gottlieb Spangenberg. Be-
sonders folgenreich war die
Begegnung mit Johann Gottfried
Herder, den er später als Generalsuperintendenten
nach Weimar holen sollte und von dem er eine Fülle
religiöser und theologischer Anregungen empfing.
Herder hielt Goethe zur Beschäftigung mit dem
Koran an und vermittelte ihm eine historisch-kriti-
sche Betrachtung der Bibel, wobei diese nicht im
Sinne göttlicher Offenbarung, wie sie Lavater
pflegte, verstanden wurde, sondern als historisch-
religiöses Traditionswerk, das nicht in Glaubens-
dingen, wohl aber in historischen Aspekten der
Kritik offen steht.
Vor allem wirkte die Begegnung mit Johann Caspar
Lavater, der zwar kein Pie-
tist, aber ein bizarrer Christ
war, auf den immer kriti-
scher werdenden Straßbur-
ger Studenten Goethe als
Provokation. Mit ihm be-
ginnt er einen zehn Jahre
währenden Briefwechsel,
der sich in erster Linie um
religiöse Fragen dreht.
Goethe fühlt sich von Lavaters ausschließlichen In-
toleranz abgestoßen und verkraftet nicht, daß die-
ser, obwohl menschlich das toleranteste,
schonendste Wesen, sich als Lehrer einer ausschlie-
ßenden Religion darstellt. Demgegenüber macht
Goethe seine Ansprüche auf Vielfalt und Toleranz
deutlich.
Mein Pflaster schlägt bei dir nicht an, deins nicht
bei mir. In unsers Vater Apotheke, schreibt Goethe
in einem Brief vom 4. Oktober 1782 an Lavater,
sind viele Rezepte. Und: Was sind die tau-
sendfältigen Religionen anders als tausendfache
Äußerungen dieser Heilungskraft, die ihnen inne-
wohnt?
121
Am 8. Januar 1777 richtet Goethe an Lavater fol-
gende Zeilen: Dein Durst nach Christus hat mich
gejammert. Du bist übler dran als wir Heiden, uns
erscheinen doch in der Noth unsre Götter.
Schließlich äußert Goethe gegenüber Lavater den
Satz, er, Goethe, sei zwar kein Widerchrist, kein Un-
christ, aber doch ein dezidierter Nichtchrist. Der
Protest des jungen, nach geistiger Unabhängigkeit
strebenden Genius gegen alle orthodoxe und pietis-
tische Einengung wird gerade durch die missionari-
schen Tendenzen Lavaters, aber auch Jacobis
ausgelöst.
Du nennst das Evangelium die göttlichste Wahr-
heit? Mich würde eine vernehmliche Stimme aus
dem Himmel nicht überzeugen, daß das Wasser
brennt und das Feuer löscht und ein Weib ohne
Mann gebärt und ein Toter aufersteht; vielmehr
halte ich dies für Lästerungen gegen den großen
Gott und seine Offenbarung in der Natur. In diesem
Glauben ist es mir ebenso heftig ernst wie Dir in
dem Deinem.
(Goethe an Lavater am 9. 8. 1782)
.
Doch bekennt Goethe in Dichtung und Wahrheit:
Dieses Hin- und Widerschreiben, so heftig es auch
war, störte das gute Verhältnis nicht. Lavater hatte
eine unglaubliche Geduld, Beharrlichkeit, Ausdauer.
Die kraftgenialische Selbstbezüglichkeit des begin-
nenden Sturm und Drang ließ Goethe – nicht zuletzt
durch Herder – noch weiter von der Orthodoxie und
den pietistischen Ideen abrücken. Einen neuen Zu-
gang zur Religion fand er ab 1773 aber auch durch
den Pantheismus Baruch Spinozas, der Gott in der
gesamten Natur manifestiert sah.
In Dichtung und Wahrheit rühmt
Goethe Spinoza mit den Wor-
ten: Die alles ausgleichende
Ruhe Spinozas kontrastierte
mit meinem alles aufregenden
Streben.. und ..machte mich zu
seinem leidenschaftlichen
Schüler, zu seinem entschiedens-
ten Verehrer.
Unter dem Einfluß Spinozas kehrt er wieder zu
einer seinem Naturgefühl entsprechenden, dem
Pantheismus verwandten Naturfrömmigkeit zurück,
die sich am einfachsten und umfassendsten als
Diesseits- oder Weltfrömmigkeit umschreiben lässt.
Das bedeutet: Verehrung des ungreifbaren Höheren
als Ordnungsmacht in der Schönheit der Welt, Ein-
ordnung in die Gesetze des Daseins oder Schicksals
und eine tätig-nützliche mitmenschliche Lebensge-
staltung im schöpferischen wie sittlichen Sinn bei
weitgehendem Dahingestelltseinlassen der letzten
Fragen und Umgehung religiöser Spekulationen um
Jenseits, Unsterblichkeit und Seelenheil.
Die Befreiung von den Zwängen seiner Kindheit
und die Abkehr auch von neueren theologischen
Systemen findet ihren starken Ausdruck in den frü-
hen Dramen, Götz und Stella. In Götz von Berli-
chingen vertritt der Dichter eine religionskritische
Haltung, eine Art Befreiungstheologie. Himmlische
Luft! Freiheit! Freiheit! läßt er Götz vor seinem Tod
ausrufen, ganz im Sinne seines Ausspruchs: Was
vom Christentum gilt, gilt von den Stoikern, freien
Menschen ziemt es nicht, Christ oder Stoiker zu
sein.
Den Weg seiner frühen religiösen Entwicklung
bringt Goethe in Dichtung und Wahrheit in eine his-
torisch-systematische Abfolge. Aber lassen wir ihn
selbst zu Worte kommen: Man hat im Verlaufe die-
ses biographischen Vortrags umständlich gesehn,
wie das Kind, der Knabe, der Jüngling
sich auf verschiedenen Wegen dem
Übersinnlichen zu nähern gesucht,
erst mit Neigung nach einer na-
türlichen Religion hingeblickt,
dann mit Liebe sich an eine po-
sitive fest geschlossen, ferner
durch Zusammenziehung in sich
selbst seine eigenen Kräfte ver-
sucht und sich endlich dem allge-
meinen Glauben freudig hingegeben.
Als er in den Zwischenräumen dieser Regionen hin
und wieder wanderte, suchte, sich umsah, begeg-
nete ihm manches, was zu keiner von allen gehören
mochte, und er glaubte mehr und mehr einzusehen,
daß es besser sei, den Gedanken von dem Ungeheu-
ren, Unfasslichen abzuwenden. Er glaubte in der
Natur, der belebten und unbelebten, der beseelten
und unbeseelten, etwas zu entdecken, das sich nur
in Widersprüchen manifestierte und deshalb unter
keinen Begriff, noch viel weniger unter ein Wort ge-
fasst werden könnte.
Mit seiner Übersiedlung nach Weimar hatte Goe-
thes unbeschwerter, von dichterischer Produktion
bestimmter Frankfurter Lebensabschnitt geendet.
Die in Weimar mit dem Theaterspiel verbundene
höfische Welt bedeutete die Abkehr von der religiö-
sen Gefühlswelt seiner Jugend und die Hinwendung
zu einem unruhigen Leben gesellschaftlicher Ver-
122
pflichtungen. In dieser, der mittleren Periode seines
Lebens, erreichte Goethe die größte Entfernung von
der christlichen Religion.
Trotz seiner amtlichen Pflichten steht er in den ers-
ten Weimarer Jahren noch unter der Erfahrung der
befreienden Natur. Allmählich aber findet eine
historische Rückbindung durch die Antike statt. Ihre
Diesseitigkeit, ihre Einbeziehung des Göttlichen in
Natur und Lebenswelt korrespondierte mit Goethes
eigenen Überzeugungen.
Antikes begann er nun, sich als zeitlos Vorbildliches
anzueignen und von den Griechen zu träumen, als
dem Volk, dem eine Vollkommenheit, die wir wün-
schen und nie erreichen, natürlich war. Die antike
Götterwelt wird nun Motiv zahlreicher Gedichte.
Goethes Wendung zur Antike ist persönlicher Aus-
druck des welthistorischen Konflikts zwischen dem
Polytheismus und dem Monotheismus, zwischen
Heidentum und Christentum. In der Antike sah er
eine humane und zugleich religiöse Form des Hei-
dentums, zu der er sich selbst mehrfach bekannte.
In Italien wird seine Religionsauffassung sowohl
durch die Begegnung mit dem Katholizismus als
auch durch weitere Einsichten in die antike Mytho-
logie vertieft. Denn sein Besuch in Italien schenkte
ihm sowohl die überwältigende Präsenz der Antike
als auch die Begegnung mit dem Alltags-Genius ita-
lienischen Volkslebens. Auf seiner Italienreise
fühlte er sich mitunter zu sehr von Katholiken um-
geben und meinte, daß ein unförmiges, ja barockes
Heidentum auf ihm laste. Dann wieder pries er
Geschmack und Würde päpstlicher Zeremonien in
Sankt Peter und verfolgte mit Ergriffenheit die Ge-
sänge der Karfreitagsliturgie. Hinterher meinte er:
Ich hätte in dieser Stunde ein Kind oder Gläubiger
sein mögen.
Doch neigte er dem katholischen Glauben keines-
wegs voll und ganz zu, vielmehr gebrauchte er ihn
als Mittel, um den ihm fremden Menschen nahe zu
kommen, also zur Erweiterung seines Welt- und
Menschenbildes.
Goethe war wohl überzeugt, daß Gott sich auch und
vor allem in der Kunst verberge und offenbare, aber
ausgesprochene christliche Kunst als Ausdruck
christlichen Glaubens war ihm unerträglich, und wo
ihm der Katholizismus in barocker Überladung und
kindlichem Aberglauben begegnete, verachtete er
ihn als menschliche Geschmacklosigkeit von sei-
nem rein ästhetischen Standpunkt aus.
Nach Lutherart ärgerte er sich über das Babel Rom,
das, wie er 42 Jahre nach seinem Italienaufenthalt
schrieb, mit Christus nichts zu tun habe, den man,
käme er zurück, auch zum zweiten Male kreuzigen
würde.
Nur die Renaissance fand mit Raffael und den Bau-
ten Palladios noch Gnade vor seinen strengen Bli-
cken und seinem Empfinden, während die
Peterskirche und Michelangelo ihm nur widerwil-
lige Bewunderung abzwangen. In Italien steigerte
sich seine Ablehnung von Außerweltlichkeit, Eng-
herzigkeit und Sinnenfeindlichkeit des Christen-
tums bis hin zum Vorwurf von Täuschung, Irrtum
und lebensfeindlichem Aberglauben. Auf der ande-
ren Seite haben Goethes Einfühlung in Sakrament
und Symbol, sein tief verwurzelter Respekt vor dem
Unerforschlichen und den Schranken der mensch-
lichen Vernunft gerade katholische Philosophen und
Theologen sehr beeindruckt.
Die Freundschaft mit Schiller, dem Goethe am 9.
September 1788 zum ersten Mal im Hause von Frau
von Lengefeld in Rudolstadt begegnet war, hat ihn
in weltanschaulichen und religiösen Fragen für
Ideen geöffnet. Unter seinem Einfluß wird Goethes
Religion philosophisch und weltanschaulich. Der
Begriff Freiheit, der dem Naturglauben entgegen-
steht, wird nun Gegenstand seines Nachdenkens
und seiner Dichtung.
123
Goethe war kein Kirchenchrist oder Konfessiona-
list. Von allzu frömmelnden Zeitgenossen abgesto-
ßen, hat er sich dennoch nicht der zu seiner Zeit
schon weit verbreiteten agnostischen oder atheisti-
schen Version neuzeitlicher Aufklärung zugewandt.
Für Goethe war die Bibel das verbindende Urdoku-
ment der Menschheit. Im Hinblick auf ihre Entste-
hungs-, Wirkungs- und Auslegungsgeschichte
erklärte er: Die Bibel, das sind 3000 Jahre Mensch-
heitsgeschichte.
Zeitlebens hat er sich mit der Bibel auseinander ge-
setzt, nur gelegentlich hat er religiöse Fragen expli-
zit formuliert, meist bilden sie den Subtext seiner
Werke und Schriften. Goethe hat das Nachdenken
über Religion in einzigartiger Weise in sein Werk
und in seine Sprache integriert. Farbenlehre, Dich-
tung und Wahrheit, West-östlicher Divan sind die
großen Werke zwischen 1810 und 1820. Sie alle
spiegeln Goethes religiöse Einstellung und zeigen
die Ausweitung seiner religiösen Überzeugungen
ins Allgemeine, in philosophischer, biographischer
und kulturgeschichtlicher Hinsicht.
Auch für seine Farbenlehre greift Goethe auf das
Modell von Polarität und Steigerung zurück, das er
als Grundstruktur des Lebens und Denkens begreift.
Gerade die Farbenlehre hat ausgeprägte theologi-
sche Elemente und stellt eine kryptotheologische
Dogmatik dar (Albrecht Schöne). Die Verbindung
von Gott und Licht ist ein altes Motiv, das Goethe
aufgreift und in den verschiedenen Kontexten ein-
setzt. Das Licht ist eine der ursprünglichen, von
Gott erschaffenen Kräfte und Tugenden, welches
ein Gleichnis in der Materie darzustellen sich be-
strebt. Auch im West-östlichen Divan wird die
Verbindung von Gott und Licht mehrfach an-
gesprochen.
»Metamorphose«, ein weiterer Zentralbegriff der
naturwissenschaftlichen, voran der morphologi-
schen Schriften Goethes, enthält ebenfalls eine
religiöse Dimension: die Verwandlung, die Trans-
formation von einem Zustand in einen anderen, von
einer tieferen zu einer höheren Stufe.
Ferner ist der
Faust, an dem der
Dichter wohl sech-
zig Jahre seines
Lebens gearbeitet
hat, übervoll von
Zitaten und An-
spielungen aus der
Bibel. Schon der Prolog beginnt alttestamentlich.
Die Wette um Fausts Seele beruht auf Anregungen
aus dem Buch Hiob, ebenso der Lobgesang der
Engel. Der Autor sieht eine gewisse Ähnlichkeit
zwischen Faust und Moses, beide durften das ge-
lobte Land nicht betreten.
Im Werther ist gleichfalls eine Fülle alttestament-
licher Bilder und Reminiszenzen verwoben, ebenso
im Götz von Berlichingen, in Clavigo, Stella, im
Prometheus-Fragment, Egmont, selbst in der Iphi-
genie – Die Götter rächen der Väter Missetat nicht
an dem Sohn, ein jeglicher, gut oder böse, nimmt
sich seinen Lohn mit seiner Tat hinweg. – , in Die
Wahlverwandtschaften, Hermann und Dorothea
und in vielen der Goethe’schen Gedichte.
Die Wanderjahre von 1821 räumen der christlichen
Religion eine besondere Stellung unter den Religio-
nen ein. Die wahre Religion besteht in der Ehrfurcht
vor sich selbst. Das ist die höchste Stufe, zu der ein
Mensch geführt werden kann. Vor allem Goethes
Alterswerk Wilhelm Meisters Wanderjahre zeigt
deutlich, daß Goethe bis in sein Alter hinein dem
Alten Testament die immer gleiche Liebe und Ehr-
furcht erwiesen hat.
Biblische Bilder und Sprachverwendungen durch-
ziehen aber nicht nur sein gesamtes Werk, sondern
auch seine Briefe, besonders die an Zelter und Ja-
cobi, sowie seine Gespräche. Goethe ging sogar so
weit zu sagen, beim Glauben (...) komme alles da-
rauf an, daß man glaube; was man glaube, sei völ-
lig gleichgültig. Der Glaube sei ein großes Gefühl
von Sicherheit und Zukunft, und diese Sicherheit
entspringe aus dem Zutrauen auf ein übergroßes,
übermächtiges und unerforschliches Wesen.
Der Glaube ist nicht der Anfang, sondern das Ende
allen Wissens, befand Goethe, doch war er alles an-
dere als ein Rationalist, in dessen Denkgebäude
Gott allenfalls als gedanklicher Schlußstein, als In-
haber der allerhöchsten Vernunft einen Platz gehabt
124
hätte. Gott war für ihn dagegen lebendige Urkraft,
vor dessen unerforschlicher Majestät er eine rin-
gende, auch nach Worten ringende ehrfürchtige
Sehnsucht fühlte.
Das Wort Gott findet sich bei
Goethe verhältnismäßig selten.
Lieber gebrauchte er Umschrei-
bungen wie das Unendliche, das
Ungeheure, das ewig Wirkende,
der Weltgeist«, die Weltseele, das
unbekannte höhere Wesen, die
waltenden Mächte, das Ewig-
Eine in schier grenzenloser Man-
nigfaltigkeit.
Goethe wußte auch, daß Menschen sich Gott nach
ihren eigenen Vorstellungen formen und meinte
daher: Wie einer ist, so ist sein Gott / Darum ward
Gott so oft zum Spott und gegenüber Schiller be-
tonte Goethe am 31. 7. 1799, daß sich jeder seine
eigene Art von Gott macht und daß man niemand
den seinigen weder nehmen kann noch soll. (...) Ich
glaube einen Gott, ist ein schönes löbliches Wort,
aber Gott anerkennen, wie und wo er sich offenbart,
das ist eigentlich die Seligkeit auf Erden, hat Goethe
1829 aphoristisch resümiert. Das Göttliche zu ent-
hüllen, wo es sich auch verberge, war sein Anlie-
gen. Zugleich war er bemüht, das, was er wirklich
glaubte, zu verhüllen oder in ein poetisches Bild zu
fassen.
Der Hauptimpuls geht auch diesmal von dem eben-
falls vom Neuplatonismus inspirierten Philosophen
Spinoza aus. Gott dürfe, so Goethe, nicht ins Jen-
seits und Abseits verbannt werden, er gehöre ins
Diesseits. Zudem ist Gott für Goethe kein Klein-
geist, sondern der Weltgeist, der alle Grenzen
sprengt, er ist das Ein und Alles des Menschen, eine
Kraft, die ihn vorantreibt. Goethe sieht, wie schon
mehrfach angedeutet, mithin Gott nur in der Welt.
Ein höchstes Wesen anzunehmen,
vom Göttlichen, auch von Gott zu
sprechen und auf eine sinnvolle
Ordnung des Ganzen, des Sicht-
baren und Unsichtbaren zu ver-
trauen, war Goethe lieb und
geläufig. Dazu bedurfte er nicht
des christlichen Auferstehungs-
glaubens und der kirchlichen
Riten, die ihn zeitweilig faszinierten und dann wie-
der abstießen. Für ihn blieb entscheidend, was aus
der Kraft eines Glaubens, die er respektieren, ja be-
wundern konnte, an Lebensförderlichem resultierte.
Nicht Tod und Auferstehung Jesu waren daher für
ihn lebensentscheidende Fakten, sondern nach auf-
klärerischer Tradition Jesu Leben als Vorbild eines
einmaligen Menschen, vor dem Ehrfurcht ange-
bracht sei.
Diese verstand Goethe in dreifacher Weise: Ehr-
furcht gegenüber dem, was über uns, neben uns und
unter uns ist. So repräsentiert diese auch die drei
wirklich »echten« Religionen: die ethnische, die
philosophische und die christliche Religion. Die
erste ist die des Alten Testaments, die zweite die der
klassischen Weisheit, zu der nicht nur die grie-
chische Philosophie, sondern auffälligerweise bei
Goethe auch Christus gehörte. Die höchste Stufe
aber sei die dritte, die christliche Religion, ein Letz-
tes, wozu die Menschheit gelangen konnte und
musste. Es ist die Nächstenliebe und die Agape,
auch das Mitleid, das Hybris und Größenwahn des
Menschen ausschließt, die aber auch Niedrigkeit
und Armut, Spott und Verachtung, Schmach und
Elend, Leiden und Tod als göttlich anzuerkennen
vermag. Selbst Sünde und Verbrechen vermögen
Fördernisse des Heiligen zu werden.
Bei aller Anerkennung der sittlichen und sozialen
Aufgaben der Kirche wendet sich Goethe schon
früh einem, zur allgemeinen Humanität verklärten
unkirchlichen Christentum zu.
Goethe hat sich in seinen Dichtungen hin und wie-
der des Kreuzes bedient und dabei auf Schwach-
stellen und Angriffspunkte im Christentum
aufmerksam gemacht. Mir willst Du zum Gotte ma-
chen, solch ein Jammerbild am Holze! fragt er in
den Venezianischen Epigrammen und im Divan.
Mit dem Fundament des Christentums, der Theolo-
gie des Gottessohns und Erlösers, dem Märchen
von Christus, konnte er sich nie befreunden und
noch weniger mit dem leidigen Marterholz. Laut
Goethe war dies das Widerwärtigste unter der
Sonne, das kein vernünftiger Mensch auszugraben
und aufzupflanzen bemüht sein sollte. – Es werden
wohl noch zehntausend Jahre ins Land gehen, und
das Märchen vom Jesus Christus wird immer noch
dafür sorgen, daß keiner so richtig zu Verstande
kommt.
Die Apotheose des Leidens am Martergerüst, über-
haupt die christliche Verdrossenheit, die die Welt
zum von der Erbsünde kontaminierten Jammertal
entwertet, stieß ihn ab, um so mehr lobte er am
125
Islam eine lebensfrohe Diesseitigkeit, die selbst
noch die Jenseitsvorstellungen bestimmt.
Goethe hatte überdies zu Leid und Tod ein ambiva-
lentes, ja gestörtes Verhältnis. So erklären sich wohl
auch die Emotionen, mit denen er das Kreuz Christi
gelegentlich attackierte. Ihn störte
vor allem die Darstellung der Ma-
terinstrumente bei der Kreuzigung
und die des Todes Jesu. Er wollte
nicht den Gekreuzigten, er wollte
den Auferstandenen dargestellt
wissen.
Goethe stand schon früh der Theo-
logie und Kirche wesentlich frem-
der gegenüber als der christlichen
Religion überhaupt. Daran hatte
seine einstige zeitweilige Hinwen-
dung zur christlichen Religion
unter dem Einfluße Langers auch
nichts geändert. So schrieb er an
Langer: Für eine Seele, wie meine,
war es alten Priestern der Welt un-
möglich, sie zu rühren, besonders
bei dem unevangelischen Gewä-
sche unserer Kanzeln.
Er war überaus empfindlich gegenüber aller Heu-
chelei. Zwischen wesentlichem Kern und äußerer
Schale unterschied Goethe auch beim Christentum,
wo er gar viel Dummes in den Satzungen der Kir-
che« fand. »Aber sie will herrschen, und da muß sie
eine bornierte Masse haben, die sich duckt und ge-
neigt ist, sich beherrschen zu lassen. Die hohe reich
dotierte Geistlichkeit fürchtet nichts mehr als die
Aufklärung der unteren Massen. Sie hat ihnen auch
die Bibel lange genug vorenthalten.
Auch wenn Goethe mit der christlichen Staatskirche
nichts im Sinn und seine geistige Arbeit nie der Kir-
che gegolten hatte, so blieb er doch sein Leben lang
Mitglied der Kirche. Offiziell hat
er mit dem institutionalisierten
Christentum nie gebrochen. Er ließ
seinen Sohn August und die ande-
ren, früh verstorbenen Kinder tau-
fen, ließ August 1802 durch
Herder konfirmieren und wohnte
selbst der Konfirmandenlehre bei.
1806 heiratete er kirchlich und
hatte zehn Jahre später gegen ein
christliches Begräbnis von Chris-
tiane nichts einzuwenden.
Lassen Sie uns vom Menschen
würdig denken, mahnte er 1799.
Seine Anthropologie erschöpfte
sich nicht darin, den Menschen als
bloßes Vernunftwesen zu sehen.
Die Göttlichkeit des Menschen be-
stand für ihn in seiner Humanität.
Man könne zu einer eigenen Religion gelangen,
wenn man sein Leben nach dem Guten ausrichte,
war sein Credo.
Der Göttlichkeit des Alls entspricht, laut Goethe,
ein inneres Universum, und da auch im Menschen
Göttliches wirkt, ist es sinnvoll, daß die Völker dem
Besten dieses Universums den Namen Gott verlei-
hen. Ein Pluralismus der Toleranz zeichnet sich ab,
wo jeder das verehren und göttlich nennen darf, was
ihm wertvoll erscheint. Gott aber ist an das ethische
Verhalten des Menschen gebunden, andernfalls
wäre Gott in der Natur allein und könnte als solcher
gar nicht begriffen werden.
Wie Leibniz nahm auch Goethe in der überall le-
bendigen Natur unzählige selbständige Einzelwesen
an, die kraft ihrer Entelechie, zusammengebunden
als Glieder einer universellen Harmonie, dem in
ihnen angelegten Lebensziel entgegenstreben; auch
im Mikrokosmos wirken die Gesetze, die im Ma-
krokosmos herrschen.
In seinen letzten Lebensjahrzehnten näherte er sich
den Ursprüngen des Christentums, des Judentums,
des Islam, des Parsismus und mit Einschränkungen
auch denen des Hinduismus. Erst die Summe der
Weltreligionen schufen für Goethe die moderne ak-
zeptable Metaphysik des Glaubens.
Gottes ist der Orient! / Gottes ist der Okzident! /
Nord- und südliches Gelände / Ruht im Frieden sei-
ner Hände.
Als Goethe 1814 mit seinem Gedichtzyklus West-
östlicher Divan dem Orient seine Reverenz erwies,
setzte er sich dem Verdacht aus, selbst ein ›Musel-
mann‹ zu sein. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hat
Goethe mit diesem Werk schon vor rund zweihun-
dert Jahren nichts Geringeres vorbereitet als den
Dialog mit dem Islam. Die Strategie, die er hierbei
verfolgte, beruhte auf gründlicher Beschäftigung
mit dem scheinbar Fremden. Bei Goethe endete sie
in Anerkennung, ja in der Überzeugung, daß der
Koran neben der Bibel das wichtigste religiöse Do-
kument der Menschheitsgeschichte sei. Goethe kam
126
dabei sogar zu dem Fazit: Das einzige und tiefste
Thema der Welt- und Menschengeschichte, dem alle
übrigen untergeordnet sind, bleibt der Konflikt des
Unglaubens und des Glaubens. Goethe hat sich
nicht nur im West-östlichen Divan mit außereuro-
päischen Religionen intensiv befaßt.
Als neue Vorbilder, sinnstiftende Figuren hat er –
neben christlichen Heiligen, neben Filippo Neri und
St. Rochus – manche mythologische und histori-
sche Gestalt und manche Sekte wieder entdeckt: Pe-
lagius, Mohammed, Faust, Ahasver, Prometheus,
Luzifer, Tantalus, Ixion und Sisyphos, Spinoza und
Machiavelli, die Arianer oder die Hypsistarier.
Denken, Wissen, Bildung, Humanität und Men-
schenwürde vereinigen sich bei ihm zum Glauben
an eine zwar nicht ungefährdete, aber stetige Hö-
herentwicklung der Menschheit, wobei die Wande-
rung des Menschen durch die Zeiten in der
Ehrfurcht vor dem kulminiert, was über uns, was
uns gleich und was unter uns ist, und im Staunen –
Zum Erstaunen bin ich da –, das zur Anerkennung
der Transzendenz herausfordert und nur mystisch
zu begreifen ist. Was Goethe bewegte, war heilige
Scheu und Ehrfurcht vor dem Ewigen, dem
Geheimnis, dem Unerforschlichen, das es ruhig zu
verehren gilt. Gegenüber dem, was Geheimnis
bleibt, hilft, laut Goethe, nur Respekt und Anerken-
nung. Erst so vermag eine Philosophie der Religion
das Unendliche mit dem Endlichen zu vereinen und
dem einzelnen eine metaphysische Bedeutung zu-
rückzugeben, die es immer schon in sich trägt.
Gnostisches und magisches Denken aus Goethes
Frühzeit kehrt nun in erweiterter Form zurück.
Doch hierüber in angemessener Form zu reden, das
bleibe, meint Goethe, allein der Kunst, der Dich-
tung und der Poesie vorbehalten. Gedanken an Un-
sterblichkeit und möglicher Wiedergeburt waren
dem Dichter offensichtlich nicht ganz fremd und
unlieb.
So soll Goethe bis an sein Lebensende die Anschau-
ung von der Wiederkunft aller geteilt haben. Aller-
dings hielt er es nicht für ratsam, diese Lehre zu
verkünden, weil er wohl fürchtete, dadurch den
Ernst der sittlichen Forderung abzuschwächen.
Goethe sei später dieser Gefahr dadurch entgangen,
meint Barner, daß er eine Reinkarnation der Seelen
zum Zweck der Vervollkommnung annimmt.
In Goethes Weltbild fallen alle Gegensätze zur Ein-
heit zusammen: Gott und die Welt, Geist und Natur,
Idee und Materie, Individuum und Gesellschaft.
Diese aus Glauben und Schauen entsprungene
Überzeugung, welche in allen Fällen, die wir für die
wichtigsten erkennen, anwendbar und stärkend ist,
liegt zugrunde meinem sittlichen sowohl als litera-
rischen Lebensbau, und ist als ein wohl angelegtes
und reichlich wucherndes Kapital anzusehn, ob wir
gleich in einzelnen Fällen zu fehlerhafter Anwen-
dung verleitet werden können, heißt es in Dichtung
und Wahrheit und in Faust: Wer immer strebend
sich bemüht, den können wir erlösen.
Vermächtnis
Kein Wesen kann zu nichts zerfallen,
Das Ew'ge regt sich fort in allen;
Am Sein erhalte dich beglückt!
Das Sein ist ewig, denn Gesetze
Bewahren die lebend'gen Schätze
Aus welchem sich das All geschmückt.
127
Als ich im Vorjahr Manfred Osten gegenüber
erwähne, wir planten ein Jahresthema mit dem
Titel Goethes Lebensthemen – und seine Suche,
nach dem, was die Welt im Innersten zusammen-
hält, schlägt er spontan vor, etwas über die natur-
wissenschaftlichen Implikationen im Faust II
auszuarbeiten; diese würden häufig von vielen
gar nicht so bemerkt, dennoch gehörten sie ja zu
den eminent wichtigen Lebensthemen Goethes.
Gleich zu Beginn stürzt sich der Referent auf
eines seiner Lieblingsthemen, die Beschleuni-
gungsturbulenzen, die jenseits aller tradierten
Parameter der Humanität den antiquierten Men-
schen hinter sich lassen, um aufzubrechen zu
einem neuen optimierten Menschentyp mit ver-
besserter Anpassungsfähigkeit an die immer ra-
santeren Anforderungen der Globalisierung.
In Gestalt sehr ernster Scherze, Goethes Defini-
tion der Ironie, wagt Goethe – so Osten – im
zweiten Teil der Faust-Tragödie bereits diesen
letzten Schritt einer Liquidierung des unzurei-
chenden Menschen als antiquiertes Fehler- und
Mängelwesen. Durch gentechnologischen Ein-
griff in den Genotyp des Menschen züchtet hier
der zum Molekularbiologen avancierte Famulus
Wagner mit Mephistos Hilfe einen neuen Phäno-
typ mit Namen Homunculus. Wagner gelingt
hierbei vor allem die Optimierung des menschli-
chen Gehirns. Denn sein Homunculus ist aus-
drücklich konzipiert als ein Hirn, das trefflich
denken soll.
Homunculus also als ein dem globalen Dorf be-
reits weit vorauseilendes Geschöpf postmoderner
Züchtungsutopien, die Goethes Imagination ab-
geleitet hatte aus wissenschaftlichen Forschungs-
ergebnissen seiner Zeit. Die Rede ist von der
1828 erstmalig gelungenen Umwandlung anorga-
nischer in organische Materie. Und zwar in Ge-
stalt der Wöhlerschen Harnstoffsynthese und der
hieraus für Goethe resultierenden Neukonzeption
der Homunculus-Szene im 2. Akt des zweiten
Teils der Faust-Tragödie.
Friedrich Wöhler hatte nämlich an der Berliner
Gewerbeschule mit Hilfe cyansauren Ammoni-
ums eine kristallisierte Substanz gewonnen, die
sich als identisch mit tierischem Harnstoff erwies.
Seinem Lehrer Johann Jakob Berzelius in Stock-
holm berichtete Wöhler als stolzer Famulus über
sein biochemisches Experiment mit dem Hin-
weis, daß er nunmehr Harnstoff machen kann,
ohne dazu Nieren (...) nötig zu haben. Eine Nach-
richt, deren lebenswissenschaftliche Tragweite
für Goethe offenbar eine ähnliche Bedeutung
hatte, wie für die Nachgeborenen heute die Nach-
richt von der Entschlüsselung des menschlichen
Genoms.
Heute wie damals verschränkte sich der Blick auf
das soeben aufgeschlagene neue Blatt im Buch
des Lebens mit vorauseilenden Blicken der Phan-
tasie auf eine plötzlich als möglich erscheinende
– wie auch immer geartete – künstliche Generie-
rung des Menschen. Das heißt, Goethe ahnte, daß
der Mensch möglicherweise einst in die Lage ver-
setzt sein könnte, die Gesetze der Evolution so
vollständig zu verändern, daß seine Art auf dem
Spiel stehen könnte.
Goethe ist im Falle des Homunculus allerdings
nicht stehen geblieben beim Resultat gentechni-
scher Intervention. Im weiteren Verlauf der
Faust-Tragödie gelingt Homunculus mit Hilfe
des Vorsokratikers Thales ein unerwartet kühner
Schritt: Er überwindet seine künstliche Existenz,
die den ungeduldigen Tendenzen seiner naturwis-
senschaftlichen Erzeuger geschuldet ist. Denn in
der Schlußszene des zweiten Aktes, in den Ägäi-
schen Meeresbuchten, entzieht sich Homunculus
bewußt jedem menschlichen Zugriff. Statt dessen
unterwirft er sich hier einem radikalen Entschleu-
nigungsprozeß durch Rückgriff auf die Evolution.
Dr. Manfred Osten (Bonn)
Ein Hirn, das trefflich denken soll...
Goethe und die Verheißungen der
Lebenswissenschaften im 21. Jahrhundert
128
Seine vom Proteus-Delphin ins Meer hinausge-
tragene Phiole zerschellt am Muschelthron der
Galatee und löst sich als Meeresleuchten im Was-
ser auf.
Und Homunculus folgt dem Rate des Thales: Da
regst du dich nach ewigen Normen, / Durch tau-
send, abertausend Formen, / Und bis zum Men-
schen hast du Zeit.
Den Allmachtsphantasien der Ungeduld verord-
net Goethe also ironisch ein evolutionshistori-
sches Moratorium von immerhin rund dreieinhalb
Milliarden Jahren: Homunculus muß phylogene-
tisch nachsitzen.
Der für Homunculus verordnete Entschleuni-
gungsprozeß läßt vermuten, daß Goethe selber
Ausschau gehalten hat nach Möglichkeiten einer
Entschleunigung als Therapie gegenüber den sich
ankündigenden globalen Mobilmachungstenden-
zen. Schon Goethe wußte: Die faustische Unge-
duld ist das größte Unheil der Moderne.
Weimar, 23. Oktober 1828: Eckermann ist zu Be-
such bei Goethe. Er versucht einen Blick in die
Zukunft: Die Entwicklung der Menschheit ist auf
Jahrtausende angelegt. Goethe unterbricht ihn
mit einer mürrischen Prognose: Ich sehe die Zeit
kommen, wo Gott keine Freude mehr an ihr [der
Menschheit] hat, und er abermals alles zusam-
menschlagen muß zu einer verjüngten Schöpfung.
Ich bin gewiß, es ist alles darauf angelegt, und es
steht in der fernen Zukunft schon Zeit und Stunde
fest, wann diese Verjüngungs-Epoche eintritt.
Ein Jahr später, im Dezember 1829, ist sie bereits
eingetreten, diese Verjüngungsepoche der
Menschheit. Allerdings zunächst nur virtuell, als
literarische Antizipation einer Zukunft des bereits
künstlich optimierten Menschen. Denn Goethe
liest Eckermann jetzt nach Tisch die Homuncu-
lus-Szene im zweiten Akt der Faust-Tragödie
(zweiter Teil) vor, um ihm dann wenige Tage spä-
ter die Erklärung für diese literarische Verjün-
gungsepoche der Menschheit nachzuliefern:
Homunculus sei ein Wesen, das durch eine voll-
kommene Menschwerdung noch nicht verdüstert
und beschränkt sei.
Da ist es also heraus. Dem jetzt zum Molekular-
biologen und Gentechniker des 21. Jahrhunderts
avancierten Faust-Schüler Wagner ist es im zwei-
ten Akt des zweiten Teils der Faust-Tragödie
gelungen, einen verbesserten Menschentyp zu
züchten. Er hat nämlich erreicht, was er wollte:
ein Hirn, das trefflich denken soll.
129
Die Optimierung also jener menschlichen
Ratio, von der es im ersten Teil der Tragödie
noch hieß: er nennt's Vernunft und
brauchts's allein/ Viel tierischer als jedes
Tier zu sein.
Auch die eigentliche Quelle dieses Defekts
der Ratio hat Goethe nicht verheimlicht. Es
ist die faustische Ungeduld. Denn Faust ist
der Protagonist des modernsten Fluchs aller
Flüche: Fluch vor allem der Geduld. Eine
Ungeduld, die denn auch prompt von Me-
phisto mit allen modernen Beschleuni-
gungsinstrumenten bedient wird: Mit dem
schnellen Mantel, dem schnellen Degen, der
schnellen Liebe, dem schnellen Geld.
Die Entfesselung dieser faustischen Unge-
duld in Richtung der Mobilmachungskultur
der Moderne hat Goethe als das größte Un-
heil unserer Zeit bezeichnet, die nichts reif
werden läßt. Und dieses größte Unheil un-
serer Zeit war für Goethe das Veloziferische.
Eine geniale Wortschöpfung, die eigentliche
Formel der Moderne, in der sich die Eile
(velocitas) verschränkt mit Lucifer, dem
Teufel.
Es ist diese Tendenz zur Eile, zur Überei-
lung, die Goethe denn auch als den eigentli-
chen Defekt der menschlichen Ratio
skizziert mit den Worten: Theorien sind ge-
wöhnlich Übereilungen des ungeduldigen
Verstandes, der die Phänomene gerne los
werden möchte.
Die Hirnforschung macht zwar für die Theo-
rieneigung der Ratio nicht ausdrücklich die
Ungeduld verantwortlich. Sie betrachtet den
Grund für die Vernachlässigung der Phäno-
mene durch die Ratio vielmehr neutral als
einen Prozeß der Selektion bei der Wahrneh-
mung der Wirklichkeit. Diesen Vorgang
beschreibt der Neurowissenschaftler Wolf
Singer wie folgt: Unsere Sinnesorgane wäh-
len aus dem breiten Spektrum der im Prinzip
bemerkbaren Signale aus der Umwelt nur ei-
nige ganz wenige aus, (...) und unsere Pri-
märwahrnehmung läßt uns glauben, dies sei
alles, was da ist. Wir (...) ergänzen die Lücken
durch Konstruktionen.
Eine Konstruktions- und Theorieneigung,
die begünstigt wird durch die neurowissen-
schaftliche Erkenntnis, daß die evolutions-
historisch jungen Hirnareale offenbar nicht
mehr direkt an die Sinnesorgane gekoppelt
sind. Die in ihren Funktionen stark dezentral
organisierten Hirnrindenareale greifen statt-
dessen auf Informationen zurück, die bereits
als gleichsam abstrakte Teilergebnisse in
einzelnen Arealen der Hirnrinde zur Verfü-
gung stehen.
Auch Nietzsche hatte bereits Zweifel an den
kognitiven Fähigkeiten des Menschen.
Seine Vermutung lautet: Die Gewohnheiten
unserer Sinne haben uns Lug und Trug der
Empfindung eingesponnen: Diese wieder
sind die Grundlagen aller unserer Urteile
und ›Erkenntnisse‹ – es gibt durchaus kein
Homunculus-Szene in der Faust-Inszenierung Peter Steins, 2000
130
Entrinnen, keine Schlupf- und Schleichwege in
die wirkliche Welt!
Weit gefehlt! Goethes Homunculus mit seinem
optimierten Gehirn, das trefflich denken kann, hat
sie längst gefunden, diese Schlupf- und Schleich-
wege in die wirkliche Welt. Er ist bereits klüger
als sein naturwissenschaftlicher Produzent Wag-
ner und klüger auch als Mephisto, der dem unge-
duldigen Wagner auf veloziferische Weise bei der
Generierung des Homunculus assistiert hat. Denn
Homunculus ist es, der bereits (à la Freud) bis in
die Traumareale des (bewußtlos auf der Couch)
liegenden Faust vordringt.
Immerhin hatte sich Goethe bereits mit den frü-
hen Ansätzen der Hirnforschung intensiv be-
schäftigt. Die von Gall entwickelte Phrenologie
und Sömmerings Gehirnanatomie waren ihm ver-
traut. Warum also nicht bei nächster sich bieten-
der Gelegenheit den Versuch wagen, endlich die
zu Übereilungen in Gestalt von Irrtum (als über-
eiltes Denken) und Gewalt (als übereiltes Han-
deln) neigende Ratio evolutionstechnologisch zu
optimieren? Etwa im Sinne der Hoffnungen der
sogenannten evolutionären Biotechnologie?
Denn die Optimierung der Basismoleküle des Le-
bens ist inzwischen keine Science-fiction mehr,
sondern Realität. Goethe hat denn auch nicht ge-
zögert, auf seine Weise die Optimierung des Ge-
hirns zu inszenieren. Ihm bot sich unerwartet
hierzu die Gelegenheit in Gestalt wissenschaftli-
cher Forschungsergebnisse seiner Zeit.
Manfred Osten
Mephistopheles Was gibt es denn? –
Wagner Es wird ein Mensch gemacht.
Mephistopheles Ein Mensch? Und welch verliebtes Paar-
Habt ihr ins Rauchloch eingeschlossen?
Wagner Behüte Gott! wie sonst das Zeugen Mode war, Er-
klären wir für eitel Possen.
Der zarte Punkt, aus dem das Leben sprang,
Die holde Kraft, die aus dem Innern drang
Und nahm und gab, bestimmt sich selbst zu zeichnen,
Erst Nächstes, dann sich Fremdes anzueignen,
Die ist von ihrer Würde nun entsetzt;
Wenn sich das Tier noch weiter dran ergetzt,
So muß der Mensch mit seinen großen Gaben
Doch künftig höhern, höhern Ursprung haben.
Es leuchtet! seht! – Nun läßt sich wirklich hoffen,
Daß, wenn wir aus viel hundert Stoffen
Durch Mischung – denn auf Mischung kommt es an –
Den Menschenstoff gemächlich komponieren,
In einen Kolben verlutieren
Und ihn gehörig kohobieren,
So ist das Werk im stillen abgetan.
Es wird! die Masse regt sich klarer!
Die Überzeugung wahrer, wahrer:
Was man an der Natur Geheimnisvolles pries,
Das wagen wir verständig zu probieren,
Und was sie sonst organisieren ließ,
Das lassen wir kristallisieren.
Mephistopheles Wer lange lebt, hat viel erfahren,
Nichts Neues kann für ihn auf dieser Welt geschehn.
Ich habe schon in meinen Wanderjahren
Kristallisiertes Menschenvolk gesehn.
Wagner Es steigt, es blitzt, es häuft sich an,
Im Augenblick ist es getan.
Ein großer Vorsatz scheint im Anfang toll;
Doch wollen wir des Zufalls künftig lachen,
Und so ein Hirn, das trefflich denken soll,
Wird künftig auch ein Denker machen.
131
Einer Einzígen angehören,
Einen einzigen verehren,
wie vereint es Herz und Sinn,
Lida, Glück der nächsten Nähe,
William, Stern der schönsten Höhe,
euch verdank ich was ich bin,
Tag und Jahre sind verschwunden,
und doch ruht auf jenen Stunden,
meines Wertes Vollgewinn.
Gegen Ende seines Lebens beschäftigt Goethe immer
stärker das Problem von Originalität und Überliefe-
rung bezüglich der Entwicklung menschlicher Cha-
raktere: Wie bin ich geworden was ich bin? Was hat
mich geformt? Welche Menschen waren in meinem
Lebens- und Wirkungskreis wichtig?
Was ist original von mir, was habe ich durch eigene
Kraft zur Entwicklung meiner Persönlichkeit bei-
getragen? Mit Goethes Worten: Was ist an dem gan-
zen Wicht original zu nennen?
In dem kleinen Gedicht statuiert Goethe gewisser-
maßen das Problem an sich selbst. Es ist genau ge-
nommen die Frage nach Erblichkeit und Umwelt,
nach ihrer Wirkung, nach Prioritäten und ihrer
Wechselwirkung aufeinander. Diese Frage ist bis
heute nicht endgültig beantwortet. Sind die Gene als
Bausteine für die Entwicklung und Strukturen indi-
vidueller menschlicher Entwicklung von vorherr-
schender Bedeutung? Sind diese Anlagen im Men-
schen ererbt von vorangegangenen Generationen,
von deren Tun und Lassen, ererbte Begabungen, Ta-
lente etc., die sich in uns manifestiert haben?
Bei der Formulierung des Themas haben wir zu-
nächst geschwankt zwischen den Begriffen Vorbild
und Lehrmeister, beinhaltet doch letzterer deutlich
mehr als Vorbild.
Der Lehrmeister hat seinem Schüler
etwas voraus, das er ihm nahebringt
oder das jener von ihm lernen will.
Das kann eine handwerkliche
Fertigkeit sein oder Einsichten in
komplizierte philosophische Zu-
sammenhänge, aber auch künstleri-
sche oder religiöse Überzeugungen.
Auf jeden Fall aber hat das, was der
Lehrmeister vermittelt, eine anhal-
tende Wirkung auf die Zielperson,
die sie prägt, weiterbringt, zu eige-
nem Tun veranlaßt und befähigt,
das Ganze auf einem möglichst
hohen Niveau.
Ein Freund setzt dagegen mehr vo-
raus: Etwa eine weitgehende Über-
einstimmung in der Beurteilung
grundsätzlicher Lebensfragen, eine
starke persönliche Beziehung, gegenseitiges Einste-
hen füreinander und vor allem Zuverlässigkeit in
allen die Freunde betreffenden Angelegenheiten.
Über den Begriff der Freundschaft hat sich Goethe
bemerkenswert häufig geäußert.
In den Maximen und Reflexionen heißt es: Freund-
schaft kann sich bloß praktisch entwickeln, prak-
tisch Dauer gewinnen. Die wahre, die tätige, die
produktive Freundschaft besteht darin, daß die
Freunde gleichen Schritt im Leben halten, daß sie
ihre Zwecke billigen und daß sie unverrückt zusam-
men fortgehen, wie auch sonst die Differenzen ihrer
Denk- und Lebensweise sein mögen.
Unter Weggefährten wollen wir Ver-
bindungen zwischen Menschen be-
schreiben, die eine kürzere oder
längere Wegstrecke des Lebens mit-
einander zurücklegen. Diese Verbin-
dung kann für die tägliche Arbeit
oder die alltäglichen Lebensabläufe
durchaus sehr bedeutsam sein.
Freundschaftliche Gefühle oder
Lehrer-Schüler-Verhältnisse jedoch
fehlen.
Hier soll nun der Versuch unternom-
men werden, die Einflüsse von
Goethes Umwelt, die seiner Lehr-
meister, Weggefährten und Freunde
auf seine persönliche Entwicklung
in den Mittelpunkt zu stellen. Dabei
stehen naturgemäß Menschen im
Fokus unserer Aufmerksamkeit,
denen Goethe persönlich begegnete und die deutli-
chen Einfluß auf sein Denken und Tun nehmen
konnten.
Hans-Hellmut Allers
2009
Goethes Freunde, Weggefährten
und Lehrmeister
Hans-Hellmut Allers (Berlin)
...euch verdank ich, was ich bin...
Einführungsvortrag
132
Der ewig suchende Autor häuft im Laufe seines
Lebens ein enzyklopädisches Wissen an, das sich
über alle Lebensbereiche künstlerischer Gestaltung
und naturwissenschaftlicher Forschung erstreckt.
Deshalb ist Goethe auch um den Kontakt zu allen
bedeutenden Menschen seiner Zeit bemüht. Manche
davon werden jahrelange Weggefährten, einige
seine Lehrmeister und wenige davon seine engsten
Freunde. Wie haben sie ihn und sein Schaffen
beeinflußt?
Mit Goethe begegnen wir den Lehrern Johann
Christoph Gottsched, Christian
Fürchtegott Gellert und Adam
Friedrich Oeser, dem frühen
Mentor Johann Gottfried
Herder, den Jugendfreunden
Johann Heinrich Merck und
Friedrich Heinrich Jacobi,
dem herzoglichen Freund und
Mäzen Carl August von Sach-
sen-Weimar, den
schriftstelleri-
schen Weg-
gefährten Christoph Martin
Wieland und Friedrich Schiller,
den Forschern Alexander und
Wilhelm von Humboldt, den
Naturwissenschaftlern Justus
Christian Loder, Johann Wolf-
gang Döbereiner und Samuel
Thomas von Soemmering u.a.,
schließlich dem intimen Dialog-
partner der letzten Lebens-
jahrzehnte, Carl Friedrich Zel-
ter.
Das Jahr 2009 fällt formal ein
wenig heraus aus der sonsti-
gen Berichterstattung, da wir
uns erstmalig entschlossen,
aus den Vorträgen über Goethes
Lehrer, Weggefährten und
Freunde ein über 200 Seiten
umfassendes Buch herzustellen,
das leider nach kurzer Zeit bereits vergriffen war.
Sobald uns wieder genügend Mittel für einen Druck
in begrenzter Auflage zur Verfügung stehen oder wir
einen geneigten Sponsor finden, wird es eine Neu-
auflage geben.
Einige der Vorträge sollen aber auf den nächsten
Seiten – allerdings in sehr komprimierter Form –
wiedergegeben werden, da sie doch so manches Un-
bekannte über Goethe enthalten.
Aus Platzgründen mußten wir uns im Folgenden auf
diejenigen unter seinen Zeitgenossen beschränken,
die ihn entweder als Lehrmeister früh beeinflußt
haben oder auf solche Weggefährten und Freunde,
mit denen er über Jahrzehnte verbunden war.
Auf sein Verhältnis zu Carl August und Carl Fried-
rich Zelter gehen wir an anderer Stelle ausführ-
licher ein.
Dr. Ulrike Leuschner (Darmstadt)
...dieser eigene Mann, der auf mein Leben
den größten Einfluss gehabt...
Die schwierige Freundschaft zwischen
Goethe und Merck
Dr. Manfred Osten (Bonn)
...wir liebten uns, ohn uns zu verstehn...
Zur Modernität des
Goethe-Jacobi-Verhältnisses
Dr. Volker Ebersbach (Leipzig)
...lasst mich nur auf meinem Sattel gelten...
Goethes Freundschaft mit Carl-August
und mit Carl Friedrich Zelter
133
Johann Heinrich
Merck
Friedrich Heinrich
Jacobi
Carl Friedrich
Zelter
Alles, was uns begegnet, läßt Spuren zurück...
Alles trägt unmerklich zu unserer Bildung bei.
Wilhelms Meisters Lehrjahre
Wer nicht geschunden wird, wird nicht erzogen –
diesen Ausspruch des griechischen Komödiendich-
ters Meander stellt Goethe – nicht von ungefähr – als
Motto vor den 1. Teil seiner Autobiografie Dichtung
und Wahrheit – wobei man das geschunden nach
heutigem Sprachverständnis vielleicht eher überset-
zen könnte in ein etwas moderneres: wer nicht bis an
seine Leistungsgrenzen herausgefordert wird, der
wird eine wichtige Lebenslektion nicht lernen.
Heranreifungs- und Bildungsprozesse gehören für
Goethe zu den großen Themen, die ihn sein Leben
lang beschäftigt haben. Nicht zuletzt verdanken wir
ihm den ersten deutschen Bildungsroman der dama-
ligen Zeit, Wilhelm Meisters Lehrjahre, dessen
Thema die Entwicklung, das Erwachsenwerden eines
jungen Menschen ist.
Schon früh kommt er in Kontakt mit Li-
teratur. Das beginnt mit den Gute-
nachtgeschichten der Mutter und mit
der Bibellektüre in der lutherisch-
frommen Familie. Gelesen wird viel
im Hause Goethe, denn der Vater be-
sitzt eine Bibliothek von rund 2000
Bänden. In Ermangelung von Bilderbü-
chern oder Fibeln, wie es sie heute gibt, be-
trachtet man gemeinsam mit dem Nachwuchs die
illustrierten Werke für die Großen.
In Dichtung und Wahrheit heißt es dazu: Man hatte
zu der Zeit noch keine Bibliotheken für Kinder ver-
anstaltet. Die Alten selbst hatten noch kindliche Ge-
sinnungen und fanden es bequem, ihre eigene Bil-
dung der Nachkommenschaft mitzuteilen. Außer dem
»Orbus pictus« des Amos Comenius kam uns kein
Buch dieser Art in die Hände, aber die große Folio-
bibel, mit Kupfern von Merian ward häufig von uns
durchblättert.
Als alleiniger Erbe eines ansehnlichen Vermögens ist
der Vater nicht darauf angewiesen, seinen Lebensun-
terhalt zu verdienen, hat sich daher nahezu von allen
öffentlichen Geschäften zurückgezogen, befriedigt
durch den erworbenen Titel und Rang eines kaiserli-
chen Rats.
1754 stirbt die Großmutter und der Vater führt einen
langgehegten Plan aus: das alte verwinkelte Haus am
Hirschgraben auszubauen und in ein geräumiges ba-
rockes Bürgerhaus zu verwandeln. Während der Um-
bauphase kann Johann Kaspar vorerst seine Absicht,
den Sohn selbst zu unterrichten, zu seinem Leidwe-
sen nicht ausführen. Gegen öffentliche Schulen hegt
er ein tief verwurzeltes Mißtrauen, doch er be-
schließt, ihn wenigstens vorübergehend für einige
Wochen auf eine sogenannte öffentliche Elementar-
schule zu schicken.
Wie wir aus Dichtung und Wahrheit wissen, hat sich
Goethe in dieser Schule ziemlich gelangweilt, denn
auch hier unterrichtet man nach dem bereits erwähn-
ten ABC-Buch, das er längst rückwärts beten kann.
In nur drei Monaten lernt er nun Rechnen und Schön-
schreiben; bereits mit sieben Jahren besitzt er eine
feste ausgeprägte Handschrift. Ansonsten wissen wir
über diesen Schulaufenthalt nur, daß Goethe sich mit
seinen Mitschülern diverse Male heftig geprügelt hat.
Sobald der Umbau des Hauses abgeschlossen ist,
nimmt ihn der Vater aus der Schellbauer'schen An-
stalt. Fortführen wird er die Schreibübungen unter
dessen gestrenger Aufsicht daheim. Labores juveniles
(Jugendarbeiten) nennt Goethe später sein Übungs-
heft, in dem uns handschriftliche Schularbeiten aus
dem achten bis dreizehnten Lebensjahr erhalten sind.
Gemeinsam mit der Schwester wird er nun vom Vater
sowie von insgesamt acht Hauslehrern unterrichtet.
Seit 1756 lehrt Johann Heinrich Thym den Knaben
zunächst weiter Schönschreiben und Rechnen, später
auch Erdkunde und Geschichte. Außerdem erhält
Wolfgang vier Jahre lang Unterricht in Latein und
Griechisch durch den Rektor Jacob Gottlieb Scher-
bius im Gymnasium in den Räumen des Barfüßer-
klosters.
Ferner erlernt er Französisch, Italienisch, Englisch
und Hebräisch. Die lebendigen Sprachen werden von
muttersprachlichen Lehrern vermittelt. Auf dem
Stundenplan stehen außerdem neben den naturwis-
senschaftlichen Fächern, Religion und Zeichnen.
Überdies lernt er Klavier- und Cellospielen, Reiten,
Fechten und Tanzen.
Beate Schubert (Berlin)
...glaubte ich, ungefähr so viel zu wissen
wie der Lehrer selbst...
Goethes Lehrmeister in Frankfurt und Leipzig
134
Das Jahr 1758 bringt eine Krankheit, die für fast alle
Gleichaltrigen ein Todesurteil darstellt: die Pocken.
Doch er übersteht sie und beginnt im gleichen Jahr
den Unterricht in französischer Sprache bei Made-
moiselle Gachet. Bald ist das aber gar nicht mehr not-
wendig, denn im Zuge des Siebenjährigen Krieges
wird Frankfurt durch die Franzosen besetzt.
In Goethes Elternhaus wird bekanntlich der franzö-
sische Graf Thoranc einquartiert. Nunmehr gibt man
französisches Theater in Frankfurt und Goethe erhält
durch seinen Großvater ein Freibillet. So oft es geht,
besucht er die Vorstellungen, wo er auch erste Erfah-
rungen mit der französischen Dramenliteratur macht;
nicht selten schleicht er sich in die Loge, um den
Proben beizuwohnen.
Hier nun sieht der Zehnjährige die Tragödien von
Molière bis Racine und erfasst auch ohne fortge-
schrittene Sprachkenntnis ihren Sinngehalt. Für die
Entwicklung des späteren Dichters ist es von großer
Bedeutung, daß er mit den Regeln der klassischen
französischen Bühnenkunst bereits vertraut wird,
bevor er wenige Jahre später mit Shakespeare einen
zukunftsweisenden Gegenentwurf hierzu kennen-
lernt.
Bezeichnend ist, daß Goethe die bisher genannten
Sprachen nicht so sehr über die Grammatik lernt,
sondern über die Literatur, das Sprechen und Sprach-
gefüge. Nach den Bekundungen zahlreicher Zeitge-
nossen kann er sich Zeit seines Lebens in all diesen
Sprachen nicht nur hervorragend und fließend ver-
ständigen, sondern er leistet auch als Übersetzer Her-
vorragendes: Von Lord Byrons Manfred über
Rameaus Neffe von Diderot bis Benvenuto Cellini
sind aus seiner Feder der deutschen Sprache beinahe
unüberholbare Übertragungen zugute gekommen.
1765 beschließt der Vater, seinen nunmehr 16-jähri-
gen Sohn zum Jurastudium nach Leipzig zu schicken.
Eigentlich möchte Wolfgang viel lieber in Göttingen
die sogenannten schönen Wissenschaften, das heißt
Rhetorik und Poetik sowie klassische Altertumswis-
senschaft studieren. Doch der Vater läßt sich auf kei-
nerlei Diskussionen ein.
Schließlich hat er 35 Jahre
zuvor ebenfalls in Leipzig
Jura studiert. Er stattet ihn
aus mit einem Empfeh-
lungsbrief, adressiert an
den Hofrat Böhme, der als
Professor der Geschichte
und des Staatsrechts einen
guten Ruf genießt.
Dieser stellt daraufhin den
Vorlesungsplan des angehenden Juristen zusammen:
Philosophie, Rechtsgeschichte, Institutionen. Mit ei-
nigem Widerstreben gibt er soweit den schönwissen-
schaftlichen Gelüsten Goethes nach, indem er auch
Gellerts Literaturgeschichte und dessen praktische
Übungen im deutschen Stil besuchen darf.
Der junge Goethe wechselt nicht nur seine Umge-
bung, er wechselt auch die Epoche. Hier blüht bereits
das Rokoko, man flirtet und flaniert, es ist die Zeit
der Roncaillen und Schäfergedichte. Wolfgang, von
der Mutter mit soliden Tuchanzügen ausgestattet,
versetzt seine gesamte Garderobe und verwandelt
sich zum Stutzer mit Degen und Jabot.
Quasi über Nacht adaptiert er den an der französi-
schen Adelskultur orientierten galanten Lebensstil
von Klein Paris, um von seinen Kommilitonen und
vor allem der eleganten Leipziger Damenwelt ernst-
genommen zu werden. Es fällt ihm – wie er in Dich-
tung und Wahrheit bekennt – nicht leicht, sich auf die
Umgangsformen der großen Welt umzustellen, sein
in der Leipziger Umgebung komisch wirkendes
Frankfurter Deutsch abzulegen und in Kleidung und
Manieren à la mode zu sein.
Die Kollegien der Rechts-
wissenschaften langweilen
ihn schon nach wenigen
Besuchen. Unter der Lei-
tung des Vaters hatte Goe-
the den Inhalt der
juristischen Anfangsvorle-
sungen bereits zum großen
Teil antizipiert; eine natür-
liche Folge sind daher als-
bald Überdruß und
Langeweile, die ihn recht schnell vor dem ganzen,
von vornherein nicht geliebten Studium zurückschre-
cken lassen.
Im zweiten Teil von Dichtung und Wahrheit heißt es
hierzu: Meine Kollegia besuchte ich anfangs emsig
und treulich; die Philosophie wollte mich jedoch kei-
neswegs aufklären. In der Logik kam es mir wunder-
lich vor, daß ich diejenigen Geistesoperationen, die
ich von Jugend auf mit der größten Bequemlichkeit
verrichtete, so auseinanderzerren, vereinzelen und
gleichsam zerstören sollte, um den rechten Gebrauch
derselben einzusehen. Von dem Dinge, von der Welt,
von Gott glaubte ich ungefähr so viel zu wissen als
der Lehrer selbst, und es schien mir an mehr als einer
135
Stelle gewaltig zu hapern. (...) Mit den juristischen
Kollegien ward es bald ebenso schlimm: denn ich
wußte gerade schon soviel, als uns der Lehrer zu
überliefern für gut fand. Mein erster hartnäckiger
Fleiß im Nachschreiben wurde nach und nach ge-
lähmt, indem ich es höchst langweilig fand, dasjenige
nochmals aufzuzeichnen, was ich bei meinem Vater,
teils fragend, teils antwortend, oft genug wiederholt
hatte, um es für immer im Gedächtnis zu behalten.
Mehr verspricht er sich zunächst von den
Vorlesungen des Philosophen und Lite-
raturwissenschaftlers Johann Chris-
toph Gottsched. In dessen ein
Jahrzehnt zuvor erschienenem litera-
turtheoretischen Hauptwerk, der Cri-
tischen Dichtkunst propagiert
Gottsched eine rationalistische Dich-
tungsauffassung; gemäß dieser hat die
Poesie Regeln zu folgen, die sich mit den
Mitteln der Vernunft begründen lassen.
Als nun Goethe nach Leipzig kommt, ist des Profes-
sors Ruhm allerdings bereits verblasst, und der junge
Student von ihm enttäuscht. Mit sehr viel mehr Inte-
resse besucht Goethe daraufhin die Poetik-Vorlesun-
gen von Christian Fürchtegott Gellert, dem
empfindsamen Widerpart des rationalistisch verknö-
cherten Gottsched. Gellert ist einer der damals be-
kanntesten und meist gelesensten deutschen Dichter
und gilt als Vertreter und Philosoph der Aufklärung.
1752 hatte man ihn in Leipzig auf einen Lehrstuhl
für Poesie berufen; Poesie als Lehrfach – so etwas
gab es vorher gar nicht. Als Dichter war er damals
insbesondere bekannt durch seine Fabeln und Erzäh-
lungen und verschiedene Schäferstücke, wie sie da-
mals beliebt waren,
Goethe schreibt jedenfalls im 6. Buch von Dichtung
und Wahrheit: Die Verehrung und Liebe, welche Gel-
lert vor allem von allen jungen Leuten genoß, war
außerordentlich. (...) Nicht groß von Gestalt, zierlich,
aber nicht hager, sanfte, eher traurige Augen, eine
sehr schöne Stirn, eine nicht übertriebene Habichts-
nase, ein feiner Mund, ein gefälliges Oval des Ge-
sichts: alles machte seine Gegenwart
angenehm und wünschenswert.
Von Gellerts Vorlesungen erhofft
er sich Aufklärung über den Zau-
ber der Poesie, sucht er doch das
Geheimnis zu ergründen, wo-
durch die Kunstfertigkeit der
Rede ein Gefäß des Schönsten
wird, was der menschliche Geist
erzeugt. Doch auch Gellert beginnt
sich langsam zu überleben.
In seinem poetischen Praktikum läßt Gellert gar an
Goethes eigenen poetischen Versuchen kaum ein
gutes Haar; insbesondere seine Prosa findet vor Gel-
lerts Augen wenig Gnade; er, der dem 17-jährigen zu
dieser Zeit ja noch als absolute Autorität im Bereich
der Dichtkunst gilt, sieht Goethes dichterische Ent-
würfe genau durch, versieht fast jede Zeile mit recht
philisterhaften Randbemerkungen und korrigiert mit
roter Tinte. Leider sind diese Blätter im Laufe der
Jahre aus Goethes Papieren verschwunden.
Über das traurige Schicksal seiner anderen frühen
Manuskripte berichtet Goethe: Nach manchem
Kampfe warf ich eine so große Verachtung auf meine
begonnenen und geendigten Arbeiten, daß ich eines
Tags Poesie und Prosa, Pläne, Skizzen und Entwürfe
sämtlich zugleich auf dem Küchenherd verbrannte,
und durch den das ganze Haus erfüllenden Rauch-
qualm unsre gute alte Wirtin in nicht geringe Furcht
und Angst versetzte. Dies ist sein erstes Autodafé ei-
gener Werk- und Briefentwürfe, dem im Laufe seines
Lebens noch weitere folgen werden.
Höheren Erkenntnisgewinn über die Regeln der Poe-
tik und das Geheimnis der Sprache verspricht er sich
ferner von den Vorlesungen des Philologen Johann
August Ernesti, betitelt: Aufschlüsse über die
Grundsätze der schönen Rede. Dieser eher tro-
ckene Professor für alte Literatur, dessen Rhetorik
jedoch allenthalben gerühmt wird, vermag zwar
den übersprudelnden Geist Lessings durch den
Ernst seines wissenschaftlichen Verfahrens elo-
quent darzustellen, doch er sieht seine Aufgabe vor
allem darin, seinen Studenten beizubringen, wie
man Texte analysiert und Lyrik auf ihre Aussage hin
zergliedert – ästhetische Erörterungen sind seine
Sache weniger.
Dies systematische Befassen mit der Lehre vom Ver-
stehen, Deuten und Auslegen von Kunstwerken, be-
sonders von literarischen Texten, aber auch der
mündlichen Rede wird Goethes späteres Schaffen
entscheidend prägen.
Bekanntlich besitzt er ein angeborenen Talent, um-
gehend alles, was ihm an Neuem, Unbekanntem be-
gegnet, intuitiv zu erfassen und sogleich in
anschauliche Bilder und Begriffe umsetzen zu kön-
nen. Durch das, was er in Ernestis Vorlesungen lernt,
136
Johann Christoph
Gottsched
Christian Fürchtegott
Gellert
wird ihm nun das analytische Rüstzeug mitgegeben,
seine Gedanken zu allem und jedem so verständlich
und konzise zu formulieren, daß sie ein jeder verste-
hen kann; sich zu beschränken auf das Wesentliche,
eine Kunst, die nur wenige beherrschen.
Dies wird ihm später zugutekommen als Berater
eines herzoglichen Regenten, als Minister und Leiter
öffentlicher Institutionen wie dem Weimarer Theater
oder den universitären Einrichtungen in Jena. Jahre
seines Lebens wird er, neben dem Dichten, notabene
damit verbringen, Sachverhalte aller Art zu beurtei-
len, Schriftsätze zu korrigieren und wissenschaftliche
Thesen zu formulieren oder (man denke an Newton),
sie zu widerlegen. Als Dichter besitzt er ohnehin ein
ihm ebenfalls offenbar angeborenes traumwandle-
risch sicheres Gespür für Aufbau, Dramaturgie, für
angemessenes Versmaß und den Einsatz von Pointen
und Spannung.
Ostern 1766 lernt er nun beim Mittagessen den jun-
gen Pädagogen Behrisch kennen, der als Hofmeister
im gräflichen Lindenau'schen Hof tätig ist. Bald ent-
wickelt sich eine sehr enge Freundschaftsbeziehung
zu dem elf Jahre Älteren und Behrisch wird sein
konstruktiver Kritiker und Ur-Freund, bei dem er
immer wieder Rat sucht in Liebesdingen, denn auch
die wollen bekanntlich gelernt sein. Beim Mittags-
tisch im Weinhaus Schönkopf verliebt sich Goethe in
die Tochter des Hauses, Anna Katharina, doch davon
soll jetzt hier nicht die Rede sein.
Mehr und mehr drängt es Goethe ab dem Sommer
1767 aus dem Hörsaal heraus. Eine der wichtigsten
Leipziger Begegnungen ist diejenige mit Adam
Friedrich Oeser, dem Maler und Leiter der Malerey-
und Architectur-Academie, bei dem er nicht nur sei-
nen Frankfurter Zeichenunterricht fortsetzt.
Das 8. Buch von Dichtung und Wahrheit beginnt:
Ein anderer Mann, obgleich in jedem Betracht von
Behrisch unendlich verschieden, konnte doch in
einem gewissen Sinn mit ihm verglichen werden: Ich
meine Oeser, welcher auch unter diejenigen Men-
schen gehörte, die ihr Leben in einer bequemen Ge-
schäftigkeit hinträumen. Seine Freunde selbst
bekannten im stillen, daß er, bei einem sehr schönen
Naturell, seine jungen Jahre nicht in genügsamer
Tätigkeit verwendet, deswegen er auch nie dahin
gelangt sei, die Kunst mit vollkommener Technik
auszuüben. Doch (...) es fehlte ihm die vielen Jahre,
die ich ihn kannte, niemals an Erfindung noch Ar-
beitsamkeit«. Nach Goethes Worten ist Oeser ein
Feind des Schnörkel- und Muschelwesens und des
ganzen barocken Geschmacks.
Dafür macht er ihn mit den Schriften seines Schü-
lers und Freundes Johann Joachim Winckelmann
bekannt. Oeser ist also, wenn schon nicht als Urhe-
ber, so doch als Impulsgeber des klassizistischen
Gedankens in Deutschland anzusehen, der die edle
Einfalt, stille Größe als das in der klassischen An-
tike sich manifestierende Ideal der Kunst als erster
erkannt hat und in eigener Reflexion weiterentwi-
ckelt.
Hier kommt Goethe zum ersten Mal mit einer an
der Antike orientierten klassizistischen Kunsttheorie
in Berührung, die seine Vorstellungen von Ästhetik
entscheidend prägen wird .Was allerdings die eige-
nen praktischen Erfahrungen im Zeichnen, Kupfer-
stechen und Radieren angeht, so verhehlt sich
Goethe nicht, daß seine Fortschritte auf diesem Ge-
biet recht bescheiden sind.
Die beiden Jahre 1766 bis 1768, in
denen Goethe Oesers Zeichen-
schüler ist, werden seine ge-
samte Kunstanschauung bis zu
den Eindrücken des direkten
Erlebens antiker Kunst auf der
Italienischen Reise 1786 bis
1788 prägen.. Bis zu Oesers
Tod, der 1799 infolge eines
Schlaganfalls eintrat, hält Goethe
seinem Lehrer sowohl mensch-
lich als auch in Ansehen seiner
Verdienste als Impulsgeber, die Treue.
Die Leipziger Jahre Goethes enden bekanntlich mit
einer schweren psychischen und gesundheitlichen
Krise. Die Liebe zu Käthchen ist in die Brüche ge-
gangen, sie verlobt sich mit einem gewissen Dr.
Kanne.
Die Trennung von ihr und der fast zeitgleiche Fort-
gang des Freundes Behrisch setzen ihm ungemein zu.
Goethes damals recht ausschweifender Lebensstil be-
wirkt schließlich, daß er 1768 am Ende seiner Kräfte
ist. Sein labiler Gesundheitszustand verschlechtert
sich im Frühjahr zusehends; im Juli erleidet er einen
Blutsturz und eine Lungenaffektion.
Ende August 1768, an seinem neunzehnten Geburts-
tag verlässt der durch die Pflege der Leipziger
Freunde gesundheitlich halbwegs wiederhergestellte
Goethe Leipzig ohne Studienabschluss und kehrt
nach Frankfurt zurück.
137
Friedrich Oeser
Der von Michael Zaremba gewählte Titel wirft
gleich die erste Frage auf: Herder ist nur fünf Jahre
älter als Goethe; wie ist es möglich, daß er dennoch
zum väterlichen Freund und Berater Goethes wer-
den konnte?
Bekanntlich verdankt Goethe Herder zahlreiche ent-
scheidende Impulse für die Entwicklung seiner ei-
genen Dichtung und seines ästhetischen Urteils. So
weist Herder den Studenten auf seine Lieblingsau-
toren Shakespeare, Hamann und Swift hin. Aber
auch der altnordischen und altkeltischen Dichtung
im Stile Ossians sowie der Volkspoesie gilt seine
Aufmerksamkeit. Goethes Neigung zum Sammeln
wird angeregt.
Ein Jahr nach ihrer ersten Begegnung erhält Herder,
der einmal von den Stimmen der Völker gesprochen
hat, von Goethe ein Dutzend tradierter Balladen aus
dem Elsaß, welche sogleich in seine Sammlung von
Volksliedern aufgenommen werden.
In einem Brief vom 21. März 1772 erinnert sich
Herder spöttisch-liebevoll an den Studenten: Goe-
the ist wirklich ein guter Mensch, nur äußerst leicht
und spatzenmäßig, worüber er meine ewigen Vor-
würfe gehabt hat. Er war der einzige, der mich in
Straßburg in meiner Gefangenschaft besuchte [im
abgedunkelten Krankenzimmer nach einer schmerz-
haften Augenoperation] und den ich gern sah, auch
glaube ich ihm, ohne Lobrednerei, einige gute Ein-
drücke gegeben zu haben, die einmal wirksam wer-
den können. Jetzt aber bin ich seit langer Zeit außer
Briefwechsel mit ihm, ob ich ihm gleich auf eine mir
zugeschickte wirklich schöne Produktion seit lan-
gem zu antworten habe.
Mit der »schönen Produktion« ist das Schauspiel
Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der
eisernen Hand gemeint, von dessen Urfassung Goe-
the in seiner Autobiographie sagt, Herder habe sie
unfreundlich und hart behandelt. Tatsächlich kriti-
siert der ostpreußische Freund die erste Fassung als
ein schieres Kaleidoskop von Szenen. Goethe strafft
und vereinfacht daraufhin das Bühnenstück; doch
der nicht nachlassende beißende Spott Herders führt
dazu, daß Goethe ihm gegenüber sein gerade in der
ersten Entstehungsphase befindliches Lieblingspro-
jekt Faust verschweigt.
Zwar kann Herders abweisendes Wesen
mit der schmerzhaften Augenbehandlung
entschuldigt werden, aber er bleibt auch
später der verletzende Kritikaster, als
den Goethe ihn in Straßburg kennen-
gelernt hat.
Im Juli 1775 treffen sie erneut in
Darmstadt zusammen, wo Herder in
einem Brief an seine Frau Karoline
scheibt: Der ist überhaupt mit seinen
Schriften nur Komödiant, in seinem Leben wil-
der Mensch und guter Junge. An Zimmermann
schreibt er: Goethe schwimmt auf den goldenen
Wellen des Jahrhunderts zur Ewigkeit. Welch ein
paradiesisch Stück, seine ›Stella‹! Das Beste was er
schrieb.
Ein halbes Jahr später ist Goethe in Weimar einge-
troffen und wird innerhalb kürzester Zeit zum Inti-
mus des Herzogs. Dem seit einigen Jahren als
Prinzenerzieher in Weimar lebenden Christoph
Martin Wieland schildert Goethe den von ihm be-
wunderten klaren Geist Herders; Wieland bemerkt
darauf, die Stelle des Generalsuperintendenten sei
doch vakant; gute Köpfe könne man immer brau-
chen in Weimar.
Wenig später, im Dezember 1775 teilt Goethe Her-
der, der sich in Bückeburg in ungesicherter berufli-
cher Situation befindet, schriftlich mit, daß der
Herzog einen Nachfolger für das geistliche Amt
suche. Herder entschließt sich, dem Ruf zu folgen
und trifft Anfang Oktober 1776 in Weimar ein. Un-
mittelbar hinter der Stadtkirche, die später den Bei-
namen Herderkirche tragen sollte, bezieht er
zusammen mit seiner Familie das barocke Pfarr-
haus, in dem er bis zu seinem Tod lebt und
wirkt.
Nach dem Einzug mit seiner Familie in
Weimar mußte Herder jedoch feststel-
len, daß der Herzog und Goethe für Kir-
che und Schulwesen wenig Interesse
zeigen und für seine hartnäckig betriebe-
nen Schulreformpläne kein Geld vorhan-
den ist. Herders gesellschaftlicher Verkehr
beschränkt sich zumeist auf Regierungsange-
stellte wie Karl Ludwig von Knebel, Christian
Gottlob Voigt und Friedrich von Einsiedel.
Ein näherer Kontakt zu Goethe ergibt sich erst zu
Beginn der 1780-er Jahre, als Herder seinem Freund
– der damals morphologische Studien betrieb – aus
Dr. phil. Michael Zaremba (Berlin)
...das bedeutenste Ereignis (...)
war die Bekanntschaft mit Herder.
Johann Gottfried Herder – Goethes Mentor
138
dem Manuskript zu den Ideen zur Philosophie der
Geschichte der Menschheit vorliest. Besonders der
erste Teil der Ideen liefert das Modell für Goethes
genetische Naturbetrachtung. In einem Brief vom
Juni 1786 bezeichnet Herder ihn denn auch als den
freiesten, gründlichsten, reinsten Geist (...) ein wah-
res exemplar humanae naturae (...), dessen Umgang
mein Trost ist u. dessen Gespräche jedesmal meine
Seele erweitern.
Doch es gibt auch grundsätzliche Differenzen: Ent-
gegen Goethes Erwartung, daß seine Entdeckung
des Zwischenkieferknochens als entwicklungs-
geschichtliches Verbindungsstück von Herder be-
grüßt würde, lehnt der Theologe in den Ideen die
Theorie der Entwicklung vom Affen zum Menschen
entschieden als inhuman ab, denn nach seiner Auf-
fassung ist die Schöpfung seit der Vorzeit abge-
schlossen. Insbesondere während der Arbeit am
dritten Teil der Ideen empfindet Herder schmerzlich
die Abwesenheit Goethes, der Anfang September
1786 heimlich – auch für Herder überraschend – zur
Italienreise aufgebrochen ist. Auf Goethes Bitten
hin aus Rom fungiert Herder als Weimarer Vertrau-
ensmann für die erste Werkausgabe, die in Goethes
Abwesenheit erscheinen soll.
Quasi als Freundschaftsdienst redigiert Herder den
Götz, macht Verbesserungsvorschläge zur Prosodie
der Iphigenie auf Tauris und schickt die aus Italien
übersandten Manuskripte, Kupferplatten und Pro-
bebogen an den Verleger Georg Joachim Göschen.
Allerdings fällt die erste Werkausgabe der Goethe-
schen Schriften nicht zur Zufriedenheit Herders aus,
wie er in einem Brief vom 11. Juni 1787 andeutet.
Herders ausgeprägte Hypochondrie und sein mür-
risches Verhalten machen den Umgang mit ihm ins-
besondere seit den 1790-er Jahren immer schwieri-
ger. Ständige Schlaflosigkeit, ein heftiges
Rückenleiden sowie Gichtschmerzen im Bein, die
ihn hinken lassen, sorgen für einen verdrießlichen
Grundton.
Im Frühjahr 1793 nehmen Goethe und der Herzog
an der Belagerung von Mainz teil. Herder begrüßt
diese militärische Initiative, welche die französi-
schen Truppen vom Reichsgebiet vertreiben soll.
Sein Alltag besteht indes, wenig kriegerisch, aus
Aktenlektüre und amtlichem Schriftverkehr an sei-
nem schwarz gestrichenen Arbeitspult aus Kiefern-
holz in dem Haus hinter der Stadtkirche.
Im Juli 1794 fordert Schiller Herder auf, an seiner
soeben gegründeten Zeitschrift Die Horen mitzuar-
beiten; er liefert daraufhin zahlreiche Ge-
dichte und Studien, unter anderem die
Schriften Das eigene Schicksal, Das
Fest der Grazien sowie Iduna, oder
der Apfel der Verjüngung – sämtlich
Texte voll gediegener Weisheit.
Doch die Beziehung zu Schiller
bleibt flüchtig. Trennend wirkt vor
allem dessen Bekenntnis zu einem de-
zidierten Ästhetizismus sowie zu Kants
Philosophie. Bereits nach wenigen Mona-
ten kommt es zur ernsten Verstimmung mit
Schiller über den Widerspruch Herders, der ihm sei-
nen Kantischen Glauben, wie es scheint, nicht ver-
zeihen kann. Auch die beginnende Freundschaft
Goethes mit Schiller beobachtet der Geistliche arg-
wöhnisch.
Insgesamt ist Herder aufgrund der politischen,
literarischen und persönlichen Querelen das Leben
in Weimar gänzlich verleidet. In den späten Lebens-
jahren ist er einsamer als je zuvor. Seine Gattin Ca-
roline hält indes unbeirrt zu Johann Gottfried, als
dieser zum notorischen Hypochonder und Queru-
lanten mutiert. Ohne sie, die ihn umsorgt, als Lek-
torin, Sekretärin und Geschäftsführerin dient und in
jeder Lage zu ihm steht. hätte sich sein Leben weit-
aus unerträglicher gestaltet.
Auch neigt er zu Boshaftigkeiten und Sticheleien
gegen Personen, die ihm nahe stehen. Diese miß-
liche Verhaltensweise, unter welcher bereits der
junge Goethe litt, ist Ergebnis einer prekären cha-
rakterlichen Mischung aus Selbstüberhebung und
einem cholerischen Temperament, dessen Wurzeln
sicherlich zum Teil in den nahezu permanenten
Schmerzen seiner Tränenfistelerkrankung und
anderen Leiden liegen.
Im November 1803 erleidet er einen
leichten Schlaganfall. Seitdem verläßt
Herder sein Haus nicht mehr. Trotz der
akuten Schwächung seines Körpers
kann er noch einige Wochen literarisch
arbeiten: Während der Aufzeichnung
eines Gedichts entgleitet ihm für immer
die Schreibfeder.
Resümierend bleibt festzustellen: Herder konnte
durchaus Herzensgüte zeigen, er erkannte Goethes
überlegene Talente an, blieb jedoch skeptisch ge-
genüber einem Kunstverständnis, das die Moral ver-
nachlässigte, denn politisch-sittliche Reflexionen
gehörten für ihn integral zu einem Kunstwerk.
139
Als der junge Goethe seine ersten literarischen
Erfolge vorweisen konnte, war der 16 Jahre ältere
Wieland bereits ein etablierter Schriftsteller. Wäh-
rend seines Studiums in Leipzig hatte Goethe
Wielands Shakespeare-Übersetzung kennengelernt.
Er las auch die Geschichte des Agathon, den ersten
deutschen Entwicklungsroman, mit dem der mo-
derne psychologische Roman in Deutschland be-
ginnt. Der Agathon beeinflußte Goethes Wilhelm
Meister-Roman. Er kannte auch die Verserzählun-
gen Wielands, besonders von Musarion war er be-
geistert. Noch im Alter erinnerte er sich des Ortes
und der Stelle, wo er durch Oesers Vermittlung die
ersten Aushängebogen zu Gesicht bekommen hatte.
Goethe schrieb an den Verleger Philipp Erasmus
Reich: Nach ihm [Oeser] und Shakespearen, ist
Wieland noch der einzige, den ich für meinen echten
Lehrer erkennen kann, andre hatten mir gezeigt,
daß ich fehlte, diese zeigten mir, wie ichs besser ma-
chen sollte.
1773 hatte Wieland das Libretto zu seinem Sing-
spiel Alceste verfaßt. Es war das erste deutsche
Singspiel, nach dem Vorbild der Tragödie Alkestis
von Euripides. Die Musik stammte von dem Wei-
marer Hofkapellmeister Anton Schweitzer. Dieses
Singspiel wurde am 28. Mai 1773 im Weimarer
Schloß uraufgeführt. Dazu hatte Wieland in seiner
Zeitschrift Der Teutsche Merkur die Briefe an einen
Freund über das deutsche Singspiel veröffentlicht.
Darin warf er Euripides mangelnde Klarheit und
geringe idealisierende Gestaltung des Herkules in
seiner Alkestis vor.
Der junge Goethe, auf dem Gipfel seiner Genie-
periode, argwöhnte hier eine Entweihung des
griechischen Vorbildes. So ging er in sein Ar-
beitszimmer, in den dritten Stock seines Elternhau-
ses am Großen Hirschgraben in Frankfurt, und
verfaßte eine Farce mit dem Titel Götter,
Helden und Wieland. Er schrieb sie an
einem schönen Sonntagnachmittag
bei einer Flasche guten Burgunders
in einer Sitzung herunter. Darin
attackierte er den Verfasser der
Alceste als Salonpoeten und emp-
findsamen Nörgler, weil Wieland
es gewagt hatte, den griechischen
Tragiker Euripides zu kritisieren.
Doch geschickt und souverän un-
terlief Wieland den Angriff. In seiner
Zeitschrift Der Teutsche Merkur emp-
fahl er diese kleine Schrift allen Liebha-
bern der pasquinischen Manier zur
Lektüre. Sie sei ein Meisterstück von Persiflage
und sophistischem Witze. Goethe, dadurch be-
schämt, merkte, mit wem er es zu tun hatte und be-
reute diesen Ausfall.
1773 erschien Goethes Schauspiel Götz von Berli-
chingen mit der eisernen Hand. Nach einer negati-
ven Beurteilung durch Christian Heinrich Schmid
im September 1773 folgte im Juni 1774 eine ver-
ständnisvolle und sogar lobende Besprechung durch
Wieland in seiner Zeitschrift Der Teutsche Merkur.
Darin heißt es: Junge mutige Genien sind wie junge
mutige Füllen; das strotzt von Leben und Kraft,
tummelt sich wie unsinnig herum, schnaubt und
wiehert, wälzt sich und bäumt sich, schnappt und
beißt, springt an den Leuten hinauf, schlägt vorn
und hinten aus, und will sich weder fangen noch rei-
ten lassen. Desto besser! (...) Man muß die Herren
ein wenig toben lassen; und wer etwan von unge-
fähr von ihnen gebissen oder mit dem Huf in die
Rippen geschlagen wird, tröste sich damit,
daß aus diesen nämlichen wilden Jüng-
lingen noch große Männer werden
können.“
Wieland bemerkt, Götz von Ber-
lichingen sei ein Schauspiel, das
man nicht aufführen kann, bis uns
irgend eine wohltätige Fee ein
eigen[es] Theater und eigene
Schauspieler dazu herzaubert –
immerhin sei es ein schönes
Ungeheuer. Möchten wir viele sol-
che Ungeheuer haben! Der Fort-
schritt zu wahren Meisterstücken würde
dann sehr leicht sein. (...) Wollte Gott,
Götzens Verfasser gäb’ uns ein ganzes Jahrhundert
in einer tragikomischen Farce, die im Geiste seines
Götzens geschrieben wäre. Möchte sie doch 365
Akte haben!
In seiner Rezension hatte Wieland Goethes Genie
erkannt und vorausschauend geschrieben: Und so
wie ich mich kenne, bin ich gewiß, daß wir am Ende
noch sehr gute Freunde werden müssen. Im
Dezember 1774 verfaßte Goethe einen Versöh-
nungsbrief an Wieland.
Dr. Egon Freitag (Weimar)
Wielands Seele ist von Natur aus ein Schatz,
ein wahres Kleinod...
Zum Verhältnis von Goethe und Wieland
140
Am 27. Oktober 1775 schrieb Wieland an Johann
Kaspar Lavater: Auf Göthen warten wir hier sehn-
lich seit 8-10 Tagen von Tag zu Tag, von Stunde zu
Stunde. Am 7. November 1775, morgens fünf Uhr,
traf Goethe in Weimar ein. Drei Tage später berich-
tet Wieland: Wie ganz der Mensch beim ersten An-
blick nach meinem Herzen war! Wie verliebt ich in
ihn wurde, da ich beim Geh[eimen] Rat v. Kalb (wo
er wohnt) am nämlichen Tage an der Seite des herr-
lichen Jünglings zu Tische saß. Seit dem heutigen
Morgen ist meine Seele so voll von Göthen wie ein
Tautropfe von der Morgensonne. Der Göttliche
Mensch wird, denk' ich länger bei uns bleiben als
werde, so wird es Seine Gegenwart würken. Eine
sehr gute Prophezeiung!
Nach der persönlichen Bekanntschaft der beiden
Dichter kam es rasch zur Aussöhnung. Wieland
hatte Goethe die Farce Götter, Helden und Wieland
verziehen und war von dem jungen Genie begei-
stert. Er hatte ihn sogar mit einem Gedicht begrüßt:
An Psyche. Darin heißt es:
Auf einmal stand in unsrer Mitten
Ein Zaubrer! – Aber denke nicht,´
Er kam mit unglückschwangerm Gesicht
Auf einem Drachen angeritten!
Ein schöner Hexenmeister es war,
Mit einem schwarzen Augenpaar,
Zaubernden Augen voll Götterblicken,
Gleich mächtig, zu töten und zu entzücken.
So trat er unter uns, herrlich und hehr,
Ein echter Geisterkönig, daher;
Und niemand fragte: Wer ist denn Der?
Wir fühlten beim ersten Blick, ’s war er!
Wir fühlten’s mit allen unsern Sinnen
Durch alle unsre Adern rinnen.
So hat sich nie in Gottes Welt
Ein Menschensohn uns dargestellt.(...)]
Goethe ging bald in Wielands Haus ein und aus. Er
spielte mit seinen Kindern und fand in seiner Fami-
lie göttlich reine Stunden. An Johanna Fahlmer be-
richtet er: Wieland ist gar lieb, wir stecken immer
zusammen, und gar zu gerne bin ich unter seinen
Kindern.
Neidlos überließ Wieland dem jüngeren Dichter-
kollegen die Priorität in Weimar. Schon vier Monate
nach dessen Ankunft berichtete er am 11. März
1776 an Merck: Unser Göthe hat sich der Welt
durch seine ›Stella‹ wieder herrlich geoffenbaret.
Wie triumphiert mein Herz über jeden neuen Sieg,
den er erhält, jede neue Provinz, die er erobert! Wis-
sen Sie ein ander Beispiel, daß jemals ein Dichter
den andern so enthusiastisch geliebt hat?
Und in einem anderen Brief schreibt Wieland: Für
mich ist kein Leben mehr ohne diesen wunderbaren
Knaben, den ich als meinen eingebornen einzigen
Sohn liebe, und, wie einem echten Vater zukommt,
meine innige Freude daran habe, daß er mir so
schön übern Kopf wächst, und alles das ist, was ich
nicht habe werden können.
Ein andermal berichtet Wieland an Merck, daß ihn
Goethe in seinem Garten gezeichnet hat: Alles, was
halbweg Menschenaugen hat, sagt, es sehe mir un-
gemein gleich. Mir kömmts auch so vor. Noch kein
Maler von Profess[ion] hat mich nur leidlich getrof-
fen. Der Hauptumstand ist, daß es Göthe, und con
amore gemacht hat.
Im gleichen Brief verteidigt Wieland den jungen
Stümer und Dränger gegen böse Gerüchte: Wegen
Göthen bitt’ ich Sie ewig ruhig zu sein. Ihr werdet
sehen, daß er sogar in diesem Hefen der Zeit, worin
wir leben, große Dinge tun u[nd] eine glänzende
Rolle spielen wird.
Goethe arbeitete an Wielands Zeitschrift Der
Teutsche Merkur mit und veröffentlichte dort zahl-
reiche Gedichte, z.B. Hans Sachsens poetische Sen-
dung sowie verschiedene Aufsätze aus der
Italienischen Reise. Er half ihm auch bei der Ge-
winnung von Autoren, doch im August 1778 spot-
tete Goethe über Beiträge, die
als Fortsetzung in größeren
zeitlichen Abständen veröf-
fentlicht wurden. Da heißt
es: In dem Sau Merkur ist’s
doch, als ob man was in
eine Kloake würfe, es ist
recht der Vergessenheit ge-
widmet und so schnitzel-
weis genießt kein Mensch
was.«
Aber durch Wielands
konziliantes Verhalten
wurden Meinungsverschieden-
141
heiten rasch beigelegt und der vertrauliche Umgang
bald wieder hergestellt. Sie duzten sich auch,was
zwischen Goethe und Schiller nicht der Fall war.
1780 erschien Wielands Oberon. Goethe erhielt
diese Verserzählung, als er gerade beabsichtigte, zur
Gerichtsstube zu fahren. Er begann zu lesen und
konnte nicht aufhören. Sein
Diener trat ein und meldete
den Wagen, doch Goethe
hörte nicht drauf. Ihro Exzel-
lenz, die Uhr hat 10 geschla-
gen. – Mag sie doch 11
geschlagen haben, ich kann
heute nicht fahren, und wenn
einer mich sprechen will, so
sagt, ich habe nicht Zeit.
Darauf entfernte er sich in ein
Nebenzimmer und las den
Oberon völlig durch. Danach
erhielt sein Bedienter den
Auftrag, Wieland eine runde Schachtel zu überbrin-
gen. Der Diener zieht seine weißen Handschuhe an,
tritt bei dem Dichter ein, übergibt ihm die Schachtel
und sagt mit dem freundlichsten Lächeln: Seine Ex-
zellenz läßt sich dem Herrn Hofrat allerschönstens
empfehlen, und er schickt dem Herrn Hofrat einen
Lorbeerkranz für den ›Oberon‹.
Wieland öffnet die Schachtel, auf welcher geschrie-
ben steht: Darf nicht gedrückt werden, mit Vorsicht
zu öffnen. Er ist entzückt über den Duft der Dich-
terkrone und sagt zum Bedienten: Seiner Exzellenz
meinen besten Dank, ich werde heute noch selber
so frei sein, zu erscheinen. Wieland zeigt freudig
den Kranz seiner Gemahlin und schreibt diesen Tag
wieder an Merck einen Brief voll des Lobes über
Goethe. Dieser gelangt zu der Einschätzung: Sein
›Oberon‹ wird, so lang Poesie Poesie, Gold Gold und
Kristall Kristall bleiben wird, als ein Meisterstück
poetischer Kunst geliebt und bewundert werden.
Goethe holte sich auch gern den Rat des Älteren. So
hatte Wieland zuerst die schlotternde Prosa der
Iphigenie bemängelt, wodurch er ihm die Unvoll-
kommenheit des Werks aufzeigte.
1797 erwarb Wieland das Landgut Oßmannstedt.
Ein Jahr später kaufte sich Goethe ebenfalls ein
Landgut in Oberroßla bei Apolda. So wurden sie
Feldnachbarn. Wieland berichtet: Verwichenen
Sonntag hatte ich das Vergnügen, meinen Feldnach-
bar Goethe bei mir zu sehen und ein Halbdutzend
sehr angenehme Stunden mit ihm zuzubringen. Er
schickte mir tags zuvor seine ›Propyläen‹ und bat
sich zugleich auf den folgenden Mittag bei mir zu
Gaste. Er war sehr heiter, und die besagten ›Propy-
läen‹ ließen es uns nicht an interessanten Stoff zum
Dialog fehlen.
In einem Brief an den Wiener Staatsmann Joseph
Friedrich von Retzer erkundigt sich Wieland im
Juni 1808: Haben Sie unter den Novitäten der letz-
ten Buchhändlermesse auch eine der allerwürdig-
sten, die neue sehr vermehrte, veränderte und
beinahe ganz umgeschaffene Ausgabe des Goethi-
schen Doktor Faust schon gesehen? Sie macht unter
dem Titel: Faust, eine Tragödie von Goethe, einen
Band der bei Cotta herauskommenden sämtlichen
Werke dieses Dichters aus; ist aber auch a parte
[zum Teil] in einem kleineren Taschenformat zu
haben. Auch das, was wir jetzt von dieser barock-
genialischen Tragödie, wie noch keine war, und
keine jemals sein wird, erhalten haben, ist nur der
erste Teil derselben, und der delphische Apollo mag
wissen, wie viele Teile noch folgen sollen.
Ich bin begierig zu wissen, welche Sensation die-
ses exentrische Geniewerk zu Wien macht, und be-
sonders wie Ihnen die Walpurgisnacht auf dem
Blocksberge gefallen wird, worin unser Musaget mit
dem berühmten Höllen-Breughel an diabolischer
Schöpfungskraft, und mit Aristophanes an pöbelhaf-
ter Unfläterei um den Preis zu ringen scheint. Was
wird sich der neue Prometheus für lustige Kontor-
sionen geben, um uns weis zu machen: daß dieser
Faust das Nonplusultra des menschlichen Geistes,
und das Göttlichst-Menschlichste und Teuflischste
aller Dichterwerke sei?
Man muß gestehen, daß wir in unsern Tagen
Dinge erleben, wovon vor 25 Jahren noch kein
Mensch sich nur die Möglichkeit hätte träumen las-
sen. Bei allem dem befürchte ich, unser Freund
Goethe hat sich selbst durch dieses Wagestück mehr
geschadet, als ihm sein ärgster Feind jemals scha-
den könnte, und sein Verleger wird der einzige sein,
der sich wohl dabei befinden wird.
142
Der vertrauliche, zwanglose und herzliche Umgang
zwischen Goethe und Wieland wird in zahlreichen
Berichten bestätigt. So hat zum Beispiel der Philo-
loge Bernhard Rudolf Abeken im August 1809 eine
Abendgesellschaft bei Professor Griesbach in Jena
miterlebt: Zum Abend waren Goethe und Knebel ge-
laden. Die Unterhaltung beim Tee war angenehm.
Goethe führte meistens das Wort. Aber beim Essen
ging erst meine Lust an. Die Wirtin gab mir den
Platz zwischen Wieland und seiner Tochter. Goethen
gerade gegenüber. Da wollt’ ich nun, Du hättest ge-
sehen und gehört, wie heiter, ja wie ausgelassen lus-
tig Goethe war. Er, Wieland und Knebel sind
Freunde aus alter Zeit, auf Du und Du; so war das
Gespräch vertraulich und zwanglos.
Unter andern kam es auch auf einige Weimari-
sche Schauspielerinnen, an deren einer die jüngeren
Frauenzimmer allerlei auszusetzen hatte, besonders
in Hinsicht auf das Äußere, die Gestalt. Goethe
nahm die Partie, und wußte so komisch darzutun,
wie, wenn man an dem Körper hier ein Weniges
wegnähme, dort ansetzte usw. – eine gar stattliche
Gestalt zutage kommen würde, daß der alte Wie-
land nicht aus dem Lachen kam, wiederholt Goe-
then um Quartier bat, endlich niederkauerte, und
die Serviette über den Kopf zog und gegen den
Mund drückte, sei es, um den Erguß des Lachens zu
hemmen, sei es, um den Übrigen seine Grimassen
zu verbergen. Wieland meinte nachher, in zwanzig
Jahren habe er Goethen nicht so gesehen.
Anschaulich schildert Goethe den Schreibprozess
seines Freundes: Denn daß er alles mit eigener
Hand und sehr schön schrieb, zugleich mit Freiheit
und Besonnenheit, daß er das Geschriebene immer
vor Augen hatte, sorgfältig prüfte,
veränderte, besserte, unverdrossen
bildete und umbildete, ja nicht
müde ward, Werke von Umfang
wiederholt abzuschreiben, dieses
gab seinen Produktionen das
Zarte, Zierliche, Faßliche, das Natürlichelegante,
welches nicht durch Bemühung, sondern durch hei-
tere genialische Aufmerksamkeit auf ein schon fer-
tiges Werk hervorgebracht werden kann.
Dieses unverdrossene Ausbessern der Romane und
Verserzählungen entsprach Wielands Streben nach
künstlerischer Vollendung, um den Stoff am wir-
kungsvollsten und in höchster Perfektion zum Aus-
druck zu bringen. Den Roman Agathodämon soll er
siebenmal abgeschrieben haben. Goethe bewun-
derte diese stilistische Meisterschaft, die Virtuosität
des Freundes und erklärte: Wielanden verdankt das
ganze obere Deutschland seinen Stil. Es hat viel von
ihm gelernt, und die Fähigkeit, sich gehörig auszu-
drücken, ist nicht das geringste.
Am 20. Januar 1813 starb Wieland in Weimar. Auf-
gebahrt wurde er im Bertuchhaus und fünf Tage
später im Park zu Oßmannstedt beigesetzt, an der
Seite seiner Gemahlin und von Sophie Brentano.
Am 18. Februar 1813 hielt Goethe im Festsaal des
Wittumspalais eine Logenrede: Zu brüderlichem
Andenken Wielands. Darin sagte er: Woher kam die
große Wirkung, welche er auf die Deutschen aus-
übte? Sie war eine Folge der Tüchtigkeit und der
Offenheit seines Wesens. Mensch und Schriftsteller
hatten sich in ihm ganz durchdrungen, er dichtete
als ein Lebender und lebte dichtend.
An anderer Stelle gelangte Goethe zu der Einschät-
zung: Dieser vorzügliche Mann darf als Reprä-
sentant seiner Zeit angesehen werden; er hat
außerordentlich gewirkt, indem gerade das, was ihn
anmutete, wie er sich’s zueignete und es wieder mit-
teilte, auch seinen Zeitgenossen angenehm und ge-
nießbar begegnete.
Kurz nach Wielands Tod sprach Goethe mit
Johannes Daniel Falk und meinte: Wielands Seele
ist von Natur ein Schatz, ein wahres Kleinod. Dazu
kommt, daß sein langes Leben diese geistig schönen
Anlagen nicht verringert, sondern vergrößert hat.
143
Die Situation, daß zwei gleichzeitig lebende große
Dichter sich freundschaftlich verbinden, kommt in
der Geschichte äußerst selten vor. Große Künstler
pflegen einander eher zu meiden, da ein Zusam-
mengehen meist unlösbare Konflikte im Gefolge
hätte. Daß es zwischen Schiller und Goethe zu einer
echten Begegnung kam, daß beide nicht lebens-
länglich bloße Nachbarn blieben, sondern Freunde
wurden, ein ›Paar‹, wie es ihre berühmten Doppel-
standbilder versinnbildlichen, ist etwas Singuläres.
Dafür gab es allerdings auch ganz besondere Vo-
raussetzungen. War es eine Vorahnung, eine Vi-
sion? Fest steht, daß Schillers Sehnsucht nach
einem Freund übergewöhnlichen Ausmaßes, einem
Mann antiken Formats, sich im Jahr 1794 verwirk-
lichen sollte, als der seine Zeitgenossen als Dichter
und Mensch weit überragende Goethe an seine
Seite trat. Schiller jedenfalls empfand es so, daß das
Glück ihm durch Goethes Freundschaft seine über
Jahrtausende zurückschweifende Sehnsucht er-
füllte.
Das bekundet ein an Goethe gerichteter Brief: Mein
geliebter, mein verehrter Freund. Wie rührt es mich,
wenn ich denke, was wir sonst nur in der weiten
Ferne eines begünstigten Altertums suchen und
kaum finden, mir in Ihnen so nahe ist. Damit
erfüllte das Schicksal Schiller nach langem vergeb-
lichem Hoffen den Traum eines Freundschaftsbun-
des, den er als das wohlthätigste Ereigniß seines
ganzen Lebens empfand.
Trifft es auf Schiller zu, daß ihn die Art seiner mi-
litärischen, von weiblichem Umgang völlig entfern-
ten, Erziehung auf der Hohen Karlsschule früh zum
Kult männlicher Freundschaft hinlenkte, was auch
die Lehrer, die die Karlsschüler in die Geschichte
und Literatur des griechisch-römischen Altertums
einführten, beförderten, so gilt das hier Gesagte
mutatis mutandis gleichfalls für
den jungen Goethe.
Seine früh erworbene, reiche
humanistische Bildung war
ebenso stark wie die Schillers
von den Idealen der griechisch-
römischen Antike geprägt und
auch für ihn waren ungewöhn-
lich intensive Freundschaftsge-
fühle charakteristisch.
Auf Goethes Enthusiasmus für
Sokrates folgte seine Begeiste-
rung für die homoerotischen
Preisgesänge des höchstrangi-
gen griechischen Lyrikers Pindar, an denen ihm das
Wesen ieder meisterschafft aufging. Natürlich
wußte er später auch die hohe Kunst der an Männer
gerichteten Liebessonette Shakespeares zu schät-
zen, so wie ihn als Mittsechziger der Diwan des
größten persischen, spätmittelalterlichen Lyrikers
Mohammed Schems ed-din Hafis verzauberte, des-
sen Ghaselen vielfach durch schöne Knaben ausge-
löst waren.
Ähnliche Beispiele ließen sich aus der Goethe
wohlvertrauten italienischen, französischen und
englischen Literatur anführen, falls es weiterer Be-
weise bedürfte, daß es Goethe keineswegs verbor-
gen war, welche große Rolle in der Weltliteratur die
Liebe zwischen Männern spielt. Sie zu akzeptieren,
war für Goethe wie für Schiller eine stillschwei-
gende Voraussetzung.
Von den auf Homoerotik bezüglichen Sachverhal-
ten, die hier im Kontext der Freundschaft
Schillers und Goethes zur Sprache ge-
bracht werden hat die Literaturwissen-
schaft bisher wenig Notiz genommen.
Inzwischen ist es über ein halbes Jahrhun-
dert her, daß Thomas Mann an Schillers
Gedicht Das Glück als literarische Ca-
mouflage für Schillers Liebe zu Goethe
erinnert hat. Sich auf Thomas Mann be-
rufend, wagte Ilse Graham zwei Jahr-
zehnte später von der erotisch bewegten
Wechselbeziehung« zwischen den beiden
»Geistesantipoden« als einem »diffizilen
und reizvollen Widerspiel zwischen Geist
und Natur zu sprechen.
Allerdings wirkte sich das auf die Auslegung von
Gedichten noch lange nicht aus. Meine wiederhol-
ten Versuche, einzelne Dichtungen Goethes als Lie-
besbotschaft für Schiller oder ein Schiller-Gedicht
als getarntes Liebesgedicht für Goethe zu deuten,
stießen zunächst auf Unglauben. Die Vorstellung,
daß Schiller und Goethe einander Liebesgedichte
zugeschickt haben könnten, schien noch weiterhin
fast unvorstellbar. Erst allmählich änderte sich das
mit dem Erscheinen einiger vorurteilsloser Publi-
kationen über Fiktionalisierung homoerotischer Er-
fahrung.
Prof. Dr. Katharina Mommsen (Palo Alto)
Kein Rettungsmittel als die Liebe
Goethes und Schillers Bündnis
im Spiegel ihrer Dichtungen
144
Daß man sich der literarischen Camouflage be-
diente, erhöhte gewiß den Reiz, der für beide Dich-
ter in diesen Hervorbringungen lag. Es galt die
Engherzigkeit der Philister zu überlisten. Goethe
wußte schon, warum er während des glücklichen
Jahrzehnts mit Schiller dem Freunde niemals das
vertraute ›Du‹ anbot, was bei Lesern des Brief-
wechsels, der so viel menschliche Nähe zeigt, Ver-
wunderung auszulösen pflegt. Doch vor der Welt
galt es, Distanz zu wahren und den Schein einer ho-
moerotischen Zuneigung zu vermeiden. Die ihm
Nahestehenden kannten Goethes Verschwiegenheit
und vorsichtige Zurückhaltung; sie wußten, daß er
»in bezug auf sich geheim« und Diskretion »eine
seiner ausgebildetsten Tugenden« war. Dement-
sprechend gab es den von vorneherein ostensiblen
Briefwechsel, der sich seinem ganzen Gehalt nach
zur späteren Veröffentlichung qualifizierte.
Doch gab es außerdem einen ›geheimen Dialog‹, in
dem Goethe und Schiller in Versen miteinander
kommunizierten. In Gedichten konnte man sich
maskieren und Versteck spielend seinen Empfin-
dungen freieren Lauf lassen. Von dieser heimlichen
Zwiesprache zweier einander liebenden Dichter
soll in den folgenden Kapiteln die Rede sein. Viel-
leicht fällt dadurch auch etwas neues Licht auf den
allzu theoretisch-abstrakten Begriff der »Deutschen
Klassik«, wenn man gewahr wird, wie sehr diese
Beziehung vom ›Eros‹ – im Sinne von Platons
Phaidros – geprägt war.
Allerdings muß man sich, um dieser Liebe zwi-
schen Goethe und Schiller gerecht zu werden, zu
der Einsicht verstehen, daß Liebe und Begehren,
Erotik und Sexualität zweierlei sein können und
daß die abendländische Geschichte eine ›platoni-
sche Liebe‹ kennt, deren Gegenstand Mann oder
Frau sein kann. Das geliebte Wesen ist das Me-
dium, durch das der Liebende, ohne daß es zu einer
körperlichen Vereinigung kommen muß, eine Stei-
gerung des eigenen Wesens erfährt. Auch ist zu be-
denken, daß für Künstler, die in ihren Werken
Gestalten beiderlei Geschlechts schaffen müssen,
die Liebe zum eigenen wie die zum andern Ge-
schlecht sozusagen eine Schaffensvoraussetzung
ist.
Zum Auftakt des lyrischen Liebes-Dialogs mit
Schiller sei noch ein kurzer Blick auf die psycho-
logisch aufschlußreiche Vorgeschichte geworfen.
Nachdem Schiller wiederholt eine echte Annähe-
rung an Goethe erhofft und gesucht hatte, spiegelt
sich ausgesprochene Haß-Liebe zu dem unnahba-
ren, vergeblich Umworbenen in dem berühmten
Briefbekenntnis gegenüber Körner vom 2. Februar
1789: Oefters um Goethe zu sein, würde mich un-
glücklich machen: er hat auch gegen seine nächs-
ten Freunde kein Moment der Ergießung, er ist an
nichts zu fassen; ich glaube in der That, er ist ein
Egoist in ungewöhnlichen Grade. Er besitzt das Ta-
lent, die Menschen zu fesseln, und durch kleine so-
wohl als große Attentionen sich verbindlich zu
machen; aber sich selbst weiß er immer frei zu be-
halten. Er macht seine Existenz wohlthätig kund,
aber nur wie ein Gott, ohne sich selbst zu geben (...)
Ein solches Wesen sollten die Menschen nicht um
sich herum aufkommen lassen. Mir ist er dadurch
verhaßt, ob ich gleich seinen Geist von ganzem
Herzen liebe und groß von ihm denke. Ich betrachte
ihn wie eine stolze Prude, der man ein Kind machen
muß, um sie vor der Welt zu demüthigen, und an
meinem guten Willen liegt es nicht, wenn ich nicht
einmal mit der ganzen Kraft, die ich in mir aufbieten
kann, einen Streich auf ihn führe, und in einer Stelle,
die ich bei ihm für die tödtlichste halte. Eine ganz
sonderbare Mischung von Haß und Liebe ist es, die
er in mir erweckt hat, eine Empfindung, die derje-
nigen nicht ganz unähnlich ist, die Brutus und Cas-
sius gegen Caesar gehabt haben müssen; ich könnte
seinen Geist umbringen und ihn wieder von Herzen
lieben. Goethe hat auch viel Einfluß darauf, daß ich
mein Gedicht gern recht vollendet wünsche. An sei-
nem Urtheile liegt mir überaus viel. Die Götter
Griechenlands hat er sehr günstig beurtheilt: nur zu
lang hat er sie gefunden, worin er auch nicht un-
recht haben mag. Sein Kopf ist reif, und sein Urtheil
über mich wenigstens eher gegen mich als für mich
parteiisch. Weil mir nun überhaupt nur daran liegt,
Wahres von mir zu hören, so ist dies gerade der
Mensch unter allen die ich kenne, der mir diesen
Dienst thun kann. Ich will ihn auch mit Lauschern
umgeben, denn ich selbst werde ihn nie über mich
befragen (…)
Von Goethe wiederum erfährt man aus dem rück-
blickend verfaßten autobiographischen Bericht
Glückliches Ereigniß über die Mißverhältnisse, wel-
che ihn jahrelang von Schiller entfernt hielten, als
ihn bei der Rückkehr aus Italien dessen Räuber an-
widerten und er bei deren großem Publikumserfolg
sein eigenes Bemühen völlig verloren sah und er
sich so betroffen davon fühlte, daß er die Ausübung
der Dichtkunst damals gerne völlig aufgegeben
hätte. Im Bewußtsein, daß eine ungeheure Kluft zwi-
schen ihren Denkweisen klaffte, vermied Goethe den
sich in Weimar aufhaltenden, in seiner Nachbar-
schaft wohnenden Schiller. Drastischer kann man es
145
kaum ausdrücken, als Goethe es aus der Rück-
schau tat: An keine Vereinigung war zu denken. (…
) Niemand konnte läugnen, daß zwischen zwei
Geistesantipoden mehr als Ein Erddiameter die
Scheidung mache.
Nach einer solchen Vorgeschichte wirkt das Bünd-
nis beider Geistesantipoden, dessen Auftakt Goe-
the so treffend als Glückliches Ereigniß bezeichnet,
umso irrationaler und inkalkulabler. Zwar führt er
selber einige rationale Gründe an: Schillers Bestre-
ben, ihn zur Mitarbeit an den Horen zu gewinnen,
weswegen er ihn mehr anzuziehen als abzustoßen
suchte. Dazu kam Schillers größere Lebensklugheit
und Lebensart, denen es gelang, diplomatisch Goe-
thes alten »Groll« zu überbrücken. Goethes
Bericht zufolge verdankte sich die Wendung, daß
aus der Jenaer Begegnung von Juli 1794 ein glück-
liche[s] Beginnen wurde, vor allem der Verlockung
des Gesprächs und dem lapidar vermerkten Haupt-
umstand: Schillers Anziehungskraft war groß.
Ebenso spontan wie unter den damaligen Um-
ständen für Goethe unerwartet entwickelte sich
gegenüber dem bis dahin als Widersacher empfun-
denen Schiller große Liebe und Zutrauen. Sie muß-
ten sich damals auf beiden Seiten sogleich
entwickeln und bewähren. Schiller befand sich
1794 auf dem Höhepunkt einer Schaffenskrise, da
er seit Jahren sein Dichten aufgegeben hatte. Er
hegte Zweifel an seinem poetischen Talent über-
haupt und wandte – unter dem machtvollen Einfluß
von Kant – all seine Kraft auf philosophische und
historische Arbeiten. Goethe betrachtete es als
seine nächste Aufgabe, dem Freund zu helfen, den
Weg von der Philosophie zurück zur Dichtkunst zu
finden, in der er dessen einzig wahre Bestimmung
erkannte.
Doch noch in anderer Hinsicht war Goethe in seiner
Freundespflicht gefordert. Schiller begann seine
Zeitschrift Die Horen; seine wirtschaftliche Zukunft
hing davon ab, daß er attraktive Mitarbeiter fand.
Goethe sprang als Retter ein. Um Die Horen und
Schillers Musen-Almanache zu füllen, wandte er viel
Zeit und Kräfte auf. Emsig lieferte er Beiträge, die
größtenteils als Nebenarbeiten zu betrachten sind
und die damals sein Ansehen als Dichter beeinträch-
tigten. Um Stoff für Die Horen zu schaffen, ließ er
sich sogar auf Übersetzungstätigkeit ein. Die eigenen
dringlichsten Vorhaben, die Schöpfung eines neuen
großen, seiner würdigen Werkes, gerieten darüber in
den Hintergrund. Wie in Rom, so mußte Goethe auch
jetzt die wichtigste dichterische Arbeit nebenher
thue[n].
Wollte Goethe jedoch der Hauptbedrängnis Schillers
abhelfen, so bedurfte es eines Opfers noch ganz an-
deren Ausmaßes. Schiller war auf fortwährende An-
regung und Diskussion seines Schaffens angewiesen.
Goethe versagte sich nicht. Er wirkte seit den ersten
Tagen ihrer Begegnung aktivierend auf den Freund
ein, förderte dessen Schaffen, wo er konnte, schenkte
ihm eigene Stoffe. Durch diese Leistungen tätiger
Liebe gelang es ihm, den Freund wieder zum Dich-
ten zurückzuführen. Sollte nun Schillers Rekonva-
leszenz als Dichter nicht gefährdet werden, so
bedurfte er auch weiterhin ständig der Lenkung und
Anregung durch Goethe. Hier nun ergab sich für die-
sen eine Gewissensnot. Sein ganzes Streben war da-
rauf gerichtet, nach Italien zurückzukehren und sich
in Rom niederzulassen.
Goethe befand sich auch seinerseits in den ersten
Jahren seiner Freundschaft mit Schiller in einer
Schaffenskrise. Sie wurde noch durch eine Eigen-
schaft des Freundes befördert, die ihn andererseits
höchst schätzenswert für Goethe machte. Als bedeu-
tender Dichter war Schiller der ergiebigste Ge-
sprächspartner, den Goethe je gefunden hatte.
Goethe genoß diese Gespräche, ließ sich aber durch
sie auch dazu verlocken, mit Schiller über seine ei-
genen Schaffensvorhaben zu sprechen. Unglück-
licherweise aber gelangen ihm Dichtungen nur,
wenn er sie vor andern geheim hielt, mit niemandem
besprach. Nur in absoluter Stille und Einsamkeit
konnten sie gedeihen. So wirkte sich der Gedanken-
austausch mit Schiller paralysierend auf die Ausfüh-
rung von Goethes eigenen dichterischen Plänen aus.
Wiederholte Anläufe zu großen Dichtungen gerieten
ins Stocken.
Goethes dichterische Produktivität ging zurück,
während Schiller seine Schaffenskraft wiederge-
wann. Verzichtete Goethe nun auf den Plan, wieder
nach Rom zu gehen, verblieb er in Weimar, um
Schillers Schaffen zu fördern, so sah er damit sein
eigenes Schaffen endgültig gefährdet. Hoffnungen,
an die er sich viele Jahre geklammert hatte, wurden
zunichte. Ein solches Opfer erschien Goethe zu groß,
um sich ohne weiteres dazu durchringen zu können.
War er nun einerseits entschlossen, nach Italien zu
gehen, so war er andererseits von Tag zu Tag mehr
davon überzeugt, wie dringend Schiller seiner Hilfe
bedurfte. Schiller beeinflußte ihn zum Bleiben. Be-
schwörend schrieb er ihm damals, sei er von Goethe
getrennt, so fehlt mir das Element, worin ich leben
soll. Endlich kam es zur Krise. Im Sommer 1797 trat
146
Goethe seine Reise nach Italien wirklich an. Letzte
Maßnahmen, die Verbrennung seiner gesamten Kor-
respondenz, das Aufstellen eines Testaments, zeigen
an, daß er die endgültige Auswanderung ins Auge
faßte. Indessen habe ich alles so geordnet und bin so
los und ledig als ich jemals war, schrieb er am 7. Juli
1797 seinem Freunde Heinrich Meyer, mit dem er
nach Italien reisen wollte.
Schon war Goethe in der Schweiz mit Meyer zusam-
mengetroffen, nur noch der Gotthard
trennte sie von Italien, da überkam ihn
plötzlich die Einsicht, er müsse nach
Weimar, d.h. zu Schiller, zurückkeh-
ren. Er erkannte, daß er sich nicht von
dem Freunde trennen durfte, der ihn
brauchte, dem seine Krankheit nur
noch eine sehr begrenzte Lebensdauer
zur Erfüllung seiner Aufgaben ließ.
Damals entschloß Goethe sich zu dem
Opfer, das zu bringen er sich lange
gesträubt hatte: dem Schaffen des
Freundes zuliebe auf die Förderung
des eigenen Schaffens zu verzichten.
Mit dem Entschluß, sich nicht von
Schiller zu trennen, nahm Goethe
auch die vorauszusehende weitere
Behinderung in Kauf. Klagen über die eigene Un-
produktivität wiederholen sich zahllose Male in
Goethes Briefen während der ganzen Zeit seiner
Freundschaft mit Schiller. Die verhältnismäßig we-
nigen eigenen, wirklich gelungenen Dichtungen
jener Jahre beweisen, daß Goethes schöpferische
Kraft durchaus nicht erloschen war. Nur konnte sie
damals nicht so zum Zuge kommen, wie es bei
einem Goethe hätte natürlich sein müssen. Schiller
spürte seinerseits, daß Goethe sich in einer Phase
nachlassender Schöpferkraft befand. Und seine
Freundschaft erwies sich darin, daß er Goethe auf
sich selbst, zu seiner poetischen Kreativität, zurück-
verwies.
Überhaupt darf das Genießen der von beiden wäh-
rend der Freundschaftsepoche geschaffenen Werke
nicht unerwähnt bleiben, weil es zur Erfüllung ihrer
geistigen Gemeinschaft gehörte. Erst
nach Schillers Tod stellte sich die alte
Schöpferkraft wieder ein, jetzt setzte
Goethe die Reihe seiner großen Dich-
tungen fort, von den Wahlverwandt-
schaften über den West-östlichen
Divan bis hin zu Faust II.
Es existieren nur wenige Äußerungen
Goethes, die verraten, welche Bedeu-
tung er dem Verzicht auf Rom bei-
maß. So bekennt er in einem Brief an
Staatsrat Schultz vom 10. Januar
1829, die Freundschaft zu Schillern,
die Teilnahme an seinem Dichten,
Trachten und Unternehmen hätten ihn
die Reise abbrechen lassen. Riemer
wußte, es war Goethes wahrhaft an-
tiker Sinn für Freundschaft gewesen, der ihn auf
Rom habe Verzicht leisten lassen. Tatsächlich war es
die freundschaftliche Aufopferung im Stile Winckel-
manns, die Goethes Weg zu diesem Verzicht vorge-
zeichnet hatte.
Dieses Freundschaftsethos, dessen Zentrum die Auf-
opferung für den Freund bildete, verherrlichte
Goethe auch in Wilhelm Meisters Lehrjahre, an des-
sen letzten Büchern er gerade schrieb, als er Schiller
kennenlernte.
Mit Sätzen wie: Ohne Aufopferung läßt sich keine
Freundschaft denken hatte Goethe sich dem Freund
innerlich verpflichtet. An das Diktum, daß alles auf
die Übereinstimmung von Denken und Tun an-
kommt, dieser bündigsten Zusammenfassung der
Turm-Ethik, fühlte Goethe sich selbst am meisten
gebunden.
In Dichtung und Wahrheit erklärte Goethe: Uneigen-
nützig zu sein in allem, am uneigennützigsten in
Liebe und Freundschaft, war meine höchste Lust,
meine Maxime, meine Ausübung. Man hat diese
Worte nie völlig ernstgenommen. Wird man jedoch
gewahr, wie Goethe sich für Schiller im Verborgenen
geopfert hat, so erweist sich ihre volle erlebte Wahr-
heit. Die dort erwähnte Uneigennützigkeit (…) in
Freundschaft – Goethe hat sie wirklich in höchstem
Grade ausgeübt. Dies war das Neue – und zugleich
etwas Einmaliges. In der Geistesgeschichte weiß
man von keinem Freundschaftsopfer gleicher Art.
Von Schiller stammt das intime Bekenntnis, daß es,
dem Vortrefflichen gegenüber keine Freyheit giebt
als die Liebe. In den ein Jahr nach Schillers Tod
geschriebenen Wahlverwandtschaften antwortete
Goethe darauf insgeheim, ohne daß irgendjemand
Schiller als den Urheber vermuten konnte, mit der
Eintragung in Ottilies Tagebuch: Gegen große Vor-
züge eines andern gibt es kein Rettungsmittel als die
Liebe.
Aus der Einleitung von Katharina Mommsens Buch
Kein Rettungsmittel als die Liebe, Wallstein Verlag, 2009.
147
Einen besonderen Wissensbereich stellen für Goe-
the die in seiner Zeit aufblühenden Naturwissen-
schaften dar. Sein Streben nach Naturerkenntnis,
nach dem was die Welt im Innersten zusammenhält
hat ihn vom Kindesalter an sein ganzes Leben be-
gleitet. Erkenntnis ist für ihn ein erstrebenswertes
Ziel, ja das höchste Lebensziel. So heißt es: Im
ersten Beinhaus war’s wo ich beschaute (...) Was
kann der Mensch im Leben mehr gewinnen, als daß
sich Gott-Natur ihm offenbare?
In einem ähnlichem Sinne äußert er sich zu Ecker-
mann am Ende seines Lebens: Es geht doch nichts
über die Freude, die uns das Studium der Natur
gewährt. Ihre Geheimnisse sind von einer uner-
gründlichen Tiefe, aber es ist uns Menschen er-
laubt und gegeben, immer weitere Blicke
hineinzuthun...
An anderer Stelle stellt Goethe einen Bezug zwi-
schen der Naturwissenschaft, dem Menschen und
Gott her: Ohne meine Bemühungen in den Natur-
wissenschaften hätte ich die Menschen nie kennen-
gelernt, wie sie sind; der Mensch muß fähig sein,
sich zur höchsten Vernunft erheben zu können, um
an die Gottheit zu rühren, die sich in Urphänome-
nen, physischen wie sittlichen offenbaret.
Seine ersten naturwissenschaftlichen Grundlagen
erhält Goethe während seiner Erziehung in Frank-
furt durch Privatlehrer. Nach seiner Erkrankung in
Leipzig und der Rückkehr nach Frankfurt 1768 be-
schäftigt er sich während der Rekonvaleszenz mit
Alchemie und Chemie, wobei die Freundin seiner
Mutter, die Pietistin Katharina von Klettenberg ihn
anregt und seine Lehrmeisterin ist. In Straßburg
besucht er neben seinen juristischen auch naturwis-
senschaftliche Vorlesungen, so zum Beispiel Lek-
tionen über Arzneimittelkunde, Chemie und
Medizin.
Mineralogie und Geologie
Goethes Interessen sind der gesamten Natur zuge-
wandt – von den unterirdischen Schätzen der Erde
bis zu den Spiralnebeln des Kosmos.
Mit Geologie und Mineralogie be-
schäftigt er sich intensiver, seitdem
er 1777 in die Bergwerkkommis-
sion des Herzogtum Sachsen-Wei-
mar aufgenommen wird und so
zusammen mit seinem Kammerkol-
legen Carl Wilhelm Voigt für den
Ilmenauer Bergbau verantwortlich ist.
So verfaßt er zahlreiche geologische und mineralo-
gische Schriften, darunter: Bildung des Erdkörpers;
Zur Geologie besonders der böhmischen; Geologi-
sche Probleme und Versuch ihrer Auflösung; Der
Kammerberg bei Eger I und II; Mineralogie von
Thüringen und angrenzender Länder; Über den
Granit; Über Bildung von Edelsteinen; Eiszeit;
Über den Bau und die Wirkungsart der Vulkane in
verschiedenen Erdstrichen von Alexander von
Humboldt; Beschreibung der Karlsbader Müller-
schen Steinsammlung.
Kenntnisse der Geologie vermittelt
ihm Friedrich Heinrich von Tebra,
seit 1801 Oberberghauptmann in
Freiberg/Sachsen, der ein Duz-
freund Goethes wird sowie der Il-
menauer Bergfachmann Johann
Carl Wilhelm Voigt, der 1789
Bergrat in Ilmenau ist.
Kontakt hat er auch zu dem Minera-
logen Abraham Gottlob Werner von
der Bergakademie Freiberg/Sach-
sen. Dieser hat eine heute noch zu
besichtigende umfangreiche Mi-
neraliensammlung aufgebaut und
ist ein Hauptvertreter des Neptunis-
mus. Goethe übernimmt dessen An-
schauungen und widmet Werner nach
dessen Ableben das Gedicht Werners Tod mit einer
eigenen Positionierung:
Kaum wendet der edle Werner den Rücken,
Zerstört man das poseidonische Reich,
Wenn alle sich vor Hephaistos bücken,
Ich kann es nicht sogleich.
Die Auseinandersetzung zwischen Vulkanismus
und Neptunismus spiegelt sich in Faust II (2. Akt)
in den differierenden Aussagen des Vulkanisten
Anaxagoras und des Neptunisten Thales wider.
Anaxagoras: Hast Du, o Thales je in einer Nacht
solch einen Berg aus Schlamm hervorgebracht?
und Durch Feuerdunst ist dieser Fels zu Handen.
Thales: Im Feuchten ist Lebendiges entstanden.
Prof. Dr. Volker Hesse (Berlin)
Döbereiner beträgt sich sehr lobenswürdig...
Goethe, die „Jenenser“ und weitere Lehrer
der Naturwissenschaften (Dia-Vortrag)
148
Als die Hinweise auf die Richtigkeit der Annahme
einer vulkanischen Erdgestaltung größer werden,
kann und will Goethe dies nicht vollständig akzep-
tieren..
Hinsichtlich der Geologie und Mineralogie begrün-
det Goethe sein leidenschaftliches Interesse bereits
1780 gegenüber Johann Heinrich Merck mit den
Worten: Ich habe mich diesen Wissenschaften, da
mich mein Amt dazu berechtigt mit einer völligen
Leidenschaft ergeben. Eine Begründung für sein
spontanes Interesse an der Mineralogie gibt er
Eckermann: So hat auch die Mineralogie nur in
einer doppelten Hinsicht Interesse für mich gehabt:
Zunächst nämlich ihres großen praktischen Nutzens
wegen, und dann, um darin ein Dokument über die
Bildung der Urwelt zu finden...
Wissenschaftlicher Berater und Leh-
rer in Fragen der Mineralogie war
für Goethe in Jena Johann Georg
Lenz. Bis 1780 Aufseher des Na-
tursteinkabinetts wird er 1794 Di-
rektor der Mineralogischen
Sammlung. Goethe steht mit ihm
seit 1784 in engem Austausch und
unterstützt Lenz 1798 bei der Gründung
der Mineralogischen Gesellschaft, deren Ehrenmit-
glied Goethe wird; 1804 übernimmt er sogar die
Präsidentschaft der Gesellschaft.
Auch auf seinen Reisen ist Goethe stets bemüht,
seine geologischen und mineralogischen Kennt-
nisse zu erweitern und zu vertiefen. Er suchte den
Kontakt zu Fachexperten wie Horace Benedict de
Saussure und Joseph Sebastian Gruner, zu Graf
Caspar Maria von Sternberg und dem Karlsbader
Stein- und Wappenschneider Joseph Müller.
Chemie
Die Chemie ist immer noch meine heimliche
Geliebte, schreibt Goethe 1770 aus Straßburg an
Katharina von Klettenberg (später hat er sie in den
Bekenntnissen einer schönen Seele in Wilhelm Mei-
sters Lehrjahren literarisch geehrt.)
Goethe liest in seiner dem Studienaufenthalt in
Leipzig folgenden Frankfurter Rekonvaleszenzzeit
in den Jahren 1768-1770 alchimistische Schriften
von Paracelsus, Basilius Valentinus, Georg Welling,
J. B. van Helmont und beschäftigt sich mit der
Aurea Catena Homeri. Er kauft sich einen eigenen
»Windofen« und führt chemische Versuche im El-
ternhaus durch.
In Straßburg nimmt er im Wintersemester
1770/1771 an dem chemisch experimentellen
Unterricht des Apothekers und Rektors der Uni-
versität, Jacob Reinhold Spielmann, teil und er-
weitert hier seine chemischen Kenntnisse.
Goethes geologische und Bergbauinte-
ressen sind eng mit der Mineralogie
verknüpft, für deren Verständnis
Kenntnisse der Chemie erforder-
lich sind.
Der Weimaer Hofapotheker Wil-
helm Heinrich Sebastian Buch-
holz, ein anerkannter Chemiker,
der u. a. die antiseptische Wirkung von Kohlendi-
oxid erkennt, berät Goethe bei chemischen Fragen
und hilft ihm beim Experimentieren. Nach gemein-
samer Vorarbeit mit Goethe läßt er z. B. 1784 und
1785 mit Erfolg Heißluftballone aufsteigen, was da-
mals eine Sensation ist. Goethe schätzt Buchholz
sehr: Was die Chemie betrifft, so dürfen wir uns der-
selben vorzüglich rühmen. Herr Bergrat Buchholz
hat von den frühesten Zeiten her, mit der Wissen-
schaft gleichen Schritt gehalten und die interessan-
testen Erfahrungen
teils selbst gemacht,
teils zuerst mitgeteilt
und ausgebreitet. Aus
seiner Schule ist ein
Göttling hervorge-
gangen...
Der erste Professor für Chemie der Jenenser Uni-
versität Johann Friedrich August Göttling, der nach
seiner Tätigkeit an der Weimarer Hofapotheke 1779
die erste pharmazeutische Zeitschrift in Deutsch-
land gründet, den Almanach oder Taschenbuch für
Scheidekünstler und Apotheker. Von Herzog Carl
August erhält er die finanzielle Unterstützung, um
an der Universität Göttingen Chemie und naturwis-
senschaftliche Fächer zu studieren.
Goethe läßt Göttling ein chemisches Labor im Je-
naer Schloß einrichten. Er wird 1789 der erste Pro-
fessor für Chemie auf einem selbständigen
Lehrstuhl in Deutschland. Er analysiert für Goethe
verschiedene Mineralien und wird von ihm zu che-
mischen und optischen Versuchen und Analysen he-
rangezogen. Der Chemiker informiert ihn über die
Ablösung der alten Phlogistontheorie durch die
149
moderne Oxydationstheorie Lavoisiers, einer Re-
volution im chemischen Verständnis. Bei chemi-
schen Verbindungen unterscheidet er zwischen
Verbindungs- und Wahlverwandschaften. Letzteren
Begriff nimmt Goethe später zum Titel seines
gleichnamigen Romans. Hier angewandt auf die
zwischenmenschlichen Beziehungen von Charlotte,
Eduard, dem Hauptmann und Ottlie: Eine neue stär-
kere Verbindung ersetzt eine schwächere. Auch
Göttlings bekanntes und viel genutztes vollständi-
ges chemisches ProbirCabinet findet in den Wahl-
verwandschaften Erwähnung.
In der Nachfolge des 1809 verstorbe-
nen Göttling wird Johann Wolfgang
Döbereiner als Dozent und nach-
folgend als Professor für Chemie
nach Jena berufen, Goethes wich-
tigster Lehrer der Chemie. Goethe
und Döbereiner verbindet eine 20
jährige positive Zusammenarbeit
und ein freundschaftliches Zusammen-
wirken. Döbereiner wird mit der Zusammenfassung
von je 3 Elementen zu Triaden, z. B. Lithium, Ka-
lium, Natrium einer der Vorläufer des chemischen
Periodensystems der Elemente. Ferner wird er durch
zahlreiche Veröffentlichungen bekannt, besonders
durch die Entdeckung, daß Platin eine Katalysator-
wirkung hat. Die Grundlage eines von ihm entwi-
ckelten Feuerzeugs beruht auf der Erkenntnis, daß
ein Wasserstoff-Luft-Gemisch sofort entflammt,
wenn man es gegen einen Platinschwamm strömen
lässt. Goethe nutzt Döbereiners Feuerzeug persön-
lich und schreibt an ihn 1826: Es ist eine höchst an-
genehme Empfindung, wenn wir eine bedeutende
Naturkraft also bald zu irgend einem nützlichen
Gebrauch eingeleitet sehen, und so bin ich in dem
Falle, mich Ew. Wohlgeboren immer dankbar zu er-
innern, da Ihr so glücklich erfundenes Feuerzeug
mir täglich zur Hand steht und immerfort auf eine
wundersame Weise nützlich wird.
Der Briefwechsel Goethes mit Döbereiner umfasst
123 Briefe. Döbereiner verfaßt zahlreiche Bücher,
genannt seien die Anfangsgründe der Chemie und
Stöchiometrie und den Grundriß der allgemeinen
Chemie. Zwei Werke, mit denen sich auch Goethe
beschäftigt. Er beauftragt Döbereiner mit zahlrei-
chen Analysen von Mineralien sowie Mineral-
wässern und führt mit dessen Unterstützung
Farbextraktionsversuche an Pflanzen durch, die er
für seine Farbenlehre benötigt.
Der Staatsminister schätzt Döbereiner fachlich und
menschlich: An den Physiker Thomas Johann
Seebeck schreibt er 1812: Unser Professor der
Chemie, Döbereiner in Jena, macht seine Sache
sehr gut, er ist jung, tätig, hat viele technische Ein-
sicht und Fertigkeit, so daß er sich auch schon als
Oberaufseher unserer Bierpfannen und Brandwein-
blasen sehr wacker gezeigt hat. Riemer teilt Goethe
im Mai 1816 mit: Daß ich Döbereiner und somit
der Chemie in Jena für ewig eine Burg erbauen
kann, giebt mir eine behagliche Tätigkeit.
Botanik
In botanischen Fragen erhält Goethe in Jena vor
allen Dingen Unterstützung und Beratung von Au-
gust Johann Georg Karl Batsch. Goethe lernt Batsch
bereits 1785/86 kennen und setzt sich für dessen
Berufung 1787 zum Professor für Naturgeschichte
an der Universität Jena ein. Mit
ihm diskutiert er seine Vorstel-
lungen zur Metamorphose der
Pflanzen. 1793 gründet Batsch
die Naturforschende Versamm-
lung, deren Tagungen auch in
seinem Haus stattfinden. 1794
kommt es dort nach dem Zusam-
mentreffen Goethes und Schillers auf
dieser Tagung zu dem beglückenden Ereignis, dem
Beginn der Freundschaft zwischen Schiller und
Goethe.
Goethe beschäftigte sich auch mit der Botanik von
Jean-Jacques Rousseau und dem botanischen Sys-
tem von Carl von Linné. Im September 1785 stu-
diert Goethe dessen Philosophia botanica erstmals
und nutzt dieses Werk u.a. auch auf seiner italieni-
schen Reise sowie für seine botanische Schrift Ver-
such die Metamorphose der Pflanzen zu erklären.
Anatomie und Medizin
In der Blütezeit der Jenaer Medizinischen Fakultät
am Ende des 18. Jahrhunderts ragten die Persön-
lichkeiten von Justus Christian Loder, Johann Stark
der Ältere und Christoph Wilhelm Hufeland hervor.
Mit Anatomie und Medizin kommt Goethe schon
als Heranwachsender in Berührung. In der Biblio-
thek seines Vaters finden sich 19 verschiedene ana-
tomische Werke, darunter auch die anatomischen
Tabellen des Dr. J. A. Kulmus. Bereits im Alter von
11 Jahren besucht Goethe in Frankfurt die bekannte
Senkenbergerische Anatomie. Weitere Erfahrungen
sammelt er in Leipzig und Straßburg. Am Beginn
150
des 2. Semesters 1770 hörte er in Straßburg Anato-
mie bei den Universitätslehrern Lobstein und Ehr-
mann, letzterer ist gleichzeitig auch Chirurg.
In Dichtung und Wahrheit schreibt er: Die Anatomie
war mir auch deshalb doppelt wert, weil sie mich
des widerwärtigen Anblick ertragen lehrte, indem
sie meine Wissbegierde befriedigte. Und so besuchte
ich auch das Klinikum des älteren Doktor Ehrmann,
sowie die Lektionen der Entbindungskunst seines
Sohnes, in der doppelten Absicht alle just auch ken-
nen zu lernen und mich von aller Apprehension
gegen widerwärtige Dinge zu befreien....
Eine für Jena herausragende Rolle
spielt dabei in der Zeit von
1778-1803 der Anatom, Chi-
rurg und Geburtshelfer Justus
Christian Loder. Bald nach
seiner Übersiedlung nach Wei-
mar lernt Goethe Loder bei
anatomischen Demonstrationen
kennen, besucht 1780 seine Ana-
tomie in Jena und nimmt im Jahr da-
rauf regelmäßig an seinen Vorlesungen im
Anatomischen Theater teil. Frau von Stein teilt er
mit: Loder erklärte mit alle Beine und Muskeln und
ich werde in wenigen Tagen vieles fassen. An Carl
August berichtet er: Mir hat Loder Osteologie und
Myologie beigebracht. Zwei Unglückliche waren
uns eben zum Glück gestorben, die wir dann auch
gründlich abgeschabt und von ihrem sündigen
Fleisch geholfen haben.
1781 wendet Goethe seine neu erworbenen anato-
mischen Kenntnisse bei der Ausbildung von jungen
Leuten an der Weimaer Zeichenakademie an. Carl
August teilte er mit: Auf den Mittwoch fing ich an
(...), das Skelett den jungen Leuten (...) zu erklären,
und sie zur Kenntnis des menschlichen Körpers an-
zuführen. (...) Ich tue es zugleich um meiner und
ihretwillen.
1784 entdeckt Goethe bei vergleichenden anato-
mischen Untersuchungen mit Loders Unterstützung
das Os intermaxillare. An Herder schreibt er voll
Freude Ende März 1784: Ich habe weder gefunden
Gold noch Silber, aber was mir eine unsägliche
Freude macht, das Os intermaxillare am Menschen
(...), denn es ist wie der Schlußstein zum Menschen
fehlt nicht, ist auch da.
Nachdem Loder das Manuskript Goethes über den
Zwischenkieferknochen (später auch Os Goethei)
gelesen hatte, schreibt er ihm nachfolgende
schmeichelnde Worte: Ich habe bei Durchlesung
desselben so viel Vergnügen empfunden, und Ihre
Praecesion in der anatomischen Beschreibung so
wol, als Ihren Blick in die Physiologie des Theils so
sehr bewundert, daß ich in der anatomischen
Begeisterung es im vollen Ernst bedaure, daß Sie
Minister und nicht Professor anatomiae sind.
Bereits 1788 weist Loder in seinem Anatomischen
Handbuch auf Goethes Entdeckung hin.
Goethe führt seine anatomischen Studien auch in
Italien fort, wie sein anatomisches Skizzenbuch
ausweist. Nach seiner Rückkehr hört er im Novem-
ber 1788 bei Loder erneut Vorlesungen über die
Anatomie der Muskeln. 1794 hört er mit Alexander
und Wilhelm von Humboldt und dem Maler
Johann Heinrich Meyer eine Vorlesung über die
Gelenkbänder. In den folgenden Jahren besucht er
weiterhin Loders anatomische Vorlesungen.
Angeregt durch die Brüder Humboldt entsteht 1795
Goethes Schrift Erster Entwurf einer allgemeinen
Einleitung in die vergleichende Anatomie ausge-
hend von der Osteologie. Mit der von ihm ange-
wandten Methode der vergleichenden Anatomie hat
Goethe eine gute methodische Grundlage geschaf-
fen und wird deshalb auch von Ernst Haeckel als
Vorläufer der Abstammungslehre anerkannt.
Einen Mißklang in den Beziehungen zwischen Goe-
the und Loder gibt es, als dieser bei der Übersiedlung
nach Halle seine anatomische Sammlung mitnimmt
und damit die Grundlage für einen qualifizierten ana-
tomischen Studentenunterricht in Jena stark beein-
trächtigt wird. Goethe und Herzog Carl August
veranlassen daraufhin den Aufbau einer neuen ana-
tomischen Sammlung. Da es an Originalpräparaten
mangelt, befürwortet Goethe die Nutzung von
Wachsmodellen zu Lehr- und Anschauungszwecken.
Seinen Jugendfreund und zeitweiligen
»Mentor«, den Darmstädter Kriegs-
zahlmeister und späteren Kriegsrat
Johann Heinrich Merck, hat Goe-
the 1772 in Darmstadt kennenge-
lernt. Merck gewinnt ihn für die
Mitarbeit an den von ihm betreuten
Frankfurter Gelehrten Anzeigen. Goe-
the sagt von Merck: ein eigener Mann,
der auf mein Leben den größten Einfluß gehabt.
Der vielseitig interessierte Merck beschäftigt sich
intensiv mit der vergleichenden Osteologie, auch
151
unter Nutzung fossiler Materialien und verfaßt 1782
einen Knochenbrief, dem 1784 und 1786 zwei wei-
tere folgen.
Mitunter stehen Goethe und Merck im Wettbewerb
um den Erwerb fossiler Funde, so z. B. um einen
Krokodilskopf, den Merck schneller ergattert. Goe-
the ärgert sich noch im Alter darüber: Mit habsüch-
tiger Liebhaberei bemächtigte er sich mancher
vorzüglicher Exemplare. Goethe ist andererseits sehr
daran interessiert, von Merck den aktuellsten Stand
seiner Forschung zur vergleichenden Osteologie zu
erfahren, während er sich hinsichtlich seiner eigenen
Forschungsbemühungen sehr bedeckt hielt.
Merck und Goethe sehen sich persönlich zum letz-
ten Mal im Oktober 1788 in Mühlhausen, drei Jahre
vor Mercks Freitod.
Den bekannten Anatom Samuel Thomas von Soem-
mering lernt Goethe 1783 in Kassel kennen.
Soemmering informiert ihn über zahl-
reiche wesentliche anatomische
Werke. Goethe erbittet sich von ihm
Tierschädel, um seine vergleichen-
den Untersuchungen am Zwischen-
kiefer vornehmen zu können, u. a.
auch den Schädel des in Kassel ver-
unglückten indischen Elefanten, den er
auch erhält. Obwohl Soemmering Goe-
thes Entdeckung des Zwischenkieferknochens kri-
tisch gegenüber steht, empfiehlt er 1791 eine
Publikation der Arbeit. Später beschäftigt sich So-
emmering mit dem menschlichen Auge, Untersu-
chungen, die Goethe, der sich seit 1791 mit der
Farbenlehre beschäftigt, sehr interessieren. Zum 50
-jährigen Dienstjubiläum Soemmerings sendet Goe-
the ihm 1828 ein Lederetui mit der Aufschrift: Sei-
nem erprobten Freunde und Studien-Genossen
Sömmering (!) zu dessen Jubeltage.
Den Wiener Anatom Franz Josef Gall lernt Goethe
im Juli 1805 in Halle kennen, als dieser dort einen
Vortrag hält. Gall ist der Begründer
der Phrenologie; er glaubt, von der
äußeren Schädeldecke auf geis-
tig-seelische Anlagen schließen
zu können. Von Galls Vortrag,
speziell von dessen Kenntnissen
des Gehirns, ist Goethe begeistert
und betrachtete dessen Ausführun-
gen als Gipfel vergleichender Anato-
mie. Gall besucht Goethe im Oktober1807 in
Weimar und erreicht, daß dieser von Carl Gottlob
Weißer eine Lebendmaske abnehmen läßt. Die von
Weißer auf dieser Basis 1807/1808 gestaltete Büste
stellt den wahren Goethe dar.
Der in Langensalza geborene Christoph Wilhelm
Hufeland ist von 1783-1793 als praktischer Arzt in
Weimar tätig und in dieser Zeit auch Hausarzt Goe-
thes. Nach einer Pockenepidemie verfaßte er 1787
sein erstes Buch: Über die Ausrottung der Pocken.
Auf Anregung Goethes wird Hufeland 1791 Mit-
glied der durch Herzog Carl August inaugurierten
Freitagsgesellschaft, eines literarisch-geselligen
Kreises, in dem aber auch naturwissenschaftliche
Themen besprochen werden.
Hufeland beeindruckt die Runde und speziell Her-
zog Carl August bei einem Vortrag über seine Ma-
krobiotik, die Kunst, das menschliche Leben zu
verlängern. Dies hat zur Folge, daß Hufeland 1793
zum Professor an der Universität Jena berufen wird.
Noch der alte Hufeland schwärmte von seinen Be-
gegnungen mit Goethe und rechnete es zu dem
größten Vergnügen meines Lebens (...), daß es mir
vergönnt war, diesem großen Geiste persönlich
nahe zu stehen.
Seinem berühmtesten Werk Makrobiotik – ein Weg-
bereiter der modernen Alterswissenschaft – stellt er
Worte aus dem Egmont voran: Süßes Leben! Schöne
freundliche Gewohnheit des Daseyns und Wirkens!
– von Dir soll ich scheiden?
Hufeland schildert in seiner Selbstbiographie die
Wirkung des jungen, 1775 nach Weimar gekomme-
nen Goethe: Dieser junge 27-jährige, feurige Herr
Doktor – denn so hieß er damals – brachte eine
wunderbare Revolution in diesem Orte hervor, der
bisher ziemlich philisterhaft gewesen war und nun
plötzlich genialisiert wurde (...). Man kann sich kei-
nen schöneren Mann vorstellen. Dabei sein lebhaf-
ter Geist und seine Kraft, die seltenste Vereinigung
geistiger und körperlicher Vollkommenheit, groß,
stark und schön.
Goethe gibt in der Zeit, da Hufeland sein Hausarzt
ist, diesem medizinisch nicht allzuviel zu tun, bleibt
aber mit ihm im Gespräch über aktuelle und medi-
zinische Probleme: Im Faust II (Paralipomena,
Bruchstücke 136) lesen wir: Ein Leibarzt muß zu
allem taugen. Wir fingen bei den Sternen an und en-
digen mit Hühneraugen.
Hufeland propagierte die Stärkung und Nutzung der
körpereigenen Kräfte zur Vermeidung von Krank-
152
heiten, durch gesunde Ernährung,
frische Luft, Abhärtung und kör-
perliche Bewegung, Maximen,
die wir z. T. gleichlautend bei
Goethe finden. Diese Empfeh-
lungen gelten auch für den Patien-
ten Goethe. Dieser schreibt an Frau
von Stein (14. 04. 1785), daß ihm
Hufeland die Bewegung als die beste Arznei anrät.
Hufeland hält den Kontakt zu Goethe auch nach sei-
ner Übersiedlung nach Berlin aufrecht und besucht
ihn mehrmals in Weimar und Jena. Goethe würdigt
Hufeland als: einen umsichtigen und mit mannigfal-
tigem Talent der Behandlung und auch der Darstel-
lung begabter Arzt, einen in seinem Fach ernsthaft
beschäftigten, im Neuen voranschreitenden und über
das Alter nachdenkenden Menschen.
Wesentliche Aspekte seines gesundheitsbewußten
Credos der Makrobiotik fasste Hufeland in Versform
zusammen. Einige Zeilen seien angeführt.
Halt deine Seele frei von Haß,
Neid, Zorn und Streites Übermaß,
Und richte immer deinen Sinn
Auf Seelenruh und Frieden hin.
Denn Leib und Seele sind genau
In dir vereint, wie Mann und Frau,
Und müssen stets, sollst du gedeihn,
In guter Eh' beisammen sein.
Liebe, reine Herzensliebe
Führe dich der Ehe zu;
Denn sie heiligt deine Triebe,
Gibt dem Leben Dauer und Ruh.
Bewege täglich deinen Leib,
Sei's Arbeit oder Zeitvertreib;
Zu viele Ruh macht dich zum Sumpf,
Sowohl an Leib als Seele stumpf.
Goethes umfangreiche naturwissenschaftliche
Studien und der Austausch mit führenden naturwis-
senschaftlichen Lehrern, wobei hier schwerpunkt-
mäßig auf die Lehrer der Chemie und Anatomie
eingegangen worden ist, begründeten einen natur-
wissenschaftlichen Fundus, der es ihm ermöglichte,
auch Zukunftsvisionen zu gestalten, die zu seiner
Zeit utopisch waren, heute aber naturwissenschaft-
liche Möglichkeit und Realität sind.
Das Homunculuskapitel im Faust II beruht auf Wis-
sen in der Chemie, Biologie und Medizin. Hier ant-
wortet Wagner auf die Frage Mephistos, was er in
seinem Labor gerade synthetisiert: Es wird ein
Mensch gemacht (...) Was man an der Natur Ge-
heimnisvolles pries, Das wagen wir verständig zu
probieren, Und was sie sonst organisieren ließ, Das
lassen wir kristallisieren.. Zu einer Zeit, da das
menschliche Ei der Frau noch nicht entdeckt war,
postulierte Goethe in der Farbenlehre Kapitel Alchi-
misten für den Menschen:
Hier ist ein Ei, ein Sperma,
Mann und Weib,
Vierzig Wochen,
und so entspringt zugleich der Stein der Weisen,
das Universal-Recipe und der allzeitig fertige Cassier.
Goethes Farbenlehre wurde bereits 1810 bei Cotta
in Tübingen gedruckt. Die Publikation der Entde-
ckung des menschlichen Eies erfolgte durch Carl
Ernst von Baer erst 1827! Heute ist es in der Fertili-
tätstherapie mittels der Mikroinjektionstechnik
sogar möglich, eine Eizelle mit einem einzelnen
Spermium zu befruchten.
Die Analyse des menschlichen Genoms im Jahre
2007(!) bedeutet die Entschlüsselung eines Goethe-
schen Urphänomens. Goethes Evolutionsgedanke
der Natur kommt in der Aussage Thales (Faust II)
nach dem Zerschellen des Homunculus am Throne
der Galatae zum Ausdruck. Homunculus muß nun
auf natürliche Weise neu beginnen: Da regst du dich
nach ewigen Normen, durch tausend,abertausend
Formen. Und bist zum Menschen hast Du Zeit.
Alle ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
nutzt Goethe, um sein Wissen in den Naturwissen-
schaften zu erweitern und stets auf dem aktuellen
Stand zu halten. Besondere Bedeutung haben für ihn
aber die Experten der Jenaer Universität, mit denen
er sich kontinuierlich über aktuelle Fragestellungen
austauschen kann. Über die Genugtuung, die der 80-
jährige Goethe hinsichtlich seines Wirkens an der
Jenaer Universität empfindet, berichtet der Prinzen-
erzieher Frederic Soret nach einem Gespräch, das er
im März 1830 mit ihm führte: für Chemie, Botanik
und Mineralogie (…) habe er besondere Lehrstühle
eingerichtet. Vor allem sei für das naturwissen-
schaftliche Museum und die Bibliothek von ihm
manches Gute bewirkt worden.
Die Jenaer Universität war, wie Goethe in seinem
offenen Bekenntnis ausführt, s e i n e Akademie,
die ihm die Entwicklung seines »wissenschaftlichen
Bestrebens« ermöglicht hat.
Volker Hesse
153
Manfed Geiers Thema, das wir hier nur anreißen
können, ist Goethes Freundschaft mit den so unter-
schiedlichen Brüdern Wilhelm und Alexander von
Humboldt, die für seine Naturforschungen eine
wichtige Rolle gespielt haben. Seine Schilderung
setzt ein wenige Wochen nach dem glücklichen
Ereignis, wie Goethe rückblickend den Beginn sei-
ner Freundschaft zu Schiller im Sommer 1794,
nannte.
Wilhelm von Humboldt war schon seit einigen Jah-
ren mit Goethe bekannt. Im Dezember 1789 ist man
sich zum ersten Mal begegnet und beide spüren so-
fort ihre Geistesverwandtschaft. Auch den jungen
Humboldt beschäftigt das philosophische Problem,
wie sinnliche Anschauungen und intellektuelle
Ideen miteinander vermittelt werden können. Im
März 1794 kommt auch Alexander, der als Ober-
bergmeister in Ansbach tätig ist, nach Jena zu Be-
such und bei einem gemeinsamen Abendessen trifft
er zum ersten Mal Goethe, der sich sofort für die
Arbeiten des jungen Humboldt interessiert.
Ausführlich läßt er sich über dessen praktische
Tätigkeit im Bergbau informieren und über seine
1793 publizierten botanischen Schriften, die Frei-
berger Pflanzenwelt betreffend, ergänzt durch
Aphorismen aus der chemischen Physiologie der
Pflanzen.
Gesichert ist, daß Goethe diese Werke besaß und
im Sommer 1794 durchzuarbeiten beginnt. Er
stimmt Humboldts Ansichten im Grundsätzlichen
zu. Nur dessen physiologische Definition der »Le-
benskraft« scheint ihm weder klar genug noch aus-
reichend zu sein. Goethe vermißt in Humboldts
botanischen Werken die Frage nach der Form, die
im Zentrum seiner eigenen Forschungen zur Mor-
phologie der Pflanzen steht. Von zukünftigen Tref-
fen erhofft er sich vor allem eine Klärung des
Verhältnisses zwischen Leben und Gestalt.
Zur gleichen Zeit erhält Alexander von Humboldt
einen Brief von Schiller, den er bisher persönlich
noch nicht kennengelernt hat.
Wie Goethe und sein Bruder Wilhelm wird auch er
von Schiller zur Mitarbeit an dessen Zeitschriften-
projekt Die Horen eingeladen. Es freut ihn beson-
ders, daß die botanische Naturkunde nicht aus
diesem literarisch-philosophischen Projekt ausge-
schlossen sein soll, und als hätte er am glücklichen
Ereignis zwischen Schiller und Goethe am 20. Juli
1794 teilgenommen, verweist er einige Wochen
später brieflich darauf hin, daß die Pflanzenlehre
nicht den elenden Registratoren der Natur überlas-
sen bleiben dürfe, sondern den höheren und weite-
ren Ideen folgen solle. Ihn interessieren, wie er
Schiller mit einem Blick auf Goethe mitteilt, beson-
ders die allgemeine Harmonie in der Form der
Pflanzen und das Problem, ob es eine ursprüngliche
Pflanzenform gibt, die sich in tausenderlei Abstu-
fungen darstellt.
Am 17. Dezember findet dann das erste gemein-
same Treffen der Brüder Humboldt mit Schiller und
Goethe statt, wobei vor allem Alexander die Natur-
forschung in den Mittelpunkt des Interesses rückt.
Goethe fühlt sich dadurch wieder zu einer intensi-
ven Naturbetrachtung motiviert. Die Brüder Hum-
boldt bringen ihn dazu, seine pflanzen- und tierbe-
zogenen Studien und allgemeinen naturkundlichen
Ideen wieder aufzugreifen und weiterzuentwickeln.
Dabei findet er nun jenen neuen Begriff, um den all
seine späteren Forschungen und Überlegungen
kreisen sollen.
Er formuliert sein Prinzip des Typus. So, wie er ein
halbes Jahr zuvor dem erstaunten Schiller mit cha-
rakteristischen Strichen eine symbolische Pflanze
skizziert hat, will er nun den beiden Humboldts im
Dezember seine Ideen über eine vergleichende
Anatomie an einem allgemeinen Tier-Typus veran-
schaulichen.
Alexander von Humboldt bleibt für
Goethe hier ein anregender Ge-
sprächspartner, der sein natur-
kundliches Forschen und
Nachdenken immer wieder neu
in Schwung bringt. Schon bald
nach ihrem ersten Treffen in Jena
schickt er Goethe aus Bayreuth seine
mineralogischen Beobachtungen über ei-
nige Basalte am Rhein und seine früheren Studien
zur Botanik. Auch plane er, wie er Goethe mitteilt,
eine Schrift über die Vegetation im Inneren der
Erde, die er Goethe zueignen wolle. Er will das
Leben der lichtscheuen Pflanzen darstellen, und
Goethe wird ihm antworten, daß er dabei doch bitte
nicht die Form dieser sonderbaren Gewächse außer
acht lassen solle. Es gelte, die physiologischen Le-
bens-Forschungen des jungen Humboldt mit seiner
eigenen morphologischen Gestalt-Lehre zu vermit-
teln.
Prof. Dr. Manfred Geier (Hamburg)
Goethe und die Gebrüder Humboldt
154
Bereits in seinen physiologischen Versuchen zur
gereizten Muskel- und Nervenfaser, die Goethe auf-
merksam verfolgt und ab und zu auch praktisch be-
gleitet, nimmt Humboldt diese Anregung auf. Bei
seinen Experimenten zum galvanischen Fluidum,
die er 1795 gemeinsam mit Goethe und seinem
Bruder Wilhelm in Jena unternimmt, versucht er
sich auch an Prinzipien eines gemeinsamen mor-
phologischen Denkens zu orientieren.
Seine vielen Experimente mit den Froschschenkeln,
die zur Erforschung der Lebenskraft dienen, lassen
ihn auch deren Muskeln sorgfältig präparieren,
wobei ihm Goethes Programm einer vergleichen-
den Anatomie erstaunt feststellen lässt: Welche
Übereinstimmung mit dem Menschen! Welche Ähn-
lichkeit der Organisation in Formen, die so weit
von einander abzustehen scheinen.
Die Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse er-
scheinen 1808 in Humboldts Ansichten der Natur,
das ihm lebenslang sein liebstes Buch bleiben wird.
Auch an Goethe und dessen Naturansichten hat er
dabei gedacht. Goethe fühlt sich bestätigt und ge-
schmeichelt. Er schätzt Humboldts Anstrengung,
sinnliche Erfahrung und ganzheitliche Idee mitei-
nander zu vermitteln und im sinnlich-geistigen
Doppelsinn von »Ansichten« den Lesern mitzutei-
len.
Doch wie groß wäre erst Goethes Genuß gewesen,
wenn er noch den Kosmos hätte lesen können, die-
ses großartige Bild von der Welt, an dem Alexander
von Humboldt 1834, zwei Jahre nach Goethes Tod,
zu arbeiten beginnt und das ein vollendeter Aus-
druck der Goethezeit ist.
Worauf Alexander von Humboldt als Naturforscher
zielt, vollzieht sein Bruder Wilhelm als Geistes-,
Kultur- und Sprachwissenschaftler. Auch er hat sich
Anfang 1795 in Jena durch Goethes anatomische
Typenlehre begeistern lassen. Er beginnt, Schädel
zu sammeln, skelettiert selbst einen Pfau und findet
kaum Worte, Goethe dafür zu danken, welche
Freude ihm das gemeinsame Gespräch und For-
schen bereitet.
Ganz in Goethes Sinn geht es ihm vor allem darum,
praktischen Beobachtungssinn und philosophischen
Geist zusammenspielen zu lassen, um den
allgemeinen Typus des Menschen als ein Ideal
herauszuarbeiten, zu dem sich die einzelnen Indi-
vidualitäten heranbilden sollten.
Doch am stärksten wirken die klassischen Ideen
von 1794/95 in Humboldts eigentlichem Lebens-
werk nach, dessen Programm er am 29. Juni 1820
in der Berliner Akademie vorträgt: Über das ver-
gleichende Sprachstudium in Beziehung auf die
verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung.
Damit zieht er ein Resümee aus einer zwanzigjäh-
rigen Sprachforschung und legt zugleich die Richt-
linien einer sprachwissenschaftlichen und
philosophischen Arbeit fest. Auch
dabei folgt er programmatisch den
Ideen, die im Mittelpunkt seiner Ge-
spräche mit Goethe, Schiller und sei-
nem Bruder Alexander standen.
Wilhelm konzentriert sich auf den
Sprachbau, sei es einer Einzelsprache in
ihrer Individualität oder der menschlichen Sprache
überhaupt in der Vielfalt ihrer Gestaltungsmöglich-
keiten. Dabei versucht er diese Struktur auf jene
Weise zu erhellen, die Goethe in seinem Allgemei-
nen Entwurf für eine vergleichende Anatomie vor-
gezeichnet hat.
Zwischenmenschliches Verstehen in entwickelter
Form setzt eine gemeinsame Sprache voraus; und
das ist nach Humboldt Triebfeder und Medium
auch des wissenschaftlichen Fortschritts.
Als ein gemeinsames Vermächtnis der Humboldt-
Brüder können die Sätze Wilhelm von Humboldts
angesehen werden, auf die Alexander im Kosmos
ausdrücklich verwiesen hat: Es die Idee der
Menschheit, das Bestreben, die Grenzen, welche
Vorurteile und einseitige Ansichten aller Art feind-
selig zwischen die Menschen gestellt, aufzuheben;
und die gesamte Menschheit ohne Rücksicht auf
Religion, Nation und Farbe als einen großen, nahe
verbrüderten Stamm, als ein zur Erreichung eines
Zweckes, der freien Entwicklung innerer Kraft, be-
stehendes Ganzes zu behandeln. Es ist dies das
letzte, äußere Ziel der Geselligkeit und zugleich die
durch seine Natur selbst in ihn gelegte Richtung des
Menschen auf unbestimmte Erweiterung seines
Daseins.
155
Bettina Fröhlich, die Tochter unseres Schriftfüh-
rers, verdeutlicht Goethes Platon-Rezeption. Mit
dem griechischen Philosophen, dessen Kernthema
in den frühen Jahren die Frage bildet, wie unzwei-
felhaft gesichertes Wissen erreichbar ist und wie
man es von bloßen Meinungen unterscheiden kann,
kann Goethe sich zunächst wenig anfreunden.
Erst in seinem letzten Lebensjahrzehnt entdeckt er
Platons Anschauungen im Bereich der Naturphilo-
sophie und Kosmologie und verarbeitet sie im Faust
II. Großer Beifall für eine Referentin, die als haupt-
berufliche Dozentin der Philosophie zwar über Pla-
ton nahezu alles wußte, doch den Weg zu Goethe
nun notabene erst durch das vereinbarte Vortrags-
thema gefunden hat .
Was Günther Häntzschels Vortrag über Goethe
und Homer betrifft, so geht es bei seinen kennntis-
reichen Ausführungen vielen im Publikum ähnlich
wie Goethe, der in einem Brief aus Neapel 1787
schreibt: Was den Homer betrifft, ist mir wie eine
Decke von den Augen gefallen. Den Vorsatz, doch
zu Hause wieder mal die Ilias, die Odyssee oder an-
dere in den Vorträgen besprochene Werke wieder
mal aus dem Bücherschrank zu
holen, setzen tatsächlich viele
Mitglieder in die Tat um, wie ich
aus späteren Gesprächen erfahre
und das ermutigt uns, bei den
Themen auch etwas entlegenere
Pfade der Goethe-Philologie zu
beschreiten.
Goethes Hafis-Rezeption gehört zwar zu einem eher
gründlich beackerten Feld – nicht zuletzt dank un-
seres Ehrenmitglieds Katharina Mommsen, die
Jahrzehnte ihrer Forschungen auf den West-östli-
chen Divan verwandt hat. Da sie nun allerdings
ihren Wohnsitz in Kalifornien hat und die Aktualität
des notwendigen Brückenbauens zwischen West-
und Ost in diesem Jahr durch mehrere Vorträge in
arabischen Ländern aktiv unter Beweis stellen
wollte, erklärt sich Manfred Osten spontan bereit,
uns die Aktualität von Goethes Hafis-Rezeption nä-
herzubringen. So führt er aus, daß, wie wenig be-
kannt sei, der West-Östlichen Divan schon vor rund
200 Jahren höchst aktuelle Dialogstrategien und
Handlungsanweisungen für den Umgang mit dem
Islam entwickelt habe.
Goethe rühmt Hafis, den großen persischen Dichter
und Mystiker, der es im islamischen Mittelalter be-
reits freisinnig ketzerisch gewagt habe, den Eros,
den Wein, die Liebe, den Rausch poetisch zu feiern.
Osten: Goethe plädiert entschieden dafür, die
Koexistenz der islamischen und christlichen Mono-
theismen mit ihren universalistischen Ansprüchen
zu transformieren in
einen real existieren-
den »Divan«, das
heißt, in eine west-
östliche Gesprächs-
kultur des Friedens.
2010
Goethes Vorbilder
Dr. Bettina Fröhlich (Berlin)
Was Plato von Anbeginn gewußt...
Goethes Platon-Rezeption
Prof. Dr. Günter Häntzschel (München)
Glücklich ist immer die Epoche einer Literatur,
wenn große Werke der Vergangenheit wieder
einmal auftauen...
Goethe zu Homer
Dr. Manfred Osten (Bonn)
und so gleich Dir vollkommen...
Zur Aktualität der Hafis-Rezeption bei Goethe
156
Vor eine wesentlich schwierigere
Rezeptionsaufgabe stellte sein Pu-
blikum im April Hendrik Birus aus
Bremen. Arglos sind die Zuhörer in
die Hessische Landesvertretung ge-
kommen, in der Erwartung, sie wür-
den Erhellendes über die zahlreichen
– das gesamte Werk Goethes bestim-
menden – Einflüsse durch das dich-
terische Schaffen Shakespeares
erfahren.
Stattdessen verblüfft der Dozent das
Publikum mit der ausführlichen In-
terpretation einer der bis dato na-
hezu unbekannten von Goethe
stammenden Übersetzung eines
handgeschriebenen englischen Ge-
dichts von 1604, das dieser in einem
Stammbuch gefunden hatte und des-
sen Autorenschaft er Shakespeare
zuschrieb.
Einer nicht näher beschriebenen Ge-
liebten namens Cynthia gewidmet,
beginnt es mit den Zeilen:
My thoughts are winged with hopes, my
hopes with love; mount love unto the
moon in cleared night and says: as she
doth in heaven move, in earth so vains
and waxeth my delight…
Goethes Übersetzung:
Hoffnung beschwingt Gedanken, Liebe
Hoffnung / in klarster Nacht hinauf zu
Cynthiens Liebe. / Und spricht: Wie sie
sich oben umgestaltet, / so auf der Erde
schwindet, wächst mein Glück.
Da im Anschluß
an den eigenwil-
ligen Vortrag die
Meinungen der
Zuhörer von
»ganz begeistert,
wenn auch nicht
so recht das Thema« bis »schwer
verständlich, sonderbar reichen«,
sei im Folgenden ein wenig aus
Goethes eigener Feder zum Thema
Shakespeare nachgereicht:
Nennen wir nun Shakespeare einen
der größten Dichter, so gestehen wir
zugleich, dass nicht leicht jemand
die Welt so gewahrte wie er, daß
nicht leicht jemand, der sein inneres
Anschauen aussprach, den Leser in
höherm Grade mit in das Bewußt-
sein der Welt versetzt. Sie wird für
uns völlig durchsichtig; wir finden
uns auf einmal als Vertraute der Tu-
gend und des Lasters, der Größe,
der Kleinheit, des Adels, der Verwor-
fenheit, und dieses alles, ja noch
mehr durch die einfachsten Mittel
(…) Man folgt dem schlichten
Faden, an dem er die Ereignisse ab-
spinnt. Nach der Bezeichnung der
Charaktere bilden wir uns zwar ge-
wisse Gestalten, aber eigentlich sol-
len wir durch eine Folge von Worten
und Reden erfahren, was im Innern
vorgeht, und hier scheinen alle Mit-
spielenden sich verabredet zu haben,
uns über nichts im Dunkeln, im
Zweifel zu lassen.« »Was ein Gemüt
ängstlich verschließt und versteckt,
wird hier frei und flüssig an den Tag
gefördert; wir erfahren die Wahrheit
des Lebens und wissen nicht wie.
Klar verständlich
und für jeden
nachvollziehbar
dagegen Alfred
Behrmanns tief-
gründiger Fähr-
tengang im Mai,
indem er die
spärlichen Spuren aufzeigt, die im
Werk des alten Goethe zu finden
sind und doch die intensive Beschäf-
tigung mit Dante in seinen letzten
Lebensjahren nachweisen.
Besonderes Augenmerk widmet er
den Terzinen im Faust II; auch zeigt
er Querverbindungen zu
Dantes Göttlicher Komödie
auf und verweist nicht zu-
letzt auf die berühmte Szene
vom Hungertod des Ugolino
und seiner Söhne, wohl eine
der grausigsten Szenen der
Weltliteratur. Dantes Phanta-
sie schwelgt hier im Mons-
trösen und Furchtbaren;
dennoch hat Goethe diese
Episode zum Höchsten der
Dichtkunst gerechnet.
Prof. Dr. Hendrik Birus (Bremen)
William! Stern der schönsten Höhe
Goethes Shakespeare
Prof. Dr. Alfred Behrmann (Berlin)
Fegefeuer und Paradies Dantes – nachts Terzinen...
Dantes Spuren bei Goethe – ein Fährtengang
Dr. Michael Engelhard (Bonn)
allenfalls das Zarte dazu hätte ich
besser zu machen gewusst...
Der Sprachmeister Goethe als Erbe Luthers
Kanzler Müller 1827: Übrigens
sprach Goethe von Dante mit aller
Ehrfurcht, wobei es mir merkwürdig
war, daß ihm das Wort Talent nicht
genügte, sondern daß er ihn eine
Natur nannte, als womit er ein Um-
fassenderes, Ahndungsvolleres, tie-
fer und weiter um sich Blickendes
ausdrücken zu wollen schien.
157
Im September erfreut uns Christoph Perels, der
langjährige Leiter des Frank-
furter Goethehauses, mit
einem souveränen Referat
über die Bewunderung Goe-
thes für den Naturphiloso-
phen Rousseau und sein
gleichzeitig kritisches Ver-
hältnis zu dem älteren Dich-
ter als Erzieher. Bereits der
junge Goethe kennt die Nouvelle Heloise. Schlag-
worte wie »Naturwahrheit«, »Leidenschaft« oder
»Freiheit«, die man im Werther wiederfindet, auch
eine pantheistische Naturhaltung, stammen ur-
sprünglich von dort. Doch erst in seinen naturwis-
senschaftlichen Schriften bekennt Goethe
Jahrzehnte später, daß ihn die bescheidene Zurück-
zur-Natur-Haltung des Älteren beeindruckt hat: Wer
wollte nicht dem im höchsten Sinne verehrten Jo-
hann Jacob Rousseau. auf seinen einsamen Wande-
rungen folgen, wo er, mit dem Menschengeschlecht
verfeindet, seine Aufmerksamkeit der Pflanzen- und
Blumenwelt zuwendet, und in echter gradsinniger
Geisteskraft sich mit den still reizenden Naturkin-
dern vertraut macht.«
Auch der Oktober-Vortrag ist quasi wieder ein
Selbstläufer. Theo Buck aus Aachen beschreibt in
der ihm eigenen anschaulichen Manier Goethes Ver-
hältnis zu seinen französischen Dichtervorbildern
Moliere, Voltaire und Diderot.
Schon der 12-jährige, der im Frankfurter Theater die
Aufführungen Molieres in Originalsprache sieht,
zeigt sich tief beeindruckt vom Esprit, der Bühnen-
wirkung und der Sprachgewandheit des französi-
schen Dramatikers. Wenig später verfasst er in
Leipzig sein erstes Lustspiel. Die Mitschuldigen, die
seine Bemühungen widerspiegeln, es dem großen
Vorbild im Hinblick auf schlagfertige Dialoge und
kunstvoll verschachteltes Bühnengeschehen gleich-
zutun. Goethe über Molière: Es ist nicht bloß das
vollendete künstlerische Verfahren, was mich an
ihm entzückt,sondern vorzüglich auch das liebens-
würdige Naturell, das hochgebildete Innere des
Dichters. Es ist in ihm eine Grazie und ein Takt für
das Schickliche und ein Ton des feinen Umgangs.
Ausführlich geht der Referent ein auf Goethes
Übersetzungen von Voltaires Tancred sowie sein
Drama Mahomet, das er auf Ersuchen des Herzogs
am Weimarer Theater inszeniert, obwohl er insbe-
sondere mit dem Inhalt und der Charakterisierung
des Propheten in dem Pamphlet Voltaires an vielen
Stellen nicht einverstanden ist.
Diderots geschliffene Sprache schätzt Goethe
schließlich so sehr, daß er Monate damit verbringt,
einige seiner Stücke zu übersetzen. Über ihn äußert
er: Diderot war nahe genug mit uns verwandt, wie
er denn in alledem, weshalb ihn die Franzosen ta-
deln, ein wahrer Deutscher ist.
Prof. Dr. Christoph Perels (Frankfurt)
Er hält sehr viel von Rousseau,ist jedoch
kein blinder Anbeter desselben
Goethes kritische Verehrung
für Rousseau, den Erzieher
Prof. Dr. Theo Buck (Aachen)
..seit meiner Jugend und während meines
ganzen Lebens habe ich von ihnen gelernt...
Goethes Verhältnis zu Moliere,
Voltaire und Diderot
158
Rousseau
Moliere
Voltaire
Diderot
Im November klärt uns
Manfred Osten über Goe-
thes Spinoza-Begeisterung
auf. Für ihn wird vor allem
Spinozas Ethik früh zur
Offenbarung der Gegenwelt
zur eigenen Ungeduld. Des-
sen große Gedanken zur
Identität von Dasein und
Vollkommenheit, die alle Revolten des Wollens be-
schwichtigen, hat Goethe bereits im Winter 1785
/86 in seiner Studie nach Spinoza zum künftigen
Credo seines Natur- und Kunstverständnisses erho-
ben. Spinozas pantheistische Gotteslehre gipfelt in
dem Satz: Alles, was ist, ist in Gott – mit der Schluß-
folgerung, daß sogar der angeblich freie Wille des
Menschen seine letzte Ursache in Gott hat.
Goethe entdeckt in Spinozas pantheistischer Gottes-
lehre die erlösende Gegenwelt, die sich dem über
eilenden Wollen seiner Zeit verweigert. Bei Spinoza
ist das Wollen völlig beruhigt und kehrt heim zu
Gott. In der Natur geschehe alles notwendigerweise
und in Vollkommenheit, da sie aus Gott hervorgehe,
der selber niemals einen Zweck verfolgen kann,
denn einen Zweck verfolgen hieße, einen Mangel
kompensieren zu wollen; dies würde aber – so der
Referent – der Definition der Vollkommenheit
widersprechen.
In Dichtung und Wahrheit rühmt Goethe Spinoza
mit den Worten: Die alles ausgleichende Ruhe Spi-
nozas kontrastierte mit meinem alles aufregenden
Streben (...) und (...) machte mich zu seinem
leidenschaftlichen Schüler, zu seinem entschieden-
sten Verehrer.
Im Dezember sind wir zu Gast im Winckelmann-
Institut der Humboldt-Universität, wo wir – auf
harten Stühlen, dafür umgeben von lauter antiken
Plastiken – den Ausführungen Volker Riedels
lauschen. Dieser sucht uns zu vermitteln, wie sehr
Goethe – zunächst als Student in Leipzig sowie vor
allem während der Monate in Rom – Winckel-
manns Bücher intensiv studiert habe.
1755 gibt Winckelmann seine erste Schrift in einer
Auflage von nur knapp 50 Exemplaren heraus:
Gedanken über die Nachahmung der Griechischen
Werke in der Malerei und Bildhauerkunst. Dieses
epochemachende Werk wird schnell sehr erfolg-
reich, sodaß er bereits 1756 eine zweite Auflage ver-
öffentlicht.
Für Winckelmann ist es die höchste Aufgabe der
Kunst, die Schönheit darzustellen. Hierfür findet er
die Formel edle Einfalt, stille Größe, welche er dem
Verspielten und Überladenen von Barock und Ro-
koko entgegenstellt.
Eine Besonderheit des Winckelmann’schen Klassi-
zismus liegt in der Bevorzugung des griechischen
Erbes gegenüber der lateinisch-römischen Antike.
Sein Bild der römischen und griechischen Antike
beeinflußt wesentlich den Geist des deutschen Klas-
sizismus; ganz besonders ist die Weimarer Klassik
um Goethe und Schiller ohne Winckelmann nicht
zu denken.
Auch in seiner zweiten Lebenshälfte vertieft sich
Goethe immer wieder in dessen Bücher und verfaßt
1805 die Schrift Winckelmann und sein Jahrhun-
dert, in der er dem eine Generation Älteren
bescheinigt: Er fühlte und kannte das Alterthum, so
wie das Würdige der Gegenwart, des Lebens und
des Charakters.
Die Alten, besonders die
Griechen in ihrer besten Zeit
– heißt es hier – hätten dank
einer gleichmäßigen Vereini-
gung aller menschlichen Ei-
genschaften das glückliche
Loos gehabt, das Einzige,
ganz Unerwartete zu leisten.
Während wir Neuen uns fast
bey jeder Betrachtung ins Unendliche werfen, fühl-
ten die Alten, ohne weitern Umweg, sogleich ihre
einzige Behaglichkeit innerhalb der lieblichen
Gränzen der schönen Welt.
Dr. Manfred.Osten (Bonn)
Notwendige Wahlverwandschaft
Goethes Spinoza-Begeisterung
Prof. Dr. Volker Riedel (Berlin)
Eine solche antike Natur war (...) in
Winckelmann wieder erschienen...
Goethes Blick auf die
»Jahrhundert-Gestalt« Winckelmann
159
Den Auftakt bildet im Januar der Einführungsvor-
trag von Detlev Lüders, dem langjährigen Leiter
des Frankfurter Goethehauses, überschrieben:
Goethes Aktualität. Er zählt noch zu den Referen-
ten einer Philologen-Generation, die druckreif
sprechen. Eine kurze Kostprobe seiner Ausfüh-
rungen: Wo sollen wir mit den Fragen nach Goe-
thes Aktualität beginnen? Sein Werk ist kaum zu
ermessen in seiner Weite und seiner Tiefe. Es ist
auf eine wohl beispiellose Weise vielseitig, man
ist versucht, von Einseitigkeit zu sprechen. Das-
selbe gilt für Goethes Existenz im Ganzen. Sie
umfasst, kaum begreiflich, viele Existenzen der
menschlichen Art. Der Dichter, der Zeichner, der
Kunst- und Literatur-Theoretiker, der Theaterdi-
rektor und Schauspieler, der Staatsmann und der
Naturwissenschaftler und zugleich mit alldem der
große Sammler, der Briefschreiber, der Reisende,
der Mensch, dem sein Werk eine tiefe Einsamkeit
auferlegt und der dennoch den größten Sinn hat
für eine ständige Hinwendung zur Welt und zu den
Menschen. (...) Auf fast allen Gebieten menschli-
cher Wirksamkeit, denen er sich zuwendet, kommt
Goethe zu Erkenntnissen von hoher Modernität.
Er ist seiner Zeit weit voraus, ja, aller Vermutung
nach, auch unserer Zeit. Aktualität in dem Sinne,
daß seine maßgebenden Einsichten zumindest auf
der Höhe auch noch heutiger Forschung sind, fin-
den wir überall bei ihm.
Im Februar legt uns Dieter Borchmeyer ein-
drucksvoll und wortmächtig dar, in welchem er-
staunlichen Umfang Goethe in den letzten beiden
Jahrzehnten seines Lebens sich für alle For-
schungsgebiete seiner Zeit interessierte, mit den
jeweiligen führenden Vertretern mündlich und
schriftlich in engem Verkehr stand, sich auf dem
Laufenden hielt über naturwissenschaftliche neu-
este Erkennntisse der Chemie, Physik, Anatomie
und Botanik; u.a. engen Kontakt mit den Gebrü-
dern Humboldt pflegte und sich – etwa als Abon-
nement der französischen Literaturzeitschrift
Zeitschrift Le Globe – nicht nur auf dem neuesten
Stand der literarischen und gesellschaftlichen
Debatten seiner Zeit befand, sondern sich selbst
daran mit zahlreichen Aufsätzen und Rezensionen
beteiligte und entscheidend dazu beitrug, daß man
in Deutschland begann, über den Tellerrand zu
blicken und sich mit den literarischen Werken aus
anderen Kulturen zu beschäftigen. Im Grunde –
so Borchmeyer – kann Goethe als Vater der Idee
Weltliteratur angesehen werden.
2011
Goethe lebt!
Zur Aktualität eines Autors im 21. Jahrhundert
Dr. Detlev Lüders (Frankfurt am Main)
...denn das Rechte zu ergreifen,
muß man aus dem Grunde leben…
Goethes Aktualität (Einführungsvortrag)
Prof. Dr. Dieter Borchmeyer (München)
Globalisierung und Weltliteratur
Goethes Altersfuturismus
160
Dr. Manfred Osten (Bonn)
der Mensch muß erst seine Organe belehren...
Goethe als Manager unserer Krisen
Prof. Dr. Wulf Segebrecht (Bamberg)
Von Gedichten, aus der Luft gegriffen,
halte ich nichts
Goethe in Gedichten der Gegenwart
Im März erwartet uns Manfred Osten mit einem
selbstredend wieder frei gehaltenen Referat unter
der Überschrift Goethe als Manager unserer Kri-
sen. Wie nicht anders zu erwarten: ein volles
Haus, ein begeistertes Auditorium angesichts sei-
ner dort vorgetragenen anschaulichen Schilderun-
gen, daß Goethe die heute übliche Geldschöpfung
ohne Wertschöpfung und das Schuldenmachen
ohne Deckung bereits u.a. der Kaiserpfalzszene
im Faust II bereits nahezu prophetisch geschildert
habe. Daraufhin der allgemein geäußert Wunsch,
daß man dies gerne nachlesen würde, etwa in
einer Jahresgabe.
Gesagt, getan: Sie erscheint unter dem Titel Die
kühnsten Kletterer sind konfus. Im Folgenden ein
kurzer Auszug:
Die Faust-Tragödie ist nichts Geringeres als eine
frühe metaphorische Spiegelung der vor allem
monetär bestimmten anthropologischen Krisen
unserer Zeit. Gespiegelt sind hier freilich nicht nur
unsere Krisen; vielmehr wird durch deren Folie
noch ein anderer Text sichtbar in Gestalt lakoni-
scher Hinweise einer möglichen Therapie dieser
Krisen.
Wie aber hat Goethe diese Krisen und deren the-
rapeutischen Subtext im zweiten Teil des Faust
gespiegelt? Wir betreten im 1. Akt den Hof des
Kaisers. Es herrscht hier die Situation westlicher
Industrienationen: grenzenloser Egoismus und
Ratlosigkeit, gepaart mit den Phänomenen des
drohenden Staatsbankrotts. Der Kaiser muß er-
kennen: Subsidien bleiben aus, ein jeder kratzt
und scharrt und sammelt und unsere Kassen blei-
ben leer. Es droht die Erosion der Existenzbe-
rechtigung des Staates. Das kaiserliche Reich
präsentiert sich mit seinen ratlosen Funktionseli-
ten schon damals als moderner Sanierungsfall.
Wegen Überschuldung ist das Staatswesen nicht
mehr in der Lage, die Daseinsvorsorge zu leisten,
die ihm bei seinen Bürgern Legitimation und Au-
torität verschafft. (…) Auf dem Höhepunkt der
Staatskrise dient sich Faust als Consultant und
Haushaltsexperte an. Mit dem Trick ungedeckter
Schuldverschreibungen empfiehlt er rasche gren-
zenlose Geldvermehrung zur Aufrechterhaltung
des Staates und des Wohlwollens seiner Bürger
als Subventionsempfänger. Der Staatsbankrott
schreitet auch hier bereits voran mit der parado-
xen Formel: Wir wollen alle Tage sparen, und
brauchen alle Tage mehr. (Die Broschüre ist ver-
griffen, aber als Digitalisat vorhanden)
Im April erwarten uns Wulf Segebrechts Ausfüh-
rungen über Goethe in Gedichten der Gegenwart,
die er mit zahlreichen Beispielen würzt. Ursprüng-
lich hatte ich erwartet, er werde mit seinen Darle-
gungen verdeutlichen, inwieweit Goethe-Sprache
und die Eigentümlichkeit und Originalität seiner
Wortbilder Niederschlag in das lyrische Werk nach-
geborener Dichter-Generationen gefunden habe;
dies erweist sich als Irrtum. Zu konstatieren bleibt
aber unter dem Strich, daß es – neben den zahlrei-
chen bekannten Parodien, insbesondere des Erlkö-
nig und Wanderers Nachtlied – bei vielen Epigonen
meist nur zu sprachlichen Lyrik-Verballhornungen
gereicht hat. Dies legt der Referent überzeugend dar
und dem Auditorium bleibt die Erkenntnis, daß es
– vor allem im 20. Jahrhundert – doch nicht so viele
waren, die Goethe in punkto Lyrik das Wasser rei-
chen konnten.
161
Eine ganz andere Art von Vortrag, eher eine
Vorlesung, erwartet uns im Mai von unserem
Mitglied Ekkehart Krippendorff, der erneut
Goethes Tätigkeit als Geheimer Rat und späterer
Staatsminister sowie seine diesbezüglichen Äu-
ßerungen und Handlungen auf ihre Anwendbar-
keit für heutige politische Konstellationen
abklopft.
Dort wo Manfred Osten sein
unerschöpfliches Reservoir an
Zitaten gleichsam aus dem
Ärmel schüttelt, holt Ekkehart
Krippendorff dafür mit Merk-
zetteln versehene Bücher aus
dem mitgebrachten Rucksack.
Diese Spontanität ist immer
wieder erfrischend und ver-
mittelt dem Zuhörer den
Eindruck, als hätte er die
zitierte Goetheäußerung, die seine Ausführung
belegt, gerade am Vorabend entdeckt. Dieses
Goethe immer wieder neu entdecken ist ja Krip-
pendorffs Spezialität und sollte auch die Maxime
bleiben, von der wir uns weiterhin leiten lassen.
Unter dem Titel: »Goethes progressive Haltung
zu Liebe, Ehe und Familie am Beispiel seines
Dramas Stella« spannt Hans-Hellmut Allers im
September einen ausführlichen biografischen
Bogen von der ersten Liebe des 14-jährigen Goe-
the zu dem 16-jährigen Gretchen bis zur 17-jäh-
rigen Ulrike von Levetzow, die der 74-Jährige
sechs Jahrzehnte später ernsthaft zur Braut be-
gehrt. Vor allem widmet er sich jedoch Goethes
Jugenddrama Stella, in dem sich der Protagonist
Fernando nicht zwischen zwei Frauen entschei-
den kann, sondern doch eigentlich immer beide
benötigt: Die mütterlich Verstehende und die ju-
gendliche Geliebte; einer der wenigen Fälle, in
der Goethe sich ausnahmsweise der herrschenden
Konvention beugen und umschreiben muß.
Ansonsten bleibt seine Liebeslyrik auch im 21.
Jahrhundert für uns Heutige so aktuell, wie sie es
zu allen Zeiten war.
Mit ihrem Vortrag Zur Aktualität von Goethes
Wahlverwandtschaften greift sich die Literatur-
wissenschaftlerin und ZEIT-Journalistin Elisa-
beth von Thadden im Oktober einen völlig
neuen Aspekt dieses Romans des reifen Goethe
heraus. Wie die meisten von uns bisher meinten,
handeln die Wahlverwandtschaften von den The-
men Ehe und Beziehungen unter besonderer Be-
rücksichtigung des Fremdgehens.
Dies, so die Referentin, stelle lediglich die Rah-
menhandlung dar; in Wahrheit gehe es in Goethes
Roman um Übereilung, Mode und Verdrängung
der Gegenwart als Symptome eines verfehlten
Zeitbewußtseins.
Ihre Interpretation bietet bei der sich anschließen-
den Debatte und den folgenden Gesprächen beim
Wein naturgemäß viel Diskussionsstoff.
Prof. Dr. Ekkehart Krippendorff (Berlin)
Welche Regierung die beste sei?
Diejenige, die uns lehrt, uns selbst zu regieren
Die Entdeckung des politischen Goethe
Hans-Hellmut Allers (Berlin)
Nimm ihn ganz, jeder soll ihn haben!
Goethes vormoderne Haltung zu Liebe, Ehe
und Familie u.a. am Beispiel seines Dramas Stella
Dr. Elisabeth von Thadden (Hamburg)
Lässt sich die Zeit ihr Recht nicht nehmen...
Zur Aktualität von Goethes Wahlverwandtschaften
162
Am 27. März 1784 entdeckt Goethe den mensch-
lichen Zwischenkieferknochen und schreibt noch
am gleichen Tag an Herder: Ich habe gefunden
weder Gold noch Silber, aber (...) das os interma-
xillare beim Menschen. Nun bitt‘ ich Dich, laß
dich nichts merken, denn es muß geheim behan-
delt werden.
Im November veranschaulicht Volker Hesse uns
erneut die aktuelle Bedeutung von Goethes natur-
wissenschaftlichen Forschungen. Gleichviel, ob
es sich um seine Begeisterung handelt beim Er-
kennen der Existenz des Zwischenkieferknochens
oder um sein lebenslanges Studium physikali-
scher, chemischer, anatomischer, biologischer,
morphologischer und anderer naturwissenschaft-
licher Zusammenhänge.
Bei all jenen unter den Zuhörern, die sich in der
Regel in erster Linie mit Goethes literarischem
Werk beschäftigen, löst die Reichhaltigkeit des
Goethe’schen Geisteskosmos und die Intensität
der Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen
Phänomenen immer wieder ungläubiges Erstau-
nen aus.
Zum Jahresende stellt Michael Jaeger die Ergeb-
nisse seiner umfangreichen, 600 Seiten starken
Habilitationsschrift Fausts Kolonie vor. Die 2005
erschienene Studie zeigt Faust nicht wie in der
bisherigen bejahenden Wirkungsgeschichte der
Goethe’schen Tragödie als prometheischen Men-
schen, dessen immerwährendes strebendes Be-
mühen bislang als höchste Tugend des sich
emanzipierenden Menschen angesehen wurde:
vorwärtsgerichtet in seinem unstillbaren Wissens-
durst, tatkräftig, leidenschaftlich und selbstbe-
wußt trotz aller melancholischen Zweifel,
vorbildlich in seinem rastlosen Drang nach Ver-
vollkommnung, auch wenn er selbst und andere
darunter zu leiden haben. Eine zwar tragische,
also mit Schuld behaftete Figur, aber eben doch
ein Held, mit dem man sich identifizieren kann.
Nach Jaegers Lesart ist Goethes Protagonist nun
das genaue Gegenteil von alledem; er interpretiert
Faust als wandelnde Negation aller Goethe’schen
Zivilisationsideale. Der nervöse Gelehrte und
spätere Kolonisator setzt sich schließlich über alle
Regeln klassischer Lebenskunst und Mäßigung
hinweg. Seine rücksichtslosen Kolonisierungs-
pläne ignorieren alles Bewährte und Gewachsene
und bewirken die Unterwerfung von Natur und
tradierter Kultur.
Goethe habe – so Jaeger – in die Faustfigur alles
gesteckt, was ihm am veloziferischen Unwesen
der Moderne nicht geheuer war – dieser sei des-
halb in seiner nervösen Getriebenheit mitnichten
eine Identifikationsfigur, vielmehr stelle er einen
abschreckenden gewaltbereiten Charakter dar in
einer Zeit, in der Goethe voller Unbehagen die
fortschreitende Industrialisierung und das Herauf-
kommen der französischen Saint-Simonisten und
deren Menschheitsbeglückungs-Phantasien ver-
folgte. Das Auditorium ist beeindruckt und so
manch einer beschließt, daheim endlich mal wie-
der den Faust II zur Hand zu nehmen, um ein
wenig von dem nachvollziehen zu können, was
man da gerade gehört hat.
Prof. Dr Volker Hesse (Berlin)
Goethes naturwissenschaftliche Forschungen und
ihre aktuelle Bedeutung
PD Dr. Michael Jaeger (Berlin)
Fausts Weltkolonisation – Zur Aktualität Goethes
163
Das Thema, auf das wir uns einlassen wollen – die
Sprache Goethes, ihr Reichtum und ihre Spezifik,
ihre bis in die Gegenwart wirksame Produktivität
und Lebendigkeit – dieses Thema ist, wie man sich
denken kann, kein triviales.
Inzwischen ist im Zusammenhang mit der Erarbei-
tung des Goethe-Wörterbuchs klar geworden, daß
Goethe mehr als 90.000 verschiedene Wörter be-
nutzt hat – die weltweit größte bisher bekannte
Wortanzahl eines einzelnen Autors! Schon die jün-
geren literarischen Zeitgenossen, allen voran die
Romantiker, wußten Reichtum und Qualität der
Goetheschen Sprache hoch zu schätzen.
Von besonderem Gewicht sind die Urteile der Brü-
der Grimm, die als Begründer und Vertreter einer
historisch ausgerichteten Sprach- und Literaturfor-
schung zugleich auch Teilhaber und kritische Be-
obachter ihrer Zeitsprache waren. Jacob Grimm
schreibt 1835: Seine ganze Poesie quillt unmittelbar
aus der Natur hervor (...). Auf unsre Sprache hat er
unberechenbaren Einfluß geübt; er hat viel neue
Wörter nicht erfunden, nur entdeckt.
Und in seiner Rede auf Schiller 1859 spricht Jacob
Grimm geradezu von einem mustergültigen canon,
zu dem sich Goethes Prosa entwickelt habe, und
seine Poesie gebe überall die reinste Ausbeute.
Versuchen wir einen näheren Eindruck von der Phy-
siognomie der Goethe-Sprache zu erhalten. Dazu
verweise ich auf eine Präsentation des Unterneh-
mens Goethe-Wörterbuch, bei der wir auf soge-
nannten Wortbannern die in langen alphabetischen
Wortketten selektiv und typographisch verschiede-
nen Auszüge des Goetheschen Wortschatzes zwi-
schen Aalschlachten und zypresseragend
veranschaulichten.
Auf den ersten Blick sieht der Betrachter Einfach-
wörter und Zusammensetzungen/Ableitungen; hei-
mische Wörter und Fremdwörter; Wörter mit
speziellen Stilmerkmalen, sachlich-beschreibende
und emotional-wertende Bezeichnungen, Gehobe-
nes, Poetisches, Saloppes, Scherzhaft-Ironisches,
Polemisches, Grobes, Deftiges u. a.; Wörter aus
Fach- und Sondersprachen sowie literarische
Namenssetzungen. Jedes Wort mit einem Hof von
Assoziationen und in einem Feld verschiedener syn-
tagmatischer Partnerbeziehungen.
Ein sehr großer Teil dieser Wörter, nämlich nahezu
zwei Drittel, kommt in der ganzen Goethe’schen
Schriftenmasse nur ein- bis dreimal vor; namentlich
als Ausdrucksformen genauer, einprägsamer Sach-
beschreibung wie bildhaft-poetischer Weltaneig-
nung. Im Folgenden einige charakteristische
Beispielgruppen aus verschiedenen Bereichen, etwa
präzise Charakterisierungen aus vorwiegend wis-
senschaftlichem Zusammenhang: geblättert, ge-
buckelt, gefingert, gefranst, gerieft, gerippt,
geschnäbelt, gezähnelt;
Poetische Bildungen wie Glanzfest, Glanzfeuer,
Glanzgewimmel; Geisterflut, Geisterfülle, Gei-
sterduft, Geistertiefe – man beachte die Assoziati-
onsvielfalt schon bei bloßer Nennung des einzelnen
Wortes –; daneben komplexere Bildungen wie Flü-
gelflatterschlagen, Knabenmorgenblütentraum,
Fremdlingsreisetritt, Brandschandemalgeburt; fer-
ner – ganz andere Bezirke – Fachwörter aus der
handwerklich-technischen Sphäre: Gipsformen,
Glasbrennen, Goldputzen; Glasfritte, Glättstein,
Glockenspeise; Rechts- und Verwaltungstermini
wie Freibauer, Ganerbschaft, Gewährschein, Ge-
leitsrevenue, Giltbrief.
An dieser Stelle wird deutlich, daß das Goethesche
Sprachwerk zwar stark, doch keineswegs aus-
schließlich aus der Welt der Dichtung lebt. Es of-
fenbart sich vielmehr in unterschiedlichsten
Anwendungsbereichen: im privaten, ungezwunge-
nen Alltag, in der Sphäre von Wissenschaft und Kri-
tik, im Geschäfts- und Amtsbereich. Goethes
Sprache ist damit nicht nur Dichtungssprache, son-
dern entfaltet sich als ein vielgestaltiges Ensemble
von Ausdrucksmitteln und Erscheinungsformen:
vom persönlich gefärbten Alltagsausdruck bis zum
strengen Duktus wissenschaftlicher Sprache, vom
konventionell geprägten Amts- und Kurialstil bis
zur in sich vielfach geschichteten schöpferischen
Poesiesprache. Ein Miteinander verschiedenster
Sprachvarietäten, Funktional- und Gattungsstilen
bzw. Textsorten.
Um diesen Reichtum wenigstens andeutend zu ver-
anschaulichen, greife ich zu Textbeispielen aus der
Werther-Zeit, in der eine erstaunliche literarische
Produktivität zutage tritt. Der Roman Die Leiden
des jungen Werthers von 1774 gilt als ein Muster
empfindsamer, teils natürlich-redesprachlicher, teils
auch leidenschaftlicher, an Höhepunkten rhyth-
misch gesteigerter Sprache. In ihm kommt aus-
drücklich auch der Gestaltungswille des Titelhelden
selbst zu Wort, wenn er sich über die stilistische
Pedanterie des Gesandten, seines zeitweiligen
Dienstherrn, beklagt: Ich arbeite gern leicht weg,
und wie’s steht so steht’s, da ist er im Stande, mir
einen Aufsaz zurükzugeben und zu sagen: er ist gut,
Dr. Josef Mattausch (Leipzig)
Reichtum und Maßstab
Vom Leben der Goethe-Sprache
164
aber sehen sie ihn durch, man findt immer ein bes-
ser Wort, eine reinere Partikel. Da möcht ich des
Teufels werden. Kein Und, kein Bindwörtchen sonst
darf aussenbleiben, und von allen Inversionen die
mir manchmal entfahren, ist er ein Todtfeind. Wenn
man seinen Period nicht nach der hergebrachten
Melodie heraborgelt; so versteht er gar nichts
drinne.
Anders die Diktion des zwei Monate nach dem
Werther entstandenen Trauerspiels Clavigo: treff-
sichere, pointierte Dialogreden, die an Lessing
erinnern, an dramatischen Umschlagpunkten
leidenschaftlich-kraftgenialische Ausbrüche.
Ebenfalls aus dem Frühjahr 1774 stammen die bur-
lesk-volkstümlichen Knittelverse des Eposfrag-
ments Der ewige Jude: Um Mitternacht wohl fang
ich an / Spring aus dem Bette wie ein Toller; / (...)
Und ich – mir fehlt zu Nacht der Kiel / Ergreiff wohl
einen Besenstiel«
Von Lyrik fällt in die Werther-Zeit u. a. die frei-
rhythmische religiös-hochgestimmte Hymne
Ganymed: »Wie im Morgenroth du rings mich / An-
glühst, Frühling Geliebter! ...«
Wenig später die volkstümlich-bänkelsängerische
Ballade »Es war ein Buhle frech genung, / War erst
aus Frankreich kommen, / Der hat ein armes Maidel
jung / Gar offt in Arm genommen; / Und liebgekoßt
und liebgeherzt; / Als Bräutigam herumgescherzt; /
Und endlich sie verlaßen.«
Die Briefe, in der alten Weimarer Ausgabe allein 50
Bände umfassend, sind es, die neben der Dichtung
das reichste Material zu unserem Thema bieten.
Unter ihnen vor allem die spontanen, aus dem Au-
genblick geborenen, oft flüchtig hingeworfenen Ge-
fühlsergüsse.
Als Goethe 1776 wieder, nun schon aus Weimar,
nach Leipzig kommt, entlädt sich seine inzwischen
gewonnene kritische Distanz in einer Kaskade
geist- und spottsprühender Expressivbildungen mit
Anleihen auch aus dem Umgangssprachlichen und
Dialektalen: da bin ich nun. in Leipzig, ist mir son-
derlich worden beym Nähern ... und kann nicht
genug sagen wie sich mein Erdgeruch und Erdgefühl
gegen die schwarz, grau, steifröckigen, krumbeini-
gen, Perrückengeklebten, Degenschwänzlichen,
gegen die Feyertags berockte, Allmodische,
schlanckliche, vieldünckliche Studenten Buben,
gegen die Zuckende, krinsende, schnäbelnde, und
schwumelende Mägdlein, und gegen die Hurenhaffte,
strozzliche, schwänzliche und finzliche Junge Mägde
ausnimmt, welcher Greuel mir alle heut um die Tho-
ren als an Marien Tags Feste entgegnet sind.
(An Herzog Carl August am 25. März. 1776)
Ich werfe einen Blick noch auf ein wenig beachtetes
Gebiet: auf das Feld der poetischen Namen. Goethe
wußte um die Bedeutung der Namen und setzte sie
mit Bedacht. Nach Hochrechnungen am Goethe-
Wörterbuch ist bei Goethe mit gut 1000 literari-
schen Figurennamen zu rechnen.
Ein erheblicher Teil von ihnen ist aus Geschichte,
Mythos und Literatur übernommen. Den Kern-
bereich produktiver Namengebung bilden jedoch
diejenigen Benennungen, für die sich solche Bezug-
nahmen auf vorgegebene Personen oder Figuren
nicht nachweisen lassen. Ob eigene Namenbildung
des Autors oder Nutzung vorgefundener Namen –
stets handelt es sich um bewußte, willentliche Set-
zungen.
Beispiele: Klassifizierende Namen ordnen die be-
nannten Figuren bestimmten Gruppen oder Berei-
chen zu; einer bestimmten sozialen Schicht
(Annchen, Anne, Bärbel, Bärb(el)chen für Mädchen
niederen Standes und Dorfweiber, Agathe (‚die
Gute‘) als Rufname für ein ehrbares Bürgermäd-
chen); oder der Konvention einer bestimmten lite-
rarischen Strömung (Chloris, Climene, Damon,
Egle als Namen für Angehörige der empfindsam-
anakreontischen Welt).
Eine weitere Gruppe bilden Namenformen, die
klanglich-ästhetisch motiviert sind, wohlklingende,
euphonische Namen (Almidoro, Balandrino, Al-
maide, Almeria) und andererseits komische Spott-
und Schimpfnamen (Schwerdtlein, Spritzbierlein);
gehäuft im Katalog derb-satirischer Namen in der
Farce Hanswursts Hochzeit, Ausdruck kritischen
Unbehagens an der wohlanständigen Frankfurter
Bürgerwelt: Saufaus, Vollzapf, Matzfotz von
Dresden, Quirinus Schweinigel, Reckärschgen,
Schnuckfözgen, Schnudelbutz, Dr. Bonefurz usw..
Fülle und Vieldimensionalität dieser Sprache sind
nun freilich das Ergebnis eines mehr als 65-jährigen
Autorlebens. Sie entfalten sich in einem histori-
165
schen Ablauf, in mehreren Entwicklungsstufen,
dem wir hier in einem zweiten Schritt nachzugehen
haben.
Der Frankfurter Knabe wuchs auf in einem alter-
tümlich-regional gefärbten Sprachmilieu. In der
Leipziger Studentenzeit nahm er den fortgeschrit-
tenen Sprachstandard seiner Zeit auf, nämlich die
in den kursächsischen Städten und besonders auch
in der Aufklärungsmetropole Leipzig ausgebildete
Literatur- und Gesellschaftssprache.
Eine rigoros neue Stufe markiert dann die Sprach-
gebung der Geniezeit, die vom jungen Goethe nun
aktiv mitbestimmt wird: radikale Öffnung und Be-
reicherung durch volkssprachliche Ausdrucksmittel,
sehr eigenständige Wortbildungen und freie syntak-
tische Strukturen. Es dominiert ein ursprüngliches,
ungebrochenes Sprachgefühl, das der eignenen
Schöpferkraft und der Kraft des Wortes vertraut.
Es wächst aber auch Kritik an der Sprache. Ein zeit-
weilig heftiger Zweifel am Deutschen in seiner
Tauglichkeit als Poesiesprache tut sich kund in dem
bekannten Diktum: verderb’ ich unglücklicher
Dichter / In dem schlechtesten Stoff leider nun
Leben und Kunst. (Venezianische Epigramme).
Mehr noch, allgemeine Sprachskepsis tritt hervor:
Die Worte sind gut, sie sind aber nicht das Beste.
Das Beste wird nicht deutlich durch Worte, so
verkündet Wilhelm Meisters Lehrbrief.
Zwar sieht und anerkennt der spätere Goethe die zu
seinen Lebzeiten erreichte vielseitige Ausdrucksfä-
higkeit des Deutschen, die es zumal zur Überset-
zungssprache und damit zur Mittlerinstanz in
seinem Konzept der Weltliteratur tauglich macht.
Gleichzeitig aber wahrt er gegenüber bestimmten
Entwicklungstendenzen in der Literatursprache zu-
nehmend kritische Distanz.
Schon im Schema über den Dilettantismus von
1799 ist die Rede von zusammengeplünderten
Phrasen und Formeln, die nichts mehr sagen, und
ganzen Büchern, die schön stilisiert sind und gar
nichts enthalten.
Gegen die semantisch entleerte, flächige Konventi-
onssprache der Zeit steht nun sein ausgeprägt indi-
vidueller, einzigartiger Altersstil, der sich aller
Ausdrucksregister bedient und in souveräner Frei-
heit Verschiedenstes verbindet: Persönlichstes und
Allgemeinstes. Hochpoetisches und Formelhaft-
Stereotypes, Vertrautes und Fremd-Befremdliches.
Als wesentliches Merkmal tritt hinzu: Die in der
klassischen Periode geübte Sicht auf das Gesetzli-
che, Allgemeingültige gewinnt zunehmend eine
neue Dimenson. Für die Altersweltanschauung wer-
den die Phänomene zu bedeutungsvollen Symbolen,
deuten zugleich auf ein Eigentliches, Höheres, Wah-
res (wie Goethe sich ausdrückt).
Entsprechend gewinnt die Poesiesprache an eigen-
tümlichem Mehrwert. Einerseits bleibt sie als bild-
haft-anschauliche Ausdrucksform nahe beim
Gegenstand, andererseits verweist sie beziehungs-
reich-symbolisch über ihn hinaus. Im Divan-Ge-
dicht Wink hat Goethe diese Doppelfunktion des
dichterischen Wortes im Bild des Fächers veran-
schaulicht:
... daß ein Wort nicht einfach gelte,
Das müßte sich wohl von selbst verstehn.
Das Wort ist ein Fächer! Zwischen den Stäben
Blicken ein Paar schöne Augen hervor.
Der Fächer ist nur ein lieblicher Flor,
Er verdeckt mir zwar das Gesicht;
Aber das Mädchen verdeckt er mir nicht,
Weil das Schönste was sie besitzt,
Das Auge, mir in’s Auge blitzt.
Angesichts dieses bewegten Erscheinungsbildes der
Goethe-Sprache mit ihren vielfältigen Entwick-
lungsstufen stellt sich die nach dem Bleibendem in
seinem Sprachwerk. Gibt es Merkmale, die das Bild
dieser Sprache durchgehend prägen? Die Antwort
muß anknüpfen an die vorhin zitierten sprach-
166
kritischen Äußerungen. Goethe hat, seitdem er über
Sprache zu reflektieren begonnen hatte, immer
wieder Anstoß genommen an Vagheit und Phrasen-
haftigkeit, an sprachlicher Fahrlässigkeit überhaupt.
Bekenntnishaft drückt sich das aus anläßlich der
Übersetzungsnöte beim Lebensbericht des Renais-
sancekünstlers Benvenuto Cellini: Da ich mich in
meinem Leben vor nichts so sehr als vor leeren
Worten gehütet, und mir eine Phrase, wobei nichts
gedacht oder empfunden war, an andern unerträg-
lich, an mir unmöglich schien, so litt ich bei der
Übersetzung des Cellini, wozu durchaus unmittel-
bare Ansicht gefordert wird, wirklich Pein.
Kennzeichnend an Goethes Sprachpraxis ist ein
genauer, bedachtsamer sach- und situationsgerech-
ter, auch partnerbezogener Sprachgebrauch. Das
Bemühen um adäquate Ausdrucksweise spiegelt
sich in der Grundsatzaussage: Wir haben das unab-
weisliche, täglich zu erneuernde, grundernstliche
Bestreben, das Wort mit dem Empfundenen,
Geschauten, Gedachten, Erfahrenen, Imaginirten,
Vernünftigen möglichst unmittelbar zusammen-
treffend zu erfassen.
Über den Wert eines Wortes entscheidet sein Gehalt,
seine Treffgenauigkeit, nicht aber seine Herkunft.
Goethe ist ein erklärter Gegner einseitig puristischer
Sprachreinigungs-Bestrebungen: Ich verfluche allen
negativen Purismus, daß man ein Wort nicht brau-
chen soll, in welchem eine andere Sprache Vieles
oder Zarteres gefaßt hat. Für teutschtümelnde
Fremdworthatz ließ er sich – wie auf anderen Ge-
bieten auch – nicht vereinnahmen.
Vielmehr erscheinen als charakteristische Merk-
male seiner Texte Klarheit, bildhafte Anschaulich-
keit, Angemessenheit, eine aus dem Innern flie-
ßende Natürlichkeit, von der auch die maßvolle Me-
taphorik bestimmt ist, die oftmals zu eigentümlicher
Prägnanz gesteigert wird. Goethe erweist sich
immer wieder als der Neue, Überraschende, Pro-
duktive, bei dem auch kleinere Werke und Neben-
arbeiten sozusagen nicht auf Serie gearbeitet sind,
sondern jeder Text einen eigenen Ansatz bildet und
seinen eigenen Stil besitzt.
Diese beständige Produktivität, die aus der Tradi-
tion schöpfend zu immer neuen Aus- und Weiterge-
staltungen führt, hat zur Folge, daß sich Goethes
Sprache der einfachen Verfügbarkeit entzieht.
Trifft die auf Grimm zurückgehende alte These der
Sprachhistoriker wirklich zu, die sogenannte »Klas-
sikersprache« habe die allgemeine Hoch- und Stan-
dardsprache der Folgezeit maßgeblich bestimmt?
Die heutige Hochsprache also im Gefolge der lite-
rarischen Klassiker?
Man muß hier sehr vorsichtig sein. Bereits in der
Goethezeit breiten sich literarische Konkurrenzfor-
men aus, die die Reichweite der Klassikerliteratur
einschränken, etwa das epigonale Schrifttum, das
bereits Goethe kritisch im Blick hatte; vor allem
aber die grassierende bürgerliche Unterhaltungsli-
teratur, die nurmehr der Befriedigung oberflächli-
cher Konsumbedürfnisse dient.
Revolutionäre und kriegerische Zeitläufte wecken
zudem das Interesse breiter Schichten an aktueller
Berichterstattung und befördern in Schüben das
Umsichgreifen eines neuen Mediums: der Presse.
Eine Gattung, die von Goethe ebenfalls mit kriti-
schem Vorbehalt betrachtet wurde: die Tages-,
Wochen- und Monatsblätter hätten die böse Art, daß
sie sehr oft die höchsten Worte, mit denen nur das
Beste bezeichnet werden sollte, als Phrasen anwen-
den, um das Mittelmäßige oder wohl gar Geringe
zu maskiren.
(an Boisserée am 26. Juni 1811)
.
In den Vordergrund treten jetzt die Ausdrucks-
formen des politischen Zeitalters mit seinem
modernen operativen Stil, der Schönheit und
Freiheit zu vermitteln trachtet. Zunehmende über-
lokale Kommunikation und aufkommende Indu-
strialisierung lassen zudem die Bedeutung von
Umgangssprache und Fachsprache stark an-
wachsen.
In diesem neuentstandenen Kräftefeld bildet die
überkommene Literatursprache, und damit auch die
Sprachleistung Goethes, nurmehr einen Teilstrom,
dennoch in ihren Wirkungen deutlich wahr-
nehmbar: aus ihrem Reichtum unmittelbar und
kraftvoll spendend, zugleich aber auch – vielfältig
vermittelt (durch Schule und Bildungstradition,
durch epigonales und unterhaltendes Schrifttum) –
sich modifizierend, abflachend und verbrauchend.
Ihre latent vorhandenen Fermente sind auch für uns
Heutige aufrufbar und in lebendigen Begegnungen
mit den großen Literaturwerken der Vergangenheit
fruchtbar zu halten. Selbst als reines Sprachwerk
bleibt die Goethesche Hinterlassenschaft auch in
der Gegenwart ein unerschöpfliches Reservoir:
Bereicherung, Anregung, produktive Herausforde-
rung; Beispiel zugleich für den bewußten,
verantwortlichen Umgang mit dem kostbaren
Kulturgut Sprache. Sich auf dieses Erbe ein-
zulassen, gewährt stets aufs neue Gewinn und
Genuß!
(Auszug aus Josef Mattauschs Vortrag)
167
2012
Goethes Weltsicht und ihre Aktualität
Prof. Theo Buck (Aachen)
Daß dein Leben Gestalt, dein Gedanke Leben gewinnt,
Laß die belebende Kraft stets auch die bildende sein...
Goethe heute
Dr. Manfred Osten (Bonn) und
Dr. Sahra Wagenknecht (Berlin)
Podiumsgespräch
Über den Eigentumsbegriff bei Goethe
Den Auftakt macht im Januar Theo Buck mit sei-
nem Vortrag Goethe heute; er hatte bereits Ende
2010 den Finger gehoben, als ich erwähnte, wir
beabsichtigten, dem Goethe lebt!-Programm noch
ein weiteres folgen zu lassen. Seine wie immer
anschaulichen Darlegungen kreisen um sechs
Schwerpunkte in Goethes Denken und Handeln,
die ihm im Laufe seiner 82 Lebensjahre zur Ma-
xime geworden waren: Wechselbeziehung Ma-
krokosmos/Mikrokosmos; die Ablehnung allen
dogmatischen Denkens; Ablehnung der Eile; Er-
kenntnis der produktiven Entsagung; Vorbild der
Kunst; Notwendigkeit gesellschaftlicher Interak-
tion; Goethe als Weltbürger.
Im März folgt dann – vor ausgebuchtem Saal –
die Podiumsdiskussion mit Sahra Wagenknecht
und Manfred Osten unter dem Titel Faust – ein
Frühkapitalist? Hatte ich zuvor einige Skepsis
aus dem Kreis der Mitglieder vernommen, warum
wir denn zum Eigentumsbegriff bei Goethe diese
Kommunistin einladen müssten,
so waren die Reaktionen im Anschluß an Frau
Wagenknechts Ausführungen, die bei Goethe
durchaus sattelfest erscheint, überwiegend zu-
stimmend. Allerdings gelingt es ihr immer wieder
mühelos, das Gespräch in die Gegenwart zu be-
fördern und ihre Positionen hinsichtlich sozialer
Gerechtigkeit, Forderungen nach Mindestlohn
und Besteuerung von Großverdienern zu verdeut-
lichen. Manfred Osten hat durchaus Mühe, das
Gespräch immer wieder zu den Themen Goethe
und Faust II zu lenken.
168
„Wir wollen alle Tage sparen und
brauchen alle Tage mehr. Und täglich
wächst mir neue Pein.“ Der so klagt,
ist nicht der griechische
Finanzminister, sondern der von ähn-
lichen Finanznöten gebeutelte Mar-
schalk am Hofe des Kaisers in
Goethes Faust II. Die Szene spielt in
der Kaiserpfalz, in einer sich auflösenden, zutiefst kor-
rupten Gesellschaft, in der Kultur und Ethik jede Bin-
dungswirkung verloren haben, eine enthemmte
Oberschicht das Gemeinwesen ausplündert und sich
schamlos bereichert, während die Politik ihre Gestal-
tungsmacht eingebüßt hat. Jeder sucht seinen Vorteil,
jeder kämpft gegen jeden, es wird betrogen und gelogen,
was das Zeug hält. Verhältnisse also, die uns nur allzu be-
kannt vorkommen.
Schluss mit Mephistos Umverteilung!
Die Finanzkrise, von neoliberaler Politik verschul-
det, greift vor allem den Mittelstand an- und damit
die Demokratie. Aber noch ist es nicht zu spät.
08.12.2011, von SAHRA WAGENKNECHT
Im April referiert dann Bernhard Bueb, der Lei-
ter des berühmten Internats Salem in Überlingen:
Was die deutsche Schule von Goethe lernen
sollte. Sein Fazit: Die heutige Schule sei hierzu-
lande immer noch eine Belehrungsinstitution, in
der trockene Wissensinhalte vermittelt würden.
Statt kognitiv messbarer Leistungen müsste viel
größerer Wert auf Charakterbildung und den Er-
werb sozialer Kompetenz gelegt werden, die
vielfach nur in Gruppenerlebnissen und durch
eigene Erlebnisse und Erfahrungen vermittelbar
seien. Immer wieder streute der Referent pas-
sende Zitate Goethes ein, nicht zuletzt das viel
zitierte: Wer nicht geschunden wird, wird nicht
erzogen. Viele Zuhörer im Auditorium sah man
häufig zustimmend nicken zu den Ausführungen
des Referenten, handelt es sich beim Thema Bil-
dung um ein Thema stetiger Aktualität und Bri-
sanz. Im Anschluss beim Glas Wein gab es an
den Tischen jedoch durchaus kontroverse Debat-
ten, denn nach wie vor zählt die Goethe-Gesell-
schaft Berlin immer noch eine erhebliche Anzahl
von Pädagogen und einstigen Lehrern zu ihren
Mitgliedern.
Im Juni dann erwarten wir einen prominenten
Gast: Den Züricher Schriftsteller Adolf Muschg.
Dieser soll eigentlich – so ist es wenigstens
vereinbart – über Goethes Verhältnis zur Natur
sprechen. Uns ging es in erster Linie um den
grünen Goethe, um dessen respektvollen und
achtsamen Umgang mit Naturphänomenen; eine
Haltung, die nicht nur für seine Zeit, sondern
auch in späteren Jahrhunderten eher ungewöhn-
lich war. Bereits der vom Referenten genannte
Titel Goethes Natur als Beziehungsfähigkeit läßt
allerdings daran zweifeln, ob Adolf Muschg das-
selbe meint.
In einer Art Prolog geht er zwar auf Goethes be-
sonders ausgeprägte Sensibilität hinsichtlich der
Natur ein, die sein ganzes Werk, insbesondere die
Lyrik durchzieht. Doch nach etwa 20 Minuten
beschließt der Vortragende, daß er nun noch ein
Kapitel aus seinem neuen, bis dato nicht veröf-
fentlichten Buch Löwenstern vorlesen wolle, was
im Auditorium für leichte Verblüffung sorgt.
Es handelt von dem
Besuch des jungen
Balten Hermann
Ludwig von Löwen-
stern (1777-1836) bei
Goethe und schildert
einen fiktiven Dialog
zwischen beiden, in
dem der Besucher
seinem Gastgeber
von einer geplanten
Schiffsexpedition nach Japan erzählt. Man
kommt u.a. auf Swifts Gullivers Reisen zu spre-
chen und die Unmöglichkeit des Schreibens.
Nun hören wir originale Zitate von Goethe jeder-
zeit gern, die fiktiven Dialoge mit einem erfun-
denen Besucher eines noch nicht veröffentlichten
Romans lösen jedoch bei manchem leichte Irri-
tationen aus.
Dr. Bernhard Bueb (Überlingen/Salem)
...ist mir alles verhaßt was mich blos belehrt,
ohne meine Thätigkeit zu vermehren...
Was die deutsche Schule von Goethe lernen sollte
Dr. Adolf Muschg (Berlin/Zürich)
Ich denke mir die Erde mit ihrem Dunstkreise gleich-
nisweise als ein großes, lebendiges Wesen, das im
ewigen Ein- und Ausatmen begriffen ist.
Goethes Natur als Beziehungsfähigkeit
169
Der September
bringt eine span-
nende Veranstal-
tung, die erheblich
mehr bietet, als
der ursprüngliche
Titel Zur Aktuali-
tät von Goethes
Werther vermuten
ließ. Uwe Hentschel demonstriert – nur anhand
einiger weniger Sätze aus den ersten Seiten von
Goethes Briefroman – welchen Epochen-Um-
bruch der Werther sowohl formal als auch inhalt-
lich darstellt. Allein der Ausruf: Wie froh bin ich,
daß ich weg bin..! bedeutete1774 – in einer Zeit,
da der Einzelne in der Regel auf seinen Platz ge-
stellt war und zwangsläufig auf seiner Scholle
verharren mußte – so unendlich viel mehr als
heute im Zeitalter der Mobilität, wo man morgens
in Berlin das Flugzeug besteigt, um noch den
Abend desselben Tages in San Francisco zu ver-
bringen.
Goethes Protagonist zeigt sich allerdings als mo-
dernes Individuum, das nicht an seinen Heimatort
gebunden ist und die Fesseln abstreift. Werther
genießt die Welt, fühlt die Gegenwart des All-
mächtigen, ganz im Sinne des Pantheismus. Er ist
keineswegs untätig und er liebt, wenn auch nicht
konfliktfrei. Er sieht die zweifelhafte Lebens-
weise der meisten Menschen, die den größten Teil
der Zeit arbeiten und das bisschen Freizeit, das
ihnen übrig bleibt, ängstigt sie…
Der Referent spricht frei und zwar über 1½ Stun-
den lang, dennoch gelingt es ihm, die Aufmerk-
samkeit der Zuhörer zu fesseln, was den Schluß
zulässt, daß zuweilen wohl doch nicht die Grenze
des Zumutbaren bei einer Stunde liegt.
Im November folgt dann eine recht ambitionierte
Unternehmung: Eine Podiumsdiskussion mit dem
Titel Die Willensfreiheit – ein Irrtum? Neurowis-
senschaftliche Implikationen in Goethes Denken.
Ein erster und durchaus gelungener Versuch, eine
derartige Veranstaltung gemeinsam mit einer an-
deren Institution durchzuführen; in diesem Fall
mit dem Bernstein-Center für Neurowissenschaf-
ten, welches der HU angeschlossen ist.
Manfred Osten moderierte eine spannende Dis-
kussion zwischen Wolf Singer vom Max-Planck
Institut und John-Dylan Haynes (HU) über die
neuesten Erkenntnisse und Forschungen auf dem
Gebiet der Neurowissenschaften. Ihm gelang es
dabei, immer wieder Goethe ins Spiel zu bringen,
ein Kunststück, das ihm so schnell keiner nach-
macht.
Die an diesem Abend aufgeworfene Frage war,
welche neuronalen Prozesse sich bei sogenannten
höheren kognitiven Leistungen, bei der visuellen
Wahrnehmung, dem Erinnern, anderen Denk-
leistungen und gar bei der Entscheidungsfindung
abspielen. Welche Folgen könnten sich aus dem
Determinismus – einer eingeschränkten oder gar
fehlenden Willensfreiheit – für die gesellschaft-
liche Ordnung und auch für die Rechtsprechung
ergeben? Diese Frage ist seit Jahren in der
Prof. Dr. Uwe Hentschel (Chemnitz)
...ich will das Gegenwärtige geniessen…
Zur Modernität von Goethes Werther
Podiumsgespräch
Prof. Dr. Wolf Singer (Frankfurt am Main)
(Leiter des Max-Planck-Instituts für Neurowissenschaften)
Prof. Dr. John-Dylan Haynes (Berlin)
(Bernstein Center for Computational Neuroscience, HU/Charité)
und Dr. Manfred Osten (Bonn)
Die Willensfreiheit – ein Irrtum?
Naturwissenschaftliche Implikationen
in Goethes Denken
170
Diskussion. Singer hat mit einem Artikel in der
FAZ aus dem Jahre 2004, der im Lichte neuer
Forschungsergebnisse erschien, erheblich zu der
Hypothese beigetragen, daß neuronale Ver-
schaltungen unsere Entscheidungsprozesse fest-
legen; wir sollten daher aufhören, von Freiheit
zu sprechen.
Osten sprach sodann die sich eventuell daraus
ergebende eingeschränkte Strafmündigkeit an,
was Singer nutzte, um auf Mißverständnisse und
falsche Unterstellungen in der Folgendeutung
hinzuweisen.
Das Gespräch wurde auf den Diktatgeber des
Unbewußten hingelenkt. Hierzu merkte Haynes
an, daß dessen Einfluß zwar zwingend angenom-
men werde müsse, es aber unmöglich sei, das
Unbewußte im Scanner einzufangen bzw. diese
Prozesse sichtbar zu machen. Für viele Entschei-
dungen gäbe es keine Erklärung, bei Langzeit-
entscheidungen schon gar nicht, gleichwohl
werden Begründungen von Betroffenen selbst
gesucht und gefunden, müssen jedoch mit Zwei-
feln belegt werden. Eine bewußte Entschei-
dungsfindung wird von beiden Wissenschaftlern
in Frage gestellt. Sowohl für Singer als auch
Haynes gilt es durch die Magnetresonanztomo-
graphie als nachgewiesen, daß Veränderungen im
Gehirn einer bewußten Entscheidung vorausge-
hen. Dies spricht für Determinismus.
Wie Goethe Eckermann anvertraut, ist die Idee
der Willensfreiheit zu schön, als daß wir darauf
verzichten könnten – auch wenn es sich um einen
Irrtum handele.
Ein weiteres Mal können wir uns von Manfred
Ostens Vielseitigkeit überzeugen beim letzten
Vortrag des Jahres: Goethe – Der Konfuzius von
Weimar? Zur Aktualität seines Asienverständnis-
ses. Der Referent – selbst über Jahrzehnte im
auswärtigen Dienst tätig, davon sieben Jahre in
Japan – beschreitet hier nach eigener Aussage li-
teraturwissenschaftlich neues Terrain.
In der Tat war bislang unbekannt, in welchem
Maße sich Goethe bereits ab 1781 mit fernöst-
lichen Lehren beschäftigte, dazu insbesondere
angeregt von dem sogenannten Kanon der
Mäßigung, den er sich alsbald zu eigen machte,
ebenso wie mit fortschreitendem Alter mit den
anderen Hauptforderungen des chinesischen
Weisen: Bedingte Zuverlässigkeit, Selbstüber-
windung und tätige Skepsis.
Der Inhalt der fünf kanonischen Schriften hat
schon früh seinen Wissenshorizont erweitert und
seine Erfahrungswelt gestützt. Die Grundsätze
der Mäßigung und das dadurch erfahrbare Glück
finden sich in seinen Werken. So fand er Vor-
bilder für seine Novelle Der Mann von fünfzig
Jahren – später eingeflossen in den Entwick-
lungsroman Wilhelm Meisters Wanderjahre in
der chinesischen Prosa.
In der Zeit einer großen Barbarei und Schrek-
kensherrschaft hat Konfuzius Wege zu einer
neuen Mitmenschlichkeit gefunden. Der Mensch
sei nicht vorstellbar ohne den Zusammenhang
und Zusammenhalt mit anderen. Der Mensch sei
geboren mit Pflichten.
Die asiatische Philosophie und Geisteshaltung
war Goethe seit seiner Jugendzeit vertraut, er hat
sie verinnerlicht, sie ist aus seinen Werken er-
fahrbar.
Konfuzius und Goethe, verwandt in der Geistes-
haltung einer Kultur der Mäßigung, haben durch
Manfred Osten die Zuhörerschaft mit neuen bzw.
wiederentdeckten Erkenntniswerten entlassen.
Dr. Manfred Osten (Bonn)
Goethe – Der Konfuzius von Weimar?
Zur Aktualität seines Asienverständnisses
171
In seinem Einführungsvortrag umreißt Hans-
Hellmut Allers die bedeutendsten Stilformen der
Neuzeit, die die neue Epoche der Menschheitsent-
wicklung darstellen. Die Erkenntnis der Erziehbar-
keit des Menschen zur Humanität, Toleranz und
Nächstenliebe habe zu Offenheit für das Gute,
Wahre und Schöne geführt, mit jeweiliger Ausrich-
tung auf Rationalität (Aufklärung), Realität und Aus-
gewogenheit von Gefühl und Verstand im Sinne der
griechischen Antike (Klassik) und dann zur neuen
Empfindsamkeit, zur Hingabe zur Natur (Romantik).
Zu allen Entwicklungen wird Goethes Einstellung,
seine Mitwirkung und Förderung bzw. Gegnerschaft
erläutert. Eine besondere Aufmerksamkeit widmet
der Referent der Romantik, die Goethe Eckermann
gegenüber kommentierte: die Klassik sei gesund und
die Romantik krank.
Im Februar führt uns Rainer Falk in das Zeitalter
der Aufklärung ein und konzentriert sich zunächst
auf die verlegerische Tätigkeit Friedrich Nicolais
und veranschaulicht sein spannungsreiches Verhält-
nis zu Goethe, das entscheidend geprägt ist durch
seine Satire Die Freuden des jungen Werthers… eine
parodistisch gemeinte Replik auf Goethes 1774 er-
schienenen Briefroman und Bestseller Die Leiden
des jungen Werthers.
In dieser wird der Selbstmord des Protagonisten
verhindert, indem die Pistole mit Hühnerblut gefüllt
wird.Werther überlebt, heiratet Lotte, sodaß das
Ganze zu einem glücklichen Ende führt. Goethe
reagiert mit einem Gedicht, das die Verunreinigung
eines Grabes durch einen Schöngeist mit seiner
Notdurft zum Inhalt hat. Die wechselseitige
Aufbereitung der erschienenen Werke mittels Satire
und Kritik prägt die damalige literarische Auseinan-
dersetzung. So bezeichnet Goethe 1775 die Aufklä-
rung als eine wässrige, weitschweifige nullende
Epoche.
Im April setzt uns Uwe
Hentschel ins Bild über
Die literarische Fehde
zwischen Goethe und den
Berliner Aufklärern. Im
Vordergrund der Betrach-
tungen des Dozenten ste-
hen C. F. Nicolai, Garlieb
Helwig Merkel sowie A. F. von Kotzebue. und deren
abstrakte Lebenskonzepte. Der Nutzen sei das Idol
der Zeit gewesen, dem vor allem anderen zu huldi-
gen sei. Goethe und Schiller sind hingegen der
Ansicht, daß eine Besinnung auf die sich aus der
Philosophie, Geschichte und der Literatur der Antike
ergebenden Ideale auch einen Wandel in der Gesell-
schaft mit sich bringen könnte.
Sehr bald gehen die unterschiedlichen Standpunkte
in polemische Auseinandersetzungen über, die die
Grenzen zur Beleidigung streifen und in dem von
Schiller und Goethe initiierten berühmten Xenien-
Krieg einen Höhepunkt finden. Mit diesen zweizei-
ligen Gastgeschenken beabsichtigen sie, die
Hohlköpfigkeit des Zeitgeistes und seiner Wortführer
satirisch zu entlarven und zur Diskussion zu stellen.
2013
Wiederholte Spiegelungen
Goethe zwischen Aufklärung Klassik und Romantik
Hans-Hellmut Allers (Berlin)
Einführungsvortrag
Rainer Falk (Potsdam)
Wo ich in eine Stube trete, finde ich das Berliner
Hundezeug…
Der junge Goethe und die
Berliner Aufklärung
Prof. Dr. Uwe Hentschel (Chemnitz)
Merkel und Kotzebue haben sich vereiniget,der lite-
rarischen Welt zu beweisen,daß Goethe gar kein
Dichter ist...
Die literarische Fehde zwischen Goethe
und den Berliner Aufklärern
172
Im Mai bringt uns
Hans Richard
Brittnacher den
Konflikt zwischen
Goethe und Kleist
nahe. Aus den Aus-
zügen des Schrift-
wechsels zwischen
beiden, verdeutlicht
sich insbesondere
Kleists Erfolgsstre-
ben bis zum Sen-
dungsbewußtsein
sowie Goethes un-
verblümte Einschät-
zung von dessen
Werken. Trotz ihrer
unterschiedlichen
Auffassungen über
dramaturgisch bühnenwirksame Handlungsab-
läufe inszeniert Goethe Kleists Zerbrochenen
Krug und die Premiere
wird bekanntlich zum Fi-
asko. Mit der Penthesilea,
die Kleist auf den Knien
seines Herzens über-
bringt, hat sich Goethe
nie näher mit dem Ziel
einer Aufführung be-
schäftigt, sieht er doch
in der Handlung ein
Gemisch von Sinn und
Unsinn. Sein Gesamturteil gipfelte in der
Feststellung verfluchte Unnatur.
Helmut Schanze aus Aachen erläutert uns im
Juni: Goethes Verhältnis zur Jenaer Frühroman-
tik. Wir erfahren wenig Bekanntes über das kom-
plizierte Beziehungsgeflecht zwischen Goethe
und den wichtigsten Vertretern der Frühromantik
– Ludwig Tieck, August Wilhelm und Friedrich
Schlegel, Novalis und Joseph Schelling. Clemens
Brentano und Friedrich Schlegel hatten zur Lite-
raturrevolution« im Athenäum aufgerufen.
Goethe begegnet dem Herrschaftsanspruch der
selbsternannten Heroen deutscher Literatur vor
allem mit Ironie, aber auch der Nonchalance
eines seines Ruhmes sicheren Autors bleibender
Werke mit Weltgeltung. Einige der Kontrahenten
sparen nicht mit Kritik. So bezeichnet Novalis
etwa den Wilhelm Meister als ein fatales, alber-
nes Buch. Goethe kontert in Briefen brillanten
Stils. Überliefert ist – trotz alledem – eine blei-
bende Goethe-Verehrung vieler Romantiker in
späteren Jahren.
Christa Lichtenstern begrüßt das Auditorium
ihres Vortrags Goethe und die Skulptur zunächst
mit der an die Wand projizierten bekannten Goe-
the-Skulptur von Christian Daniel Rauch von
1820. Die Referentin verdeutlicht, wie Goethe
die Plastik wahrnimmt und wie gewählte Motive
und daraus entwickelte Erkenntnisse sich auf
seine Dichtung auswirken. Nach Goethes An-
sicht ist eine Plastik erst schön, wenn von der
Form eine bewegende Kraft ausgeht, die den Ein-
druck fortwährender Metamorphosen vermittelt
und die Wandlung von der Wirklichkeit zum
Symbolischen ahnen läßt.
So werden für den Be-
trachter nicht nur das
Dargestellte – wie z. B.
Castor und Pollux – son-
dern auch die sich damit
verbindenden Begriffe wie
»Bruderliebe« und »Zunei-
gung« deutlich. Schließlich
schlägt Christa Lichtenstern
den Bogen von der geprägten
Form, die lebend sich ent-
wickelt zur Dichtung, die
vom äußeren Rahmen des in
sprachlicher Gestaltung zur
übergreifenden Allge-
meingültigkeit führt.
Prof. Dr. Hans Richard Brittnacher (Berlin)
Verfluchte Unnatur… !
Der Konflikt zwischen Goethe und Kleist
am Beispiel von Iphigenie und Penthesilea
Prof. Dr. Helmut Schanze (Aachen)
Wer erscheint plötzlich vom Gebirg herab? ...
die alte göttliche Excellenz, Goethe selbst…
Goethe und die Frühromantik
Prof. Dr. Christa Lichtenstern (Berlin)
Ich bin Plastiker…
Goethe und die Skulptur
173
Im September-Vortrag Der Theaterdirektor Goethe
und sein Verhältnis zur Dramatik der Romantiker
spannt Hartmut Fröschle einen Bogen von Goethes
frühkindlicher Erfahrung mit dem Puppentheater bis
zu gefeierten und mißlungenen Aufführungen am
Weimarer Hoftheater. Als Goethe 1791 Intendant des
neu installierten Theaters wird, sorgt er für Disziplin,
verbietet Dialekte und formuliert Theater- und
Schauspielergesetze, bei deren Nichtein-
haltung strenge Konsequenzen drohen,
schildert insbesondere Goethes beharrli-
ches, verzweifeltes und manchmal auch
erfolgloses Bestreben, das Weimarer
Theater aus der Provinzebene herauszu-
führen, um ihm gesellschaftliche, politi-
sche und auch künstlerische Bedeutung zu
verleihen.
Durch Conrad Wiedemann erfahren wir Wissens-
wertes über Goethes Mann in Berlin. Zelter darf als
einer der engsten Freunde Goethes bezeichnet wer-
den. Es kommt zu 14 Begegnungen, die sich zuwei-
len über Tage erstrecken. Die Korrespondenz
beginnt 1799, als Goethe zunächst ein Kooperations-
angebot gegenseitiger Inspiration unterbreitet und
bleibt dauerhaft von beiderseitiger Sympathie und
Wertschätzung geprägt . Sie umfasst 871 Briefe mit
insges. 1600 Seiten.
Der Dozent versucht eine Deutung für diesen
ungewöhnlichen Briefwechsel: Zelter richtete seine
Berichterstattung aus der preußischen Königshaupt-
stadt in den ersten Jahren ganz offensichtlich aus an
Goethes Berlin-Bild und seine daraus resultierenden
orientierten Ansichten. Nach Auffassung des Refe-
renten waren seine Briefe sehr häufig geprägt von
einem Huldigungsüberschuss für Goethe, er befand
sich jahrelang auf der Textspur der Beflissenheit und
zeigte ein Übermaß an Anpassung: exemplarisch der
Brief vom 12. 12. 1802: hochgeliebter Freund.
Als Erklärung bietet Wiedemann an, Zelter sei der
Therapeut Goethes gewesen, er habe bei Goethe eine
Deformation des Selbstbildes als auch seines Ber-
lin-Bildes erkannt, zumal die Opposition gegen Goe-
the vor allem von dort ausging. Abweichende An-
sichten Zelters und dessen nunmehr selbstbewußtere
Ansichten im letzten Jahrzehnt der Korrespondenz
werden von Goethe toleriert. Die enge freundschaft-
liche Verbindung besteht bis zum Tode Goethes im
März 1832. Zelter stirbt nur zwei Monate später.
Prof. Dr. Hartmut Fröschle (Stuttgart)
deswegen bringen mich auch ein halb Dutzend
jüngere poetische Talente zur Verzweiflung…
Der frustrierte Theaterdirektor
– Goethes Verhältnis zur Dramatik
der Romantiker
Prof. Dr. Conrad Wiedemann (Berlin)
Er kann (...) mitunter sogar etwas roh erschei-
nen. Allein das ist nur äußerlich. Ich kenne
kaum jemand, der zugleich so zart wäre wie
Zelter.
Goethes Mann in Berlin
– Der Briefwechsel mit Zelter
Carl Friedrich.Zelter
174
Manfred Osten, der im November zum Thema Die
Romantik und Goethes Widerstand gegen deren
Kunst und Literatur der Verzweiflung spricht, findet
Goethes Vorbehalte gegen die Romantik in einem
Satz gebündelt, der einem Brief Goethes an W. Rein-
hardt entnommen war: Manchmal machen sie mir’s
doch zu toll. So muss ich mich zurückhalten, nicht
grob zu werden über den Narrenwust dieser Tage.
Obwohl man in einigen Werken Goethes ohne
Schwierigkeiten Bezüge zur Romantik herstellen
könne, macht der Dozent dessen Abgrenzungen
deutlich. Nicht das sich verlieren und leben im
Gestern oder Morgen, sondern die bewußte Wahr-
nehmung des Heute führe zur sinnvollen Lebensge-
staltung Wer Macht hat über sich selbst und sie
behält, leistet das Größte und Schwerste.
Drei Kriterien waren für Goethe wegweisend: die
kritische Distanz zu sich, die Selbstüberwindung und
die geregelte Erfahrung. Die Negativeigenschaften,
die er bei Romantikern erkannte, reichten von Form-
losigkeit über Frömmelei bis zur Charakterlosigkeit
und das Unverständnis für die Regeln der Natur.
Theo Buck gibt zunächst einen Überblick auf die
unterschiedliche Epochen-Zuordnung der Leiden des
jungen Werthers in Deutschland und Frankreich. Er
verdeutlicht, daß Goethes 1773 erschienener Brief-
roman zwar in Deutsch-
land als Werk des Sturm
und Drang gesehen
wird, im Ausland, insbe-
sondere in Frankreich,
sei dies aber keineswegs
der Fall, vielmehr werde
Werther mit seiner Na-
turverbundenheit, seiner
Zerrissenheit und sei-
nem vielfach geäußerten
Weltekel als typischer
Vertreter der Romantik
gesehen.
Der Referent zeigt noch einmal jene Wege auf, die
den Protagonisten in die hilflose Lösung der Selbst-
vernichtung trieb. Werther – schwärmerisch und
naturverbunden – steht im Gegensatz zum auf-
klärerischen Ideal eines rationalen, pflichtbewußten
an Nützlichkeit und Erfolg orientierten Bürgers. Sein
Streben nach Selbstverwirklichung mündet in eine
Ich-Sucht, zur Rollenverweigerung durch Verzweif-
lung, ja sogar zum Ekel an der Gesellschaft.
Aus Zerrissenheit wird die Welt zum Hindernis.
Motive für das selbst gewählte Ende Werthers faßt
der Referent in den Begriffen Leiden, Bruch, Lücke
zusammen, was zum Verlust von Harmonie
zwischen dem Ich und der Welt führen muß. Dem
fehlenden Ausgleich zwischen Lebensanspruch und
Lebensleistung kann nur die Krankheit zum Tode
folgen.
Dr. Manfred Osten (Bonn)
…manchmal machen sie mir’s doch zu toll.
So muß ich mich zurückhalten, nicht grob zu werden
über den Narrenwust dieser Tage...
Die Romantik und Goethes Widerstand gegen deren
Kunst und Literatur der Verzweiflung
Prof. Theo Buck (Aachen)
Es müßte schlimm sein, wenn nicht jeder einmal in
seinem Leben eine Epoche haben sollte, wo ihm der
„Werther“ käme, als wäre er bloß für ihn geschrieben...
Goethes Werther im Urteil der europäischen
Romantik
L.Tieck
F.Schlegel
Novalis
A. W. Schlegel
175
Manfred Osten nähert sich unserem diesjährigen
Thema Von Werken Goethes und ihrer Entstehungs-
geschichte auf unerwartete Weise: Er analysiert den
Begriff der Wahrheit unter Verwendung von Goe-
thes erkenntnistheoretischen Einsichten. Voran
stellt er seinen Überlegungen das Goethezitat: Wäre
es Gott darum zu tun gewesen, daß die Menschen
in der Wahrheit leben und handeln sollen, so hätte
er seine Einrichtung anders machen müssen…
(Maximen und Reflexionen).
Der Mensch gehe nun einmal von einem Irrtum
zum anderen; insbesondere im Prozeß der Erinne-
rung destabilisiere und verforme sich das Gesche-
hen. So werde die Gewißheit begründet, daß
Werken mit biographischen Zügen nur Ideen zu-
grunde lägen, die die Vergangenheit liefere.
Was ist also Wahrheit? Ist es die Ȇbereinstimmung
mit der Wirklichkeit«, wie es so oft als Definition
angeboten wird, – mit einer Wirklichkeit, die wie-
derum unterschiedlich interpretiert wird?
Osten vermittelt über diverse Zitate Bekundungen
Goethes hierzu: Es irrt der Mensch, solang er strebt
(Faust). Er nennt’s Vernunft und braucht’s allein,
um tierischer als jedes Tier zu sein (Faust). Der
Mensch ist ein dunkles Wesen, er weiß nicht, woher
er kommt, wohin er geht, er weiß wenig von sich
selber...
(Goethe 1829 zu Eckermann)
.
Der Referent näherte sich dann der Wahrheit, die
mit der Natur selbst zu tun hat: Die Natur versteht
keinen Spaß, sie ist immer wahr, sie hat immer
recht. Manfred Osten sieht die Möglichkeit eines
Zugangs zur Wahrheit daher in der Begeisterung,
der Liebe, dem Interesse, dem Gedächtnis und den
hierzu unzähligen Bezügen in Goethes Werk. Die
Ratio mit dem Unbewußten in eine Balance zu brin-
gen, sei eine Aufgabe und ziele auf sinnvolle
Lebensgestaltung.
Zur Einführung in Goethes
Sesenheimer Zeit läßt
Robert Walter-Jochum
Goethe sprechen und trägt –
quasi als Erinnerungs-
schlüssel für die Ereignisse
in Sesenheim Willkommen
und Abschied vor. Über die
Liebesbeziehung zu Friede-
rike Brion 1770/1771 liegen
wenig authenti-
sche Zeugnisse
vor. Als Leitbild
für die Annähe-
rung an die Sesen-
heimer Episode
sieht der Referent
den Roman Der
Pfarrer von Wake-
field von Gold-
smith, in dem er
die Romanfiguren
der Sesenheimer
Pfarrersfamilie ge-
spiegelt sieht.
Seine ausführliche
Darstellung und
Charakterisierung
der Romanfiguren
bei Goldsmith ver-
deutlicht Goethes
Anleihe der dort
beschriebenen
Verkleidungseska-
pade: Die Ver-
kleidung als Theologie-Student entsprach seiner
Vorstellung und dem Wunsch, einem literarischen
Leben mehr Aspekte und größere Bedeutung abzu-
gewinnen, als es die Realität bieten.
Walter-Jochum verwendet sodann viel Aufmerk-
samkeit auf die Begründung, weshalb die Ver-
bindung Goethe/Friederike von vornherein zum
Scheitern verurteilt gewesen sei.
2014
Der Dichtung Schleier
aus der Hand der Wahrheit
Von Werken Goethes und ihrer Entstehung I
Dr. Manfred Osten (Bonn)
Wäre es Gott darum zu tun gewesen, daß die Men-
schen in der Wahrheit leben und handeln sollten, so
hätte er seine Einrichtung anders machen müssen...
Goethes Dichtung und was ist Wahrheit?
Robert Walter-Jochum, M.A. (Berlin)
Mein Geist war ein verzehrend Feuer...
»Seliges Wahnleben« und »verödete Localität«
– Goethes Sesenheim in Dichtung und Wahrheit
176
Gesa Dane ver-
mittelt einen guten
Überblick, darü-
ber, wie Die Lei-
den des jungen
Werthers und die
tatsächlichen Er-
eignisse von Goe-
thes Wetzlarer
Aufenthalt sowie die Zeitströmungen des Sturm und
Drang ineinander verwoben sind.
Wie dies im Briefroman verarbeitete Wetzlarer
Jugenderlebnis bei Goethe fortwirkt, verdeutlicht die
Dozentin durch den Hinweis auf Goethes Mitteilung
zur Neuauflage des Werthers 50 Jahre nach dessen
Erscheinen 1774:
Übrigens habe ich das Buch (...) seit seinem Erschei-
nen nur ein einziges Mal wieder gelesen und mich
gehütet, es abermals zu tun. Es sind lauter Brandra-
keten! Es wird mir unheimlich dabei, und ich fürchte,
den pathologischen Zustand wieder durchzuempfin-
den, aus dem es hervorging.«
(Gespräch mit Eckermann, 2. Januar. 1824)
Die Referentin macht ferner deutlich, wie Goethes
Grundeinstellung zu Religion und Religionsphiloso-
phie in das Werk einfließen. Werther findet zwar
Trost in Gott, aber keineswegs in der Religion. Er
sieht seinen Tod als Opfertod und sich selbst in der
Nachfolge Jesu: ich opfere mich für Dich. Der letzte
Satz des dramatischen Vorgangs: kein Geistlicher hat
ihn begleitet, dürfe als Kritik an der Kirche gesehen
werden.
Zu Goethes Zeiten zeichnet sich eine Änderung der
aristokratischen Rollenerwartungen ab. Welche
gelockerten Verhaltenskonzepte waren innerhalb
einer festgefügten Hierarchie möglich?
Peter André Alt macht Mißverständnisse, die sich
aus der Einordnung in ein höfisches Wertesystem und
der vermeintlichen Freiheit für geniale Poeten erge-
ben, auf der Grundlage von Goethes Torquato Tasso
klar. Zwei Menschen, zwei Weltanschauungen be-
gegnen sich auf konfliktträchtige Weise.
Durch viele Zitate und Rückgriffe auf begleitende
Literatur der Zeit macht Alt deutlich, wo, wann und
durch wen in diesem Drama das Verhalten den
Formen der höfischen Affektkontrolle entspricht oder
andernfalls gegen das Prinzip der Harmonie und
Balance verstoßen wird.
Antonio sieht sich
als weltoffener und
kenntnisreicher Di-
plomat und Politi-
ker, jedoch in
dienender Funktion,
Tasso dagegen sieht
seinen persönlichen
Lebensgewinn in
dem Streben nach
Glück und Genuß: erlaubt ist, was gefällt und offen-
bart eine narzistische, zuweilen melancholische Ego-
zentrik des Genies. Die durch Wesen, Gestik und
Sprache vorgegebenen Verhaltensweisen machen
Tasso zu einem Fremden innerhalb der durch höfi-
sche Formen konstituierten Welt.
Die vita activa sieht Antonio erfüllt in dem Grundsatz
was gelten soll muss wirken und muss dienen und der
Mensch erkennt sich nur im Menschen, nur das
Leben lehret jeden, was er sei.
Goethe hat seinen Tasso begonnen, als er die eigene
Doppelexistenz analysiert, sie nicht als friedliches
sinnvolles Nebeneinander wahrnimmt, sondern als
spannungsgeladene, konfliktreiche Situation empfin-
det. Tasso und Antonio bewundern, beneiden und
befehden sich wechselseitig für das, was sie selbst
nicht haben.
Die erzwungene Vernachlässigung von Eigeninteres-
sen ist allen »Dienenden« bekannt. Auch die nach
Lorbeer strebenden oder schon bekränzten Künstler
sind von Leidensphasen nicht frei. Ihr Trost sei: und
wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir
ein Gott, zu sagen, wie ich leide.
Prof. Dr. Gesa Dane (Berlin)
Es sind lauter Brandraketen!
Es wird mir unheimlich dabei..
.Fakten und Fiktionen in
Die Leiden den jungen Werthers
Prof. Dr. Rüdiger Safranski (Berlin)
im Gespräch mit Dr. Manfred Osten (Bonn)
Goethe – Kunstwerk des Überlebens
Prof. Dr. Peter André Alt (Berlin)
Deutlich seh’ ich nun die ganze Kunst
des höfischen Gewebes!
Goethes Torquato Tasso als
Drama der sozialen Form
177
Am 3. September 1786 nachts um 3 Uhr tritt Goethe
von Karlsbad aus seine zunächst geheim gehaltene
Italienreise an, von der er erst im Mai 1788 nach
Weimar zurückkehrt. Nicht unmittelbar danach,
sondern erst in der Zeit zwischen 1813 und 1817
entsteht Die Italienische Reise. Uwe Hentschel geht
der Frage nach, warum dies so spät geschieht und
weshalb Goethe von der ursprünglich geplanten
Werkkonzeption abweicht. Mit Sicherheit sei Die
Italienische Reise nicht ein Kernstück zeitgenössi-
scher Reiseliteratur gewesen, denn das Werk ent-
spreche in keiner Hinsicht den Kriterien dieses
Genres.
Mit überzeugenden Argumenten legt der Dozent dar,
weshalb Goethe über Jahrzehnte mit der Auswertung
seiner Tagebuchaufzeichnungen wartet und welche
Intentionen und Ziele er mit der Niederschrift eigent-
lich verfolgt. Seine Absicht ist es, ins Ganze zu stu-
dieren, das Vorgegebene nach seinem inneren Wert
zu beurteilen, den Symbolgehalt zu sehen und zu er-
gründen. Gegenüber Schiller erläutert er seinen Plan
wie folgt: Er beabsichtige, von unten herauf, aus-
gehend von der geologischen Basis zur Kultur des
Landes fortzuschreiten und zugleich [mit Hilfe von
Meyer] auch von oben herein, von der Kunstseite
her, auf den Gegenstand zuzugreifen«.
Der Leser soll also mehr sehen und verstehen als der
Reisende. Zur Vervollkommnung seiner Studien
will und muß Goethe eine zweite Reise antreten, die
er ab 1795 vorbereitet. Welche Folgen eine Über-
prüfung und Erweiterung erster Eindrücke haben
kann, verdeutlicht der Referent am Beispiel des Rö-
mischen Karnevals. Zunächst erlebt Goethe dieses
Fest als lärmende Aggressivität und Primitivität (an
Herder: das Carneval habe ich satt). Beim zweiten
Besuch sieht Goethe dies anders, nämlich als Natio-
nalereignis von universaler Bedeutung. Hier hat der
sog. zweite Blick etwas bewirkt.
Was Goethe bei der Bewertung des Römischen Kar-
nevals erlebte, konnte er bei seinen weiteren Studi-
enplanungen zu Italiens Landschaft, Kunst und
Kultur nicht realisieren. Eine zweite Forschungs-
reise fand nicht statt, für den klärenden zweiten
Blick gab es keine Gelegenheit. Es entstand dann je-
doch Die Italienische Reise, ein Werk, das sich
neben Dichtung und Wahrheit und Kampagne in
Frankreich in seine autobiographischen Schriften
einreiht und dem Leser einen über eine Reisebe-
schreibung hinausgehenden Blickwinkel verschafft.
Ariane Ludwig, wissenschaftliche Mitarbeiterin
des GSA in Weimar, besitzt uneingeschränkten Zu-
gang zu den Orginalmanuskripten und kann daher
detailliert die Entstehungsgeschichte von Wilhelm
Meisters Wanderjahre veranschaulichen. Goethe
hatte den Text von 1807 bis 1810 niedergeschrieben,
1821 erscheint die erste Fassung, 1829 folgt die
völlig umgestaltete Version.
Die Handlung ist nicht auf einen im Mittelpunkt ste-
henden Helden bezogen, daher kann der Leser keine
fortlaufende nach üblichen Romankriterien verfolg-
bare Handlung erwarten.
Die Erzählung löst sich in Einzelbilder auf, hat also
bereits die Form eines Romans der Moderne. Die
Verbindung der Kapitel wird nicht von einem auk-
torialen Erzähler erläutert, für den Leser bleibt somit
Deutungsspielraum, die Symbolik der Kästchen und
Schlüssel zu ergründen. Ein wichtiges Element der
Wanderjahre ist die im Titel erwähnte Entsagung.
Der Verzicht auf Niederes zugunsten Höherem ist
das zentrale Anliegen in den Wanderjahren und der
Ethik Goethes.
Prof. Dr. Uwe Hentschel (Chemnitz)
Auf der Reise rafft man auf was man kann...
Der verhinderte zweite Blick oder warum Goethe
über Italien keinen Reisebericht verfasste
Dr. Ariane Ludwig (Weimar)
…ist es nicht aus Einem Stück,
so ist es doch aus Einem Sinn...
Zur Entstehung und Komposition von
Wilhelm Meisters Wanderjahren
oder Die Entsagenden
178
Gleich zu Beginn seiner Ausführungen verdeutlicht
Dirk von Petersdorff, es erscheine ihm unmöglich,
die Lyrik Goethes im Hinblick auf Formen und Aus-
drucksvielfalt nach allgemeingültigen Gesichtspunk-
ten einzuordnen. Goethe prägte sowohl die Epochen
des Sturm und Drang als auch der Klassik, verfasste
Gedichte von hoher sprachliche Komplexität, präg-
nante Zweizeiler, Gedichte ohne Reime, doch auch
solche in freien Rhythmen. Sie zeigen Widersprüche
und überlassen die Deutung dem Leser.
Der Einführungssatz Die Welt ist voller Widersprü-
che und sollte sich’s nicht widersprechen?, dem
Gedicht Vorklage entnommen, führt bereits auf diese
Spur. Der Referent stellt zwei herausragende
Gedichte vor. Zunächst einmal widmet er sich
Prometheus, einem Gedicht aus dem Sturm und
Drang, das keinem metrischen Bauplan folgt, viel-
mehr nur rhythmische Einheiten aufweist.
Es ist ein Monolog des Prome-
theus an Zeus und stellt quasi
eine Autonomierklärung des
jungen Goethe dar. Prometheus
verweigert Ehrfurcht, zweifelt
an der Allmacht der Götter, ne-
giert deren schöpferische Ord-
nung und will Menschen nach
seinem Bilde formen. Bereits
Goethes Zeitgenossen hätten –
so der Referent – sehr gut verstanden, daß sich hinter
der antiken Verbrämung ein Angriff des Menschen der
Aufklärung auf den Christengott verberge. Ob das als
Hybris gesehen werden muß oder dem damaligen Ge-
niebegriff der Sturm-und-Drang-Zeit geschuldigt ist,
bleibt offen.
Seit 2009 wird unter der Leitung von Anne Bohnen-
kamp-Renken im Freien Deutschen Hochstift die
laufende Hybridedition von Goethes Faust erarbeitet,
eine historisch-kritische Ausgabe des Goetheschen
Hauptwerks. Der überwiegende Teil der über 2000
Handschriftenseiten umfassenden Sammlung befin-
det sich in Weimar.
Erst jetzt sei es möglich gewesen, die Arbeit an dieser
großen historisch-kritischen Ausgabe des Faust an-
zugehen, denn in der früheren DDR war man zu einer
Zusammenarbeit nicht bereit, erläutert die Direktorin
des Hochstifts.
1994 hatte Albrecht Schöne noch im Vorwort seiner
Goethe-Ausgabe im Deutschen Klassiker Verlag es
als nationale Schande bezeichnet, daß es bei dem
weltgeschichtlichen Rang der Faust-Dichtung keine
historisch-kritische Ausgabe gäbe.
Die Unternehmung, die dem abhelfen soll, wird eine
Faksimile-Edition in Buchgestalt sein, verknüpft mit
einer interaktiven digitalen Online-Version. Die For-
scherin bindet darum neben Philologen auch Infor-
matiker in die Projektgruppe ein.
Die elektronische Version wird die gesamte Über-
lieferung des Werkes, von den Handschriften bis zu
den Drucken zur Lebenszeit Goethes bieten. Neben
dem Freien Deutschen Hochstift sind auch die Klas-
sik Stiftung Weimar und die Julius-Maximilians-Uni-
versität Würzburg beteiligt. Die Finanzierung des
eine Million Euro teuren Projekts leisten Sponsoren
und die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Für die
geplante Druckausgabe müssen noch »weitere Spon-
sorengelder« gefunden werden.
Prof. Dr. Dirk von Petersdorff (Jena)
Die Welt ist voller Widerspruch,
Und sollte sich´s nicht widersprechen?
Widersprüche und Spannungsverhältnisse
in Goethes Leben und seiner Lyrik
Prof. Dr. Anne Bohnenkamp-Renken (Frankfurt a. M.)
Natur und Kunstwerke lernt man nicht kennen wenn sie
fertig sind; man muß sie im Entstehen aufhaschen.«
Aus der Arbeit an der historisch-kritischen
Hybrid-Edition von Goethes Drama Faust II
179
Gleich im Januar anspruchsvolle Kost und ein für
den Jahresbeginn verheißungsvoller Vortragstitel:
Das Vorspiel als Endspiel. Peter André Alt geht
es um die die Darstellung der Machtverhältnisse
zwischen Gott und dem Teufel im Faust-Prolog.
Die wettähnliche Verabredung zwischen dem
Herrn und Mephisto – so der Referent – steht im
Zeichen eines Ungleichgewichts, das in der Tra-
gödie noch signifikanter wiederkehren wird.
Wenn Mephisto Gott um die Erlaubnis bittet,
Faust »die eigene Straße sacht zu führen«, dann
bringt das eine Hierarchie zum Ausdruck, die
auch für das Verhältnis von Herr und Teufel be-
stimmend bleibt.
Gott formuliert nämlich den häufig übersehenen
Generalvorbehalt, daß die Abmachung nur gelte,
So lang er auf der Erde lebt. Danach kann Gott
jederzeit in das Arrangement eingreifen und die
Verirrungen Fausts korrigieren. Was Mephisto
Wette nennt, ist folglich ein vorab entschiedenes
Spiel, in dem Gott nicht verlieren kann, weil ihm
das Recht zusteht, die desorientierte Seele zur
Einsicht zu bringen.
Die Erlösung Fausts, die später unter Verweis auf
sein dauerhaftes Streben vollzogen wird, ist me-
taphysisch schon vorgezeichnet in der Lizenz des
Regisseurs Goethe, der das Geschehen anhalten
darf, wenn es für die Menschen gefährlich wird.
Conclusio: Gott sitzt bei Abmachungen mit dem
Teufel, den er jedoch benötigt, um die Menschen
in Versuchung zu
bringen, grundsätz-
lich am längeren
Hebel. Im übrigen
hat Goethe dies
längst erkannt. Als
Faust fragt: wer
bist du denn? lau-
tet Mephistos Ant-
wort: ein Teil von
jener Kraft, die
stets das Böse will
und stets das Gute
schafft.
Sodann im Februar
gleich noch einmal
der Faust, diesmal
Teil 2, 5. Akt. Kurz
zuvor hat Michael Jaeger den 3. Band seiner
Faust-Trilogie vorgelegt, betitelt: Wanderers Ver-
stummen, Goethes Schweigen, Fausts Tragödie
(2014). Ist der Faust ein kühnes Fortschrittsdrama
oder ein Werk des verzweifelten Weltabschieds
einer untergehenden Kultur? Michael Jaeger
macht keinen Hehl daraus, daß er der zweiten In-
terpretation anhängt. Ihm zufolge hat Goethe im
Zeichen seiner Italienerfahrung sich selbst bis
zum Ende seines Lebens als jenen Wanderer ver-
standen, der im Schlußkapitel des Faust II als die
verstörendste Figur seines Werks erscheint. Die-
ser Wanderer betritt bei Jaeger quasi als Goethes
alter ego die Bühne.
2015
Dichterworte um des Paradieses Pforte
Von Werken Goethes und ihrer Entstehung II
Prof. Dr. Peter André Alt
Und wandelt mit bedächt'ger Schnelle /
Vom Himmel durch die Welt zur Hölle.
Das Vorspiel als Endspiel: Goethes Faust-Prolog
PD Dr Michael Jaeger (Berlin)
Es ist eine Rekapitulation meines Lebens
und meiner Kunst.
Goethe, der Wanderer und Faust
180
Daniel Wilson konzen-
triert sich auf zwei
Gedichtzyklen Goethes
nach antiken Vorbildern
– die Römischen Elegien
und die Venezianischen
Epigramme – und deren
Publikationsgeschichte.
Die Elegien sind für Schillers Zeitschrift Die Horen
vorgesehen, eine Auswahl der Venezianischen Epi-
gramme für den von Friedrich Schiller
herausgegebenen Musen-Almanach. Beide Zyklen
werden zu Goethes
Lebzeiten (und
auch später noch)
nicht vollständig
abgedruckt.
Als Herausgeber
liest Schiller die
Texte kritisch, be-
spricht mit Goethe, was im Druck mitteilbar wäre,
was man seiner Meinung nach streichen müsse,
bzw. welche der Epigramme für den Almanach
überhaupt nicht in Frage kämen – die explizit sexu-
ellen und die anti-
klerikalen.
Zu den Kritikern
aus dem Freundes-
kreis gehören ferner
Herder und Herzog
Carl August. Goe-
the zeigt notabene
Bereitwilligkeit zu
Änderung und Rücknahme. Die priapischen Ele-
gien, von denen man peinlich berührt ist, werden
entfernt. Schiller sieht sich ferner veranlaßt, Grund-
sätze zu entwickeln, die innerhalb einer erotischen
Literatur beachtet werden müssen.
Normalerweise nennt man das Zensur. Goethe ist
so etwas gar nicht gewohnt; doch zeigt er sich zäh-
neknirschend einsichtig. Striche von deutlichen
Ausdrücken aus Prüderie, gar den Austausch ein-
zelner Wörter gegen unverfängliche Bezeichnun-
gen, nimmt er jedoch nicht hin. Da streicht er lieber
ganze Passagen selbst – manches unwiederbring-
lich. Der Dozent bedauert, daß die Gattung der un-
gehemmten erotischen Literatur im Hinblick auf die
Zensur nicht realisiert werden konnte.
Jutta Müller-Tamm führt uns
in die im 19. Jahrhundert neue
und herausragende Form einer
Autobiographie mit Weltbedeu-
tung ein und begann mit der Fra-
gestellung: An welchem Punkt
seines Lebens beginnt Goethe
eine Autobiographie zu schrei-
ben, mit welcher Intention und
mit welchem Effekt? Sie bietet einen thematischen
und zeitbezogenen Überblick seiner Werke mit au-
tobiographischem Anteil. Aus ihren folgenden Aus-
führungen werden die Einzigartigkeit und
Verwobenheit von Goethes Leben und Werk und
seine unverwechselbare Individualität deutlich.
Unter dem Titel Ein paar Blicke in die freye Welt –
Goethes Briefe aus der Schweiz« geht Uwe
Hentschel der Frage nach, wie Goethe Gedanken
zu den Verhältnissen in der Schweiz, die er dreimal
(1775, 1779 und 1797) besuchte, aufgenommen,
entwickelt und später revidiert hat.
Sind es 1775 noch ein Paar Blicke in die freye Welt,
die er sich erhoffte, läßt ein Zitat aus dem Jahre
1796 ganz andere Erkenntnisse vermuten. Goethe
äußerte sich wie folgt: Frei wären die Schweizer?
Frei diese wohlhabenden Bürger in den verschlos-
senen Städten? Frei diese armen Teufel an ihren
Klippen und Felsen? Was man den Menschen nicht
alles weismachen kann!
Prof. Dr. Daniel Wilson (Halle)
Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte in einem…
Schillers „freundschaftliche“ Zensur der
römischen Elegien und der venezianischen Epigramme
Prof. Dr. Jutta Müller-Tamm (Berlin)
eine Ausgeburt mehr der Notwendigkeit als der Wahl...
Konfession in Bruchstücken –
Zu Goethes autobiographischen Schriften
und ihrer Entstehung
Prof. Dr. Uwe Hentschel (Chemnitz)
»Ein Paar Blicke in die freye Welt...«
Goethes Briefe aus der Schweiz
181
Elke Richter, wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Goethe-Schiller-Archiv, spricht über Goethes
Briefe an Charlotte von Stein, die sie zusammen
mit Georg Kurscheidt u.a. aus den Weimarer Be-
ständen des GSA im Akademie Verlag publiziert.
Der rege Austausch – mit oft mehreren Briefen
am Tag – beginnt 1775, als Goethe als Verfasser
des Werther freundlich in Weimar aufgenommen
wird und endet 1786 mit Goethes Aufbruch zu
seiner ersten Italienreise.
Es sind ca 1.700 Briefe erhalten, oft kleine Zet-
telgen in spezieller Faltung, die einen hohen Grad
an Vertrautheit anzeigen. Sie bezeugen das sehr
komplexe Verhältnis der beiden Briefschreiber.
Nach seiner Rückkehr aus Italien bleibt das Ver-
hältnis Goethes zu Frau von Stein distanziert. Der
Vortrag wird durch die begleitende Lesung von
größeren Briefpassagen einfühlsam und anschau-
lich durch die Schauspielerin Cora Chilkott
gestaltet.
In den Mittelpunkt seiner Ausfüh-
rungen über die Entstehungsge-
schichte der Wahlverwandtschaften
stellt Manfred Osten die Gestalt
des Naturforschers Alexander von
Humboldt. Ihn schätzt Goethe be-
kanntlich sehr, obwohl dessen erd-
geschichtliche Theorien seinen
eigenen widersprechen. Osten ent-
wirft zudem ein großes Panorama voller Assozia-
tionen, um das Zeitgefühl des frühen 19. Jahrhun-
derts zu beschreiben: Es ist jetzt alles ultra!, wie
es Goethe ausdrückte – die Veränderungen und
der Umsturz der alten Ordnungen durch die Fran-
zösische Revolution ebenso wie die gravierenden
Folgen der Industriellen Revolution.
Diese ließen sich – so der Referent – z. T. auch
in den Wahlverwandtschaften ablesen. Hierfür
nennt er einige Textstellen, die einige Mitglieder
in der anschließenden lebhaften Diskussion aller-
dings nicht stichhaltig finden. Die Erkenntnis,
daß jeder aus den Wahlverwandtschaften heraus-
liest, was seinen persönlichen Beziehungs-
erfahrungen entspricht, ist ja keine ganz neue
Einsicht.
Dr. Elke Richter (Weimar)
Wie kann ich seyn ohne Ihnen zu schreiben?
Goethes Briefe an Charlotte von Stein
Dr. Manfred Osten (Bonn)
Man wandelt nicht ungestraft unter Palmen
Alexander von Humboldt, ein abgründiger Name
in Goethes Wahlverwandtschaften
182
Volker Hesse spricht
über Goethes Far-
benlehre, die in zwei
Bänden 1808 und
1810, als Textband
und als Tafelteil in
zwei Formaten bei
Cotta erscheint. Er
selbst sieht dies als
sein Hauptwerk an,
empfindet er sich
doch in erster Linie
als Wissenschaftler,
dann erst als Dichter.
Auf diesem Feld sieht er sich auch Newton über-
legen.
Seine Beobachtungen zur Lichtbrechung und
zum Prisma bringen ihn zur Erkenntnis, daß das
Licht farblos sei, da die Farben sich erst im
menschlichen Gehirn zusammensetzen und nicht
den Dingen eigen sind. Die Wissenschaft vom
Licht hat auch Auswirkungen auf seine Vorstel-
lungen von der Harmonie von Farben, sowohl bei
Räumen als auch
bei Kleidern ver-
schiedener Perso-
nentypen. Ergänzt
durch eine Power-
point-Präsentation
ist der Vortrag
trotz der schwieri-
gen Materie ganz
besonders an-
schaulich.
Für Steffen Martus, den frisch gebackenen Leib-
niz-Preisträger und Gründungsinhaber eines neu
eingerichteten Lehrstuhls für Neuere deutsche Li-
teratur an der HU-Berlin, scheint das recht ambi-
tionierte Vortragsthema gerade angemessen: Die
Entstehung von Goethes literarischem Lebens-
werk – mal eben so in einer Stunde.
Der Referent dämpft jedoch gleich zu Beginn die
Erwartungen des Auditoriums: Es werde nicht so
sehr inhaltlich um Goethes literarisches Ver-
mächtnis an die Nachwelt gehen; vielmehr wolle
er verdeutlichen, daß dieser auch im bewußten
Umgang mit dem eigenen Werk neue Impulse ge-
setzt habe.
Waren Gottsched, Gellert und Wieland noch
damit beschäftigt, die eigene, später als mangel-
haft empfundene Jugendlyrik nachzubessern und
mehr oder weniger gelungen ins eigene Werk zu
integrieren, entdeckt Goethe um 1800 die eigene
Historizität und trachtet bereits bei der ersten
vollständigen Werkausgabe für den Verlag Unger
danach, den Wünschen der Leser entgegen zu
kommen.
Wie Martus anschaulich ausführt, überläßt er
nichts dem Zufall. Ein Beispiel unter vielen:
Goethe entscheidet, daß die Gedichte an den An-
fang der Werkausgabe kommen sollten, da sie be-
reits einen Überblick auf die verschiedenen
Lebensabschnitte vermitteln. Dies wird seitdem
von allen Dichtern übernommen. Goethe wieder
mal als Wegbereiter, aber das kennen wir ja von
ihm.
Prof. Dr. Volker Hesse (Berlin )
daß die einzelnen Farben besondere
Gemütsstimmungen geben...
Goethes Verständnis des Lichtes
Prof. Dr. Steffen Martus (Berlin)
des Verfassers Naturell, Bildung, Fortschreiten und
vielfaches Versuchen nach allen Seiten hin klar
vor‘s Auge zu bringen...
Die Entstehung von Goethes Lebenswerk
183
Jochen Golz betont zunächst einmal, wie wichtig
der Aspekt des Weltbürgers für die internationale
Goethe-Rezeption sei, nicht zuletzt deshalb gehöre
sein Nachlaß zum Weltkulturerbe der Unesco.
Schon früh lernt Goethe neben Latein auch Franzö-
sisch, Italienisch und Englisch und vertieft durch
Reisen seine Kenntnisse fremder Länder. Zudem ist
er mit den Werken der Weltliteratur vertraut, etwa
denen Torquato Tassos, Voltaires oder William
Shakespeares.
Hinzu kommen die Religionen, neben der christli-
chen auch das Judentum und der Islam, in denen
sich Goethe bestens auskennt. Seine Erläuterungen
zum West-östlichen Divan sind dafür ein gutes
Zeugnis. In den Wanderjahren, etwa mit den Aus-
wanderungsplänen Lenardos, konkretisiert er seine
Vorstellung vom Weltbürgertum. Hier geht es nicht
um die Anhäufung von Besitz, sondern um die glo-
bale Perspektive: Trachte jeder sich selbst und an-
deren zu nützen.
Christof Wingertszahn gibt uns Einblicke in
Goethes lebenslange Beschäftigung mit England.
Die englische Tagespolitik verfolgt er durch inten-
sive Zeitungslektüre, lehnt aber das parlamentari-
sche System und den Streit der Parteien ab. Er
schätzt den englischen Nationalcharakter mit
Eigenschaften wie Nationalstolz, Selbstdenken, und
Geschäftigkeit; wobei sein Englandbild ganz den
Klischees der Zeit entspricht.
In seinen frühen Jahren ist er von Oliver Goldsmith
und dessen Vicar of Wakefield angezogen, der auch
im Werther seinen Niederschlag findet Doch vor
allem ist es Shakespeare, besonders Hamlet, mit
dem er sich nicht nur im Wilhelm Meister, sondern
bis zum Ende seines langen Lebens beschäftigt.
Theo Buck steckte den Zeithorizont für Goethes
Beziehungen zu Frankreich ab. Die wichtigsten
Stichworte sind dabei die Französische Revolution,
die er verabscheut und Napoleon, den er trotz seines
Despotismus bewundert sowie die Juli-Revolution
in Paris von 1830. Der französischen Kultur gegen-
über ist er von Jugend an aufgeschlossen, kommt
er doch damit schon in Kontakt durch die Einquar-
tierung des Comte de Thoranc 1758 in seinem
Elternhaus.
Seine Kenntnisse des Landes sind dagegen gering,
er kennt nur Lothringen durch die Campagne in
Frankreich von 1792 mit der Kanonade von Valmy.
Sein Frankreichbild basiert nahezu ausschließlich
auf Kenntnissen der französischen Literatur vom
16. bis 18. Jahrhundert. Vertraut ist er mit den Wer-
ken von Montaigne, Rabelais, Molière, Diderot und
Voltaire, liest jedoch kaum die französischen Ro-
mantiker.
In Weimar lebt er nach der Begegnung mit Napo-
leon (1808 in Erfurt) als Zaungast der Weltpolitik,
liest Le Globe und empfängt viele französische
Besucher, darunter Benjamin Constant, David
d'Angers, Victor Cousin u.a..
2016
Weltbürger Goethe
Die Existenzen fremder Menschen sind die besten
Spiegel, worin wir die unsrige erkennen können...
Dr. habil. Jochen Golz (Weimar)
Einführung
Der Weltbürger Goethe
Prof. Dr. Christof Wingertszahn (Düsseldorf)
Käme ich nach England hinüber,
so würde ich kein Fremder seyn…
Goethe und England
Prof. Dr. Theo Buck (Aachen)
Die Franzosen haben bisher immer den Ruhm
gehabt, die geistreichste Nation zu sein,
und sie verdienen es zu bleiben...
Goethes intensive Beschäftigung mit Frankreich
184
Michael Maurer un-
ternimmt den Versuch,
die Reise Goethes nach
Italien 1786 bis 1788
kulturgeschichtlich zu
verorten, indem er des-
sen große Vorläufer
mit ihren Reise-Wer-
ken einbezieht. Festzu-
stellen ist neben einem Formwandel von dem
enzyklopädischen Bericht (Johann Jacob Volk-
mann) hin zur subjektiv-literarischen Reisebe-
schreibung (Karl Philipp Moritz); gleichsam ein
Funktionswandel von der Kavalierstour hin zur mo-
dernen Bildungsreise.
Goethes Weg zur Selbstverwirklichung und Pers-
önlichkeitsbildung, den er in Italien beschreitet, sei
mit dem Kulturmuster einer Pilgerfahrt zu ver-
gleichen, die – ins Profan-Künstlerische gewendet
– ihr Heilsversprechen in dem klassisch-humanis-
tischen Bildungserlebnis findet, was die Reise bis
in die Gegenwart hinein interessant und nachah-
menswert erscheinen läßt.
Obgleich Goethe mehr Lebenszeit in Böhmen ver-
bringt als in Italien, ist das wissenschaftliche Inte-
resse ungleichgewichtig ausgeprägt, was wohl auch
dem Sachverhalt geschuldet ist, daß Goethe in Ita-
lien eine »Wiedergeburt« erlebt und sich von Rom
aus auf dem Weg zum (Weimarer) Klassiker macht.
Dabei sind seine so zahlreichen Aufenthalte in den
Böhmischen Bädern biographisch und geistesge-
schichtlich nicht weniger bedeutsam, bilden sie
doch für ihn – wie Uwe Hentschel herausarbeitet
– sowohl einen intellektuellen Marktplatz als auch
einen Rückzugsraum inmitten
einer sich verändernden Welt.
Im Unterschied zu den vielen
Bäder-Reisenden, die kaum
Interesse für die böhmische
Landschaft zeigen und in ihren
(wenigen) Reiseberichten vor
allem Vorurteile über deren
Bewohner zum Ausdruck brin-
gen, erweist sich gerade im
Vergleich zu diesen die beson-
dere Leistung des Böhmen-
Besuchers Goethe, der sich
mit der Kultur und Geschichte
des Landes eindringlich befaßt
und so zu einem der besten
deutschen Böhmen-Kenner
avanciert.
Manfred Osten sieht mehrere Übereinstimmungen
zwischen Goethes eigener Weltanschauung und der
fernöstlichen Philosophie. Bereits früh beschäftigt
er sich mit den wichtigsten Werken der konfuziani-
schen Klassik.
Insbesondere sind es die auf Harmonie und Mäßi-
gung zielenden Lehren und die Forderung, durch
ständige eigene Selbstvervollkommnung die Vo-
raussetzung für eine allgemeine Weltverbesserung
zu schaffen. Diese Geisteshaltung sucht Goethe zu
übernehmen und auch immer wieder in seinem
Spätwerk zu veranschaulichen, nicht zuletzt in
dem Gedichtzyklus Chinesisch deutsche Jahres-
und Tageszeiten. Im Lichte dieser von Osten
aufgezeigten Auf- und Übernahme konfuzia-
nischen Denkens setzt Ende des 19. Jahr-
hunderts im Zuge der Meiji-Restauration in
Fernost eine stürmische Goethe-Rezeption ein.
Prof. Dr. Michael Maurer (Jena)
Gewiss, man muß sich einen eigenen
Sinn machen, Rom zu sehen...
Kulturmuster Bildungsreise
– Goethe in Italien und die Folgen
Prof. Uwe Hentschel (Chemnitz)
Was sonst Jena für mich war,
soll künftig Carlsbad werden
Die böhmischen Bäder:
Refugium und intellektueller Marktplatz
Dr. Manfred Osten (Bonn)
Ich habe mir dieses wichtige Land aufgehoben,
um mich im Fall dahin zu flüchten..
Goethe, ein fernöstlicher Weltbürger
185
Volker Hesse lenkt via Powerpoint unseren Blick
im November auf Goethes Interesse an Süd-
amerika. Durch den Kontakt mit den Brüdern
Humboldt oder Johann Reinhold und Georg
Forster, die ihm 1783 ihre Dokumentation der
Reise nach Haiti schenken, wird Goethes Inte-
resse an fremden Ländern noch weiter bestärkt.
1794 trifft er sich mit Alexander von Humboldt
und Schiller in Jena zu einem intensiven Gedan-
kenaustausch über naturkundliche Fragen. Die
Entdeckungen der Naturforscher bestärken seine
Metamorphosen-Theorien, denn Morphologie
und Physiologie begegnen sich hier quasi in der
Mitte.
Humboldts Reiseberichte über Nord- und Süd-
amerika regen ihn an zu einem Entwurf einer
großen Ansicht der europäischen und der ameri-
kanischen Gebirge mit deutlicher Markierung der
Höhenunterschiede . Auch für die Werke anderer
zeitgenössischer Weltreisender interessiert er
sich, wie etwa die des Prinzen Maximilian zu
Wied-Neuwied und dessen Reise nach Brasilien
oder die von K. Ph. von Martius, der Goethe auch
in Weimar besucht. Weimar wird zu einem Zen-
trum des Interesses an Südamerika.
Hier diskutiert man z.B. bereits die Idee des
Panama-Kanals, lange bevor er 1914 tatsächlich
gebaut wird. Daniel Nees von Esenbeck, mit dem
Goethe ebenfalls in regem naturkundlichen Aus-
tausch steht, benennt 1823 sogar ein Malven-
gewächs nach ihm, die Goethea Cauliflora, den
Goethebaum, das Sinnbild ewiger Jugend und
freudiger Vergnügung.
Unsere wichtigste Quelle für Goethes Verständnis
des Koran sind neben den Gedichten aus dem
Divan – so Manfred Osten – besonders die dazu
gehörenden Noten und Abhandlungen. Seine Ur-
teile über das Furchtbare und die Vorzüge des
Islam entsprechen ganz der Ambivalenz seines
Denkens. Zu dem Furchtbaren gehört das Fehlen
der gebildeten Zustände und autonomen Lesers,
wird doch der Koran als unmittelbar von Gott
gegeben verstanden.
Hinzu kommen die versiegelte Sprache und die
Dominanz der mündlichen Überlieferung. Bei der
Verschriftlichung werden die fehlenden diakriti-
schen Zeichen im Arabischen und damit die man-
gelnde Eindeutigkeit zum Problem, das auch bis
heute andauert.
So gehört es z. B. zu den Reformleistungen
Kemal Atatürks in der Türkei, daß er die lateini-
sche Schrift einführte. Die Größe und Erhaben-
heit Gottes, wie sie sich im Koran ausdrückt, hat
Goethe sehr geschätzt.
Voltaires erfolgreiches Stück Mahomet von 1741
kann Goethe nur als Verunglimpfung verstehen.
Die deutsche Übersetzung des Diwan von
Schemsed-din Hafis, 1812/13 bei Cotta erschie-
nen, übt eine große Faszination auf ihn aus, ja er
fühlte sich sogar als dessen geistiger Zwillings-
bruder. Mit Hafis verbindet Goethe auch die
Nähe zur arabischen Mystik, dem Sufismus, der
unmittelbaren Erkenntnis Gottes, wie sie sich im
Bild von Gott atmen ausdrückt.
Prof. Dr Volker Hesse
Ich habe selbst ein Landschaftsbild phantasiert
Goethes Interesse an Südamerika
Dr. Manfred Osten (Bonn)
Der Koran ist streng, furchtbar und groß.
Zur Modernität von Goethes Islam-Verständnis
186
Das Thema »Flucht« bzw. »Flüchtlinge« durch-
zieht – so Michael Jaeger – Goethes gesamtes
literarisches Werk. So sieht er z. B. den raschen
Aufbruch nach Italien (1786) aus dieser Perspek-
tive. Angelehnt an das große Vorbild von Ovids
Tristitia stilisiert er das Ende der Italienischen
Reise ebenfalls als Flucht.
Ausdrücklich thematisiert aber werden die
Flüchtlinge im Epos Hermann und Dorothea
(1797). Hier erhalten die Gestalten durch das
Versmaß des Hexameters geradezu einen arche-
typischen Charakter. Wichtig wird das Thema
auch in Goethes Iphigenie in der Gestalt des
Orest. Der heilige Hain der Priesterin bietet dem
Flüchtling Schutz vor den Verfolgern.
Das Motiv des Schutzes im heiligen Hain ver-
wendet Goethe auch im Faust II. Die Erfahrun-
gen des Epochen- und Traditionsbruchs durch die
Französische Revolution und die beginnende In-
dustrialisierung finden sich hier in der Figur des
Wanderers und in dem Mord an Philemon und
Baucis sowie der Vernichtung ihrer Heimstatt.
Auch in den autobiographischen Schriften wie
der Campagne in Frankreich (1792) ist diese Vor-
stellung anzutreffen.
So berichtet Goethe, daß er, um der Lynchjustiz
Einhalt zu gebieten, nach der Eroberung von
Mainz den Platz vor dem Zelt des Herzogs zum
Heiligen Hain erklärt hatte. Damit wurde eine
formale Rechtssicherheit für die Flüchtenden her-
gestellt.
Der Ausdruck Weltliteratur ist – so Hendrik
Birus – eine der folgenreichsten Wortprägungen
des späten Goethe, die sich zunächst in der
deutschsprachigen Literaturwissenschaft rasch
durchsetzt. Für den damit angestrebten enzyklo-
pädischen Überblick über die verschiedensten
Literaturen der Welt hat Goethe selbst in seinen
Schriften zur Literatur ein beeindruckendes Bei-
spiel gegeben; denn deren Spannweite reicht von
den Literaturen des Nahen und Fernen Ostens
über die Klassische Antike und das Mittelalter bis
zu den zeitgenössischen europäischen National-
literaturen.
Sie werden ergänzt durch Goethes literarische
Übersetzungen nicht nur aus den gängigen euro-
päischen Sprachen, sondern auch aus dem Alten
Testament und dem Koran, der klassischen ara-
bischen Poesie und der Edda; ja schließlich durch
seine produktive Rezeption der persischen und
chinesischen Lyrik im West-östlichen Divan
(1819) und in den Chinesisch-deutschen Jahres-
und Tageszeiten (1829).
Diese Weltliteratur, d.h. Vermittlung und Aus-
tausch zwischen den Eliten, wie es Goethe in
Über Kunst und Altertum (1816) andeutet, unter-
scheidet sich deutlich von der ansteigenden Flut
der Tagesliteratur, die durch die zunehmende
Kommunikation immer schneller und weiter ver-
breitet wird.
Für die Aneignung der ausländischen Literatur
sind die Übersetzungen ein wichtiges Mittel, die
auch dem Austausch dienen. Für die fremde Li-
teratur prägt Goethe den Begriff das Ausheimi-
schen, der den bekannten des Einheimischen
ergänzen sollte. Eine neue Weltliteratur soll auch
die Nationen nach den fürchterlichsten Kriegen
wieder annähern.
PD Dr. Michael Jaeger (Berlin)
Vom Strudel der Zeit ergriffen
Goethes Flüchtlinge
Prof. Dr. Hendrik Birus (München)
...daß die von mir angerufene Weltliteratur auf mich,
wie auf den Zauberlehrling, zum ersäufen zuströmt.
Goethes Idee der Weltliteratur
187
2017
Dr. Manfred Osten (Bonn)
Gedenke zu leben, wage glücklich zu sein
Die Liebe Goethes Glücksgeheimnis.
Prof. Dr. Thorsten Valk (Weimar)
Als wären sie auf dieser Welt allein...
Erotische Rollenspiele in der Lyrik des jungen
Goethe
Prof. Dr. Uwe Hentschel (Chemnitz/Berlin)
Umfangend umfangen...
Zur Natur- und Liebesdichtung im Sturm u.Drang.
Detlef Schönewald (Berlin)
Wenn wir uns selbst fehlen, fehlt uns doch alles.
Der 'Werther'- ein Liebesversuch
Dr. Heike Spies (Düsseldorf)
Amor bleibet ein Schalck .. .
Verlobung und Hochzeit im Goethe- Umkreis
Beate Schubert
Mein Leben nur an Deinem hängt..
Goethes Briefe und Zettelgen an
Charlotte von Stein
.
Dr. Monika Estermann
Auch auf dem festen Land gibt es wohl Schiffbruch...
Die Wahlverwandtschafte ein lit. Experiment
Dr. Manfred Osten
Die Liebe im West-östlichen Divan
Wunderlichstes Buch der Bücher...
Prof. Dr. Dirk von Petersdorff
Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren
Die letzte Liebeserschütterung in der
Marienbader Elegie
Manfred Osten stellte den Begriff der
Liebe als ein allgemeines Lebensprinzip dar,
zu der auch die erotische Liebe zählt.
Leben und Liebe bilden einen engen
Zusammenhang, denn die Negation des
Lebens ist der Tod.
Da Goethe selbst bei seiner Geburt
zunächst für eine Totgeburt gehalten wurde,
fühlte er sich stets besonders dem Leben
zugewandt. Als Beispiel zitierte Osten das
nach dem Tod des Herzogs Karl
August in Dornburg entstandene
Gedicht An den aufgehenden
Vollmond vom 25.8.1828
Schlägt mein Herz auch
schmerzlich schneller, /
Überselig in die Nacht.
Für Goethes Zeit sah Osten
zwei Unglücksphänomene: Der
Französische Revolution und die
Industrialisierung. Beide führten
zur Negation des Lebens und
beförderten die Unfähigkeit im
Heute zu leben. Symptomatisch
war dafür die Sorge ein Faust II:
und verhungert in der Fülle. Die
beschleunigte Kommunikation
hatte die negative Folge, dass
sie auch die Mittelmäßigkeit
vorantrieb. Das Rettungsmittel aber war die
Liebe, etwa im Chor der Engel beim Tod
des Faust. Das höchste und beste Mittel zum
Leben ist jedoch die Begeisterung, da sie
schöpferisch ist.
Die frühen lyrischen Texte, die Goethe als
junger Student in Leipzig verfasste, so das
Buch Annette von 1767, wurden von der
Goetheforschung so Thorsten Valk lange
für unbedeutend gehalten und weitestgehend
ignoriert.
Die Gedichte entsprachen angesichts ihres
anakreontisch-erotischen Spielcharakters
nicht der Vorstellung der späteren
Erlebnislyrik und wurden deshalb
formal und moralisch als
Französelei abgelehnt. Dabei zeigten
diese Gedichte- so der Referent-
bereits Goethes großes Können, das
die Topoi der Rokokolyrik weit
hinter sich ließ. Valk konzentrierte
sich vor allem auf die Analyse der
beiden Fassungen des Gedichts
Triumph der Tugend.
In der zwoten Erzählung wurde die
Figur eines Beobachters mittels
eines verschwiegnen kalten Spiegels
eingeführt, damit sei bereits das
verbreitete Schema der Rokokolyrik
erweitert und der Rezeptionsvorgang
verändert, der Leser direkt in das
Rollenspiel einbezogen worden.
Im Unterschied zum vorhergehenden
Vortrag konnte jetzt, für die siebziger Jahre
des 18. Jahrhunderts, ein emphatischer
Naturbegriff, wie er in der Nachfolge
Rousseaus enstand, herausgearbeitet werden.
Er zeigte sich beispielsweise bei den Helden
Shakespeares, bei den edlen Wilden der
Südsee oder aber bei den Schweizer Hirten.
In Goethes Werther werden die
verschiedenen zivilisationskritischen
Vorstellungen besonders deutlich und
kompakt. Und auch in Goethes Mailied von
1771/1775, welches der Uwe Hentschel
neben den Ganymed-Gedicht heranzog,
konnte eine Abkehr
vom Rokoko und der
Gewinn einer neuen
Naturinnigkeit, der
Einheit von lyrischem
Ich und voller Welt,
festgestellt werden.
Im Sturm und Drang
entstand in der Abkehr
vom Rokoko eine
neue, wahrhaftige
Naturinnigkeit, die Verbindung von lyrischem
Ich und wahrem Ich , die sich wie der
Referent in einem Vergleich mit Texten von
Eichendorff und Rilke herausarbeitete in
der Moderne verloren hat.
Im ersten Teil seines Vortrags
stellt Detlef Schönewald den
literarischen und den biogra-
phischen Hintergrund von
Goethes zeitgenössischem
Briefroman dar: Goethes
Aufenthalt in Wetzlar 1772,
seine Liebe zu Lotte Buff
sowie seine Bekanntschaft mit Kestner u.a. Der
zweite Teil befaßte sich mit der
Figurenkonstellation der Roman-Protagonisten
Werther, Lotte und Albert. Werthers
Entwicklung, seine zerrissene Persönlichkeit,
Selbstmordgedanken und Naturbegeisterung, oft
wiederum durch Literatur vermittelt
(Klopstock!) sowie
sein Eskapismus
(Ossian) waren
Schwerpunkte des
Referats, die zur
Erklärung des
Scheiterns des
Liebesversuchs
angeführt wurden.
Der zweite Teil
fokussierte das
Problem der Figurenkonstellationen des
Romans: Werther, Lotte und Albert. Werthers
Entwicklung, seine zerrissene Persönlichkeit,
Selbstmordgedanken und Naturbegeisterung, oft
wiederum durch Literatur vermittelt
(Klopstock!) und sein Eskapismus (Ossian)
dienten als Erklärung für seine zögerliche
Annäherung an Lotte, das Scheitern des
Liebesversuchs sowie den Selbstmord der
Hauptfigur.
Ausgehend von der 13. Elegie und dem
Gedichte Der Bräutigam stellt Heike Spies
verschiedene Situationen in Goethes Leben vor,
in denen er die Rolle eines Bräutigams einnahm,
so etwa 1775 bei der Verlobung mit Lili
Schönemann. Über diese Situation sind wir vor
allem als der Perspektive des Alters, durch
Dichtung und Wahrheit informiert. 1788, als
Christiane in Weimar in Goethes Haus einzog,
verzichtete man auf alle Rituale, ebenso bei der
erst 18 Jahr später vollzogenen Hochzeit, die nur
in der Sakristei stattfand.
Amor, seine Pfeile und sein dämonisches Wesen
wurden schon früh in dem Gedicht Amor als
Landschaftsmaler
thematisiert, das Goethe
1787 in Rom unter dem
Einfluß des Malers
Philipp Hackert verfaßt
hatte. Das Thema
Verlobung und Hochzeit
findet sich auch in
anderen Werken, so dem
Epos Hermann und
Dorothea, wo rasch und
verantwortungsvoll, geradezu modern anmutend,
die Ehe vollzogen wurde, waren doch am Ende
des 18. Jahrhunderts lange Verlobungszeiten
nicht zuletzt auch aus wirtschaftlichen Gründen
noch üblich. Beispielsweise heiratete Eckermann
erst nach 11jähriger Verlobungszeit.
Beate Schubert skizziert die wechselvolle
Geschichte der 10-
jährigen Beziehung
Goethes im ersten
Weimarer Jahrzehnt
zu der sieben Jahre
älteren verheirateten
Charlotte von Stein
anhand einer
gezielten Auswahl aus den rund 1600 zumeist
hoch emotionalen Briefen, Zettelgen und
Gedichten, die Goethe seiner Lida bis zu seinem
Aufbruch nach Italien im September 1786 sandte
und die hier von dem
Schauspieler Christian
Schmidt gelesen
wurden. Goethes
Schreiben von
unterwegs aus Rom,
Neapel und Sizilien,
sind überwiegend in
lakonischem Ton abgefaßte Reiseberichte, die
auch für den restlichen Freundeskreis zur
Lektüre bestimmt waren, verdeutlichen die
Auflösung der Beziehung, ohne dies eindeutig
zu thematisieren. Die jeweiligen Stationen dieses
Liebesverhältnisses, das in die
Literaturgeschichte eingegangen ist,
veranschaulichte die Referentin mit über 100
Bildern einer Power-Point-Präsentation, die
verdeutlichten, daß es sich hier keineswegs um
eine verheimlichte Liaison handelte, sondern um
eine Beziehung, die vom Weimarer Hof ganz
offenkundig toleriert worden war. Der
Schauspieler Christian Schmidt las Goethes
Briefe und unser Mitglied, die Schauspielerin
Cora Chilcott die wenigen Briefzeugnisse
Charlottes, die sich zufällig erhalten haben.
Von den vielen Deutungsmöglichkeiten dieses
komplexen Romans wählt Monika Estermann
hier die Perspektive auf das
naturwissenschaftliche Experiment. Das
chemische Gleichnis und die Auswirkung der
magischen Anziehungskraft auf die Handlung
bildeten einen Schlüssel zum Verständnis der
Hauptpersonen. Goethe
nahm ja sogar in die
Sprache des Romans das
chemische Vokabular
seiner Zeit auf.
Die Anziehungskraft
beeinflußte auch die Art
ihrer Wahrnehmung, die
vom Wunschdenken und
der Selbsttäuschung
geprägt war.
Dem Hauptstrang wurden von der Referentin
die anderen wichtigen Themen, wie z. B. die
Natur und der Garten, untergeordnet, obwohl
auch hier ein enger Bezug besteht, z. B. bei den
Platanen zu Eduard und Ottilie. Die
Anziehungskraft konnte nur Ottilie durch ihren
Hungertod, die Auslöschung ihrer physischen
Natur, überwinden.
Manfred Osten nimmt
einige Stellen im Buch
der Liebe zum Anlaß, um
über das Thema der Liebe
bei Goethe
perspektivenreich zu
referieren. Im Zentrum
seines Vortrags stand
dabei die von beiden
verheirateten Beteiligten
ungewollte Entsagung und schließlich
Trennung, die Goethes Beziehung zu Marianne
von Willemer, der Suleika des Divan prägte.
Gemäß seiner Interpretation der Strophen:
Wunderlichstes Buch der Bücher, ist das Buch
der Liebe/Aufmerksam hab' ich's gelesen/ Wenig
Blätter Freuden/ Ganze Hefte Leiden. liefern sie
den Schlüssel zur
Auffassung Goethes
von der Liebe
schlechthin, die nur in
Zusammenhang mit
Schmerzen und Leiden
ihre eigentliche
Qualität entfalte. Wie
immer, wenn die
Beziehung ohne
Erfüllung zu bleiben
drohte, wurde Goethe,
um diese Leiden
ertragen zu können, auch hier wieder die
Dichtkunst zum Rettungsmittel .
Zu guter Letzt beglückte uns Dirk von
Petersdorff mit einer erfrischenden
Interpretation der Marienbader Elegie, deren
biographische Entstehungskomponenten die
leidenschaftliche Liebe
des 74-jährigen Dichters
zu der 17-jährigen Ulrike
von Levetzow er
keineswegs als tragische
Altersliebe sondern als
peinliche Verirrung
bezeichnete.
Die Elegie, von Goethe niedergeschrieben nach
dem Abschied unterwegs in einer Kutsche, wird
hier ebenso kenntnisreich wie prosaisch in ihre
Bestandteile zerlegt und offenbart mit ihren
Zeitsprüngen und Ortswechseln, räumlichen
Inkohärenzen und inhaltlichen Wiederholungen
seine Verzweiflung und innere chaotische
Verfassung. Das
Bekenntnis der
Schlußverse, diese
nicht erfüllbare Liebe
habe ihn zugrunde
gerichtet, erscheint auch hier erneut im
nachhinein als meisterliche poetische Bewältigung
und Aufarbeitung der Realität; mehrere Wochen
Katharsis und ernsthafte Herzschmerzen folgen,
danach beginnt er mit der Arbeit am Faust II.
2018
Goethe als Vordenker und Wegbereiter
Prof. Dr. Uwe Hentschel (Berlin/Chemnitz)
Moderne Klassik Klassik der Moderne?
Über die Aktualität von Goethes Werken
Dr. Manfred Osten (Bonn)
Bin ich der Flüchtling nicht, der Unbehauste
Goethe, ein Vordenker der Migrationskrisen des
21. Jahrhunderts
Prof. Dr. Olaf L. Müller (Berlin)
Mehr Licht !
Goethe als Naturwissenschaftler- eine Rehabilitation !
Prof. Dr. Bertram Schefold (Fft a.M.)
Ich muß mich um den Geldkurs bekümmern,
wechseln, bezahlen,schreiben,
anstatt daß ich sonst nur dachte, sann und diktierte..
Goethe und die moderne Wirtschaft
Prof. Dr. Uwe Hentschel (Berlin)
Der Trieb, das leben zu hegen und zu pflegen,
ist einem jeden unverwüstlich eingeboren
Goethes Stadtflucht oder warum
wir alle einen Kleingarten haben wollen
Podiumsdiskussion:
Dr. Manfred Osten (Bonn) und
Prof. Dr. Rüdiger Safranski (Badenweiler)
...wage es, glücklich zu sein
Das Glück bei Goethe oder
die Kunst des Überlebens
Podiumsdiskussion:
Dr. Sarah Wagenknecht (Berlin
Dr. Manfred Osten (Bonn)
und PD Dr. Michael Jaeger(Berlin)
auf freiem Grund mit freiem Volke stehn
Alptraum oder Utopie
Prof. Theo Buck (Aachen)
Ich werde sorgen, daß die Theile anmutig
und unterhalten sind und etwas
denken lassen
Goethe als Dramaturg des
modernen Theaters
Dr. Bernhard Fischer (Weimar)
Die Buchhändler sind alle des Teufels,
für sie muß es eine eigene Hölle geben.
Goethe und Cotta auf dem Weg
zum modernen Urheberrecht
Dr. Michael Jaeger (Berlin)
Raufebold, Habebald und Haltefest
Feuermaschinen Goethe und Marx
Eine moderne zivilisationskritische
Sicht auf die zeitgenössische
Wirklichkeit attestiert die
Literaturgeschichtsschreibung zwar
den Frühromantikern sowie den
Dichtern Kleist und Hölderlin, den
zeitgleich schreibenden Weimarer
Klassikern verweigert sie jedoch
abgesehen vom Spätwerk Goethes ebendieses
Zeugnis bis heute noch immer. Diesem Befund
begegne Uwe Hentschel, indem er sowohl
biographie- als auch werkbezogen den Nachweis
erbringt, daß auch Goethe und Schiller in der
Enklave Weimar/Jena von den gesellschaftlichen
Modernisierungsprozessen am Ende des 18.
Jahrhunderts betroffen gewesen sind und daß sie mit
ihren Texten auf diese inkommensurablen
Herausforderungen originär reagieren. Ob es sich
um abstrakte Wissenschaftsauffassungen, den
(freien) Buchmarkt, um großstädtische Lebenskultur
oder um sich beschleunigende Verkehrsformen
handelt, die Klassiker formulieren bemerkenswerte
Ansichten zu diesen auch heute noch
hochaktuellen Themen. Wenn man
die Modernitätserfahrungen der
Klassiker und deren
Bewältigungsstrategien zwischen
1794 und 1805 vor dem Hintergrund
unserer Wahrnehmung dieser
gesellschaftlichen Prozesse beleuchtet,
werden Berührungspunkte offenbar,
wo bisher Trennlinien verliefen.
In Goethes Beschäftigung mit dem
Migrationsthema - so Manfred Osten
- gibt es zwei imaginierte Ziele:
China, ablesbar an den Chinesisch-
deutsche Jahres-und Tageszeiten
(1829) und, weitaus markanter, der
Orient, wofür besonders der West-
östliche Divan (1819) steht. Die Noten
und Abhandlungen zu besserem
Verständnis des Divan zeigen sein
zwiespältiges Verhältnis zum Orient. Dafür steht
besonders die Bedeutung des Koran: Er ist dunkel,
verbietet jeden Zweifel und auch das europäische
Verständnis eines theo-philosophischen Werks ist
nicht möglich.
Goethes Beschäftigung mit dem Orient ist die Folge
der tiefen Erschütterungen, die die Französische und
die industrielle Revolution auslösen. Beide
verursachen Migrationsbewegungen, ja das
Schicksal der Emigration konnte jeden treffen. Vor
allem die industrielle Revolution beschleunigt die
Kommunikation und den Konsum, sie bewirkt eine
Zunahme des Verkehrs. Diese Themen finden sich
auch in Faust II. Dort stehen Philemon und Baucis
der neuen Beschleunigung im Wege und werden
ermordet. Goethes eigenes Erlebnis des terreur bei
der Belagerung von Mainz im Jahr 1793 wird für ihn
prägend und zum tief abstoßenden Beispiel des
Umsturzes. Die Folgen der Französischen
Revolution sind in Hermann und Dorothea
dargestellt. Ein Heilmittel bildet in dem Epos ein
neuer Begriff von Heimat, der Lieben und Nützen
impliziert. Als ein weiteres Heilmittel gegen das
Erlebnis des Chaos erweist sich das Gespräch, so in
den Ausgewanderten.
Als Dozent für Wissenschaftstheorie und
Naturphilosophie an der Humboldt Universität
beschäftigt sich Olaf. L. Müller speziell auch mit
Goethes Farbenlehre. Seine wissenschaftliche
Untersuchung dazu hat er bereits in dem 2015
erschienenen Buch Mehr Licht mit Newton im Streit
um die Farben.
publiziert.
Anhand von
Untersuchungsmodellen demonstriert er nun die
kritischen Aussagen zur Farbenlehre unter der
spezifischen Nutzung des wissenschaftlichen
Prüfaufbaus von Goethe.
In eindrucksvollen Farbdemonstrationen
veranschaulicht er, daß auch in empirischer
Rekonstruktion die Aussagen Goethes für sein
Untersuchungsmodell bestätigt werden können. Ein
didaktisch eindrucksvoller Vortrag, der aber
letztendlich die Newton´sche Auffassung der
Farbenlehre und des Lichtspektrums physikalisch
nicht relativieren kann. Gleichwohl erweckt er einen
hohen Respekt bei den Zuhörern, die vor allem auch
von den profunden wissenschaftlichen
Untersuchungsansätzen, die Goethe bei seinen
Untersuchungen zur Farblehre eingebracht hat
beeindruckt sind Leider wird die heute noch gültige
Goethische Farbenpsychologie nur am Rande
erwähnt. Insgesamt aber ein erfrischender und
vielfältiger naturwissenschaftlicher Vortrag, der zur
Anregung beiträgt..
Bertram Schefold gliedert seinen Vortrag nach
folgenden Punkten:
Goethe als tüchtiger Ökonom seine
Wirtschaftspraktische Leistung Geschäftssinn
Regierungsgeschäfte/ Einführung des ökonomischen
Denkens Goethes Aufnahme ökonomischer
Lehren Wirtschaftslehren
Im privaten Leben geht Goethe sehr haushälterisch
mit seinen Mitteln um und verzeichnet, wie auch
Christiane, alle Ausgaben
und Einnahmen in einem
(erhaltenen) Haushaltsbuch.
Das Gleiche gilt auch für
seine Regierungsgeschäfte
in Weimar, wo er sich um
die Verbesserung der
Gewerbe und ihrer Erträge
sowie um das Steuerwesen
kümmert, mit der Folge,
daß das kleine Herzogtum
einen sichtbaren
Aufschwung erlebt. Ausdrücklich thematisiert
werden wirtschaftliche Themen in Faust II, so die
Einführung des Papiergelds und die
Krisenanfälligkeit des Kapitalismus. Hier ist es
ausgerechnet der Narr, der als einziger seinen
Gewinn in sicherem Grundbesitz anlegt. Bei der
Vermarktung seiner Werke wie Hermann und
Dorothea, 1798 bei
Vieweg erschienen,
oder der Ausgabe
letzter Hand, 1826
bei Cotta, agiert er
mit einem verdeckten
Angebot, einer
sogenannten Vickrey-
Auction, um jeweils
die von ihm
geforderte, hohe Summe zu erhalten. Für die
Ausgabe letzter Hand erreicht er sogar den
urheberrechtlichen Schutz in allen Mitgliedsstaaten
des Deutschen Bundes.
Lange bewegt sich Goethe im wirtschaftlichen
Denken in den Formen des Kameralismus und
Physiokratismus des 18. Jahrhunderts. Aber
zunehmend entwickelt er auch Vorstellungen, die
dem aufkommenden Frühsozialismus des 19.
Jahrhunderts ähnlich sind. Er sieht durchaus die
Verschlechterung der sozialen Zustände angesichts
des Übergangs von der Heimarbeit zur
Maschinenproduktion, aber unterstützt die radikalen
Forderungen zu ihrer Veränderung nicht .
Wie auch bereits in seinem Einführungsvortrag
veranschaulicht uns Uwe Hentschel in
zahlreichen Beispielen das literarische und
gesellschaftshistorische Umfeld des jungen
Goethe und der in den 70 er Jahren durch
Rousseaus Briefromane ausgelösten Zurück zur
Natur-Bewegung. Der Vortrag kreist um das
Thema gärtnerische Tätigkeit, das gerade in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sowohl
lebensweltlich (u.a. Goethe, Wieland und
Schiller besitzen
Hausgärten) als auch
literarisch (u.a. in
Texten von Goethe,
Wezel und Merck)
bedeutsam wird.
Ausgangpunkt der
Darlegungen ist eine
kleine Sequenz aus
Goethes Leiden des jungen Werthers, in der der
Protagonist davon berichtet, wie er die simple
harmlose Wonne des Menschen genießt, der ein
Krauthaupt auf seinen Tisch bringt, welches er
selbst gepflanzt und geerntet hat. Diese auf den
ersten Blick belanglose Episode, erweist sich als ein
anschauliches Beispiel für eine unentfremdete
Tätigkeit. Im Verlaufe des Vortrages wurde den
gesellschaftlichen Ursachen nachgespürt, die bereits
im 18. Jahrhundert zu dem Verlangen führten, solche
einfachen Arbeiten als wünschenswert vorzustellen.
Bei einer abendlichen
Temperatur von 30 Grad
finden sich im nahezu
ausverkauften Kleistsaal
der Urania 285 Zuhörer
ein, in der Erwartung
Antworten zu erhalten auf die Frage : Ist Goethes
Leben in Wahrheit das Beispiel einer Überlebenskunst
und gibt es das überhaupt, ein Betriebsgeheimnis für
ein langes von Glück erfülltes Leben ? Und: Wie
hielt es Johann Wolfgang von Goethe, das wohl letzte
Universalgenie einer sich immer schneller
beschleunigenden Welt,
mit dem Kunstwerk des
Lebens?
Der launige
Schlagabtausch der
beiden Goetheexperten
bietet wohl jedem der
Goethe-Interessierten neues. Hier haben sich zwei
getroffen, die sich Zeit ihres Lebens mit dem Autor
Goethe und dessen Botschaft an die Welt beschäftigt
haben und wenn sie darüber gemeinsam kenntnisreich
und humoristisch plaudern können, dann tun sie das
nur zu gern und. Von derart geistreicher Fachsimpelei
fühlt sich ein jeder aus dem Auditorium
angesprochen; selbst wenn, er sich mit dem Dichter
vorher noch nicht so wirklich beschäftigt hat oder vor
Jahrzehnten dessen Jugendwerk Werther in der
Schule als Pflichtlektüre absolvieren mußte; nach
diesem Abend weiß er über Goethe erheblich mehr als
zuvor.
Rüdiger Safranski hat für
seine Biografie den
Untertitel Kunstwerk des
Lebens gewählt. Goethe
selbst sagte über dieses
Kunstwerk: Wohl kamst du
durch; so ging es allenfalls!
/ Machs einer nach und
breche nicht den Hals.
Manfred Osten zeigt
dagegen in seinem neuen
Buch über Goethe und das
Glück Gedenke zu leben!
Wage es glücklich zu
sein! jenen schwarzen
Verzweiflungshintergrund
vor dem dieses
Selbstbekenntnis neu
reflektiert werden sollte.
Laut Safranski beginnt für Goethe die Veränderung
bei sich selbst. Er will Autor des eigenen Lebens
sein, mit allen Sinnen sich und die Welt
wahrnehmen: Goethe ist der absolut wache Mensch.
Dagegen verbringen wir heute sechs Stunden täglich
in der vermittelnden Medienwelt und sind dort
permanent umzingelt von unendlich seichten
Appellen an unsere Aufmerksamkeit, etwa durch
Werbung: Wir sind ein Kampfplatz von Impulsen,
die unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.
Für Osten wird der
Mensch durch
Konsumlenkung
letztlich zum
Produkt; das
oberste Gebot
lautet stets: Du
sollst begehren. Er
verweist auf Nietzsche, der als die wichtigsten
Stimulanzien der Moderne das Brutale, das
Künstliche und das Idiotische ausgemacht hat.
Dabei schauen die Experten sowohl von der
Gegenwart in Goethe hinein als auch mit Goethe auf
die Gegenwart. Safranski hat da keine bestimmten
Techniken des Glücks im Blick, sondern spürt
Goethes diesbezügliches Betriebsgeheimnis in
dessen Wilhelm Meister auf. Dort heißt es, daß der
Mensch für einen begrenzten Kreis geschaffen sei,
in dem er sich auskenne, während für ihn im großen
Weiten die Gefahr bestehe, seine Mitte zu verlieren.
Safranski meint mit
Bezug auf Goethe: Es
ist doch das Allerbeste,
wenn der Mensch einen
solchen Weltbezug hat,
daß er sich bei dem,
was ihn angeht, durch
eigene Selbsttätigkeit
auch kompetent machen kann.
Sodann beschreibt Osten, wie hellsichtig Goethe
seine Zeit und die aufkommende Industrialisierung
mit der sie begleitenden Beschleunigung allen
Wirkens und Handelns als dem Glück
entgegenstehend verstanden hat: So wenig nun die
Dampfwagen zu dämpfen sind, so wenig ist dies
auch im Sittlichen möglich: die Lebhaftigkeit des
Handels, das
Durchrauschen des
Papiergeldes, das
Anschwellen der
Schulden, um Schulden
zu bezahlen, das alles
sind die ungeheuren
Elemente.
Geschrieben hat Goethe das 1825, aber es wird hier
eine Brücke zu uns ins 21. Jahrhundert geschlagen,
in dem sich scheinbar alles Glück und jedes Leben
optimieren läßt.
Für Osten hat der späte Goethe kulturpessimistisch
darüber nachgedacht, was die
Industrielle Revolution mit den
Menschen macht. Und zwar
aus Verzweiflungsanlässen
angesichts einer
extremistischen Vernunft, die
damals die Herrschaft
übernahm. Diese zeigte sich
etwa bei den exponentiellen
Beschleunigungen in den
Bereichen Produktion,
Konsum, Transportwesen und
ganz besonders
Kommunikation. Vor allem die
letzteren Veränderungen
empfand Goethe als unheilvoll. Im Begriff des
Veloziferischen mischen sich die Schnelligkeit
(velocitas) und das Teuflische (Luzifer). Durch die
Masse der Meinungen geraten die Menschen ohne
eigene Meinung in Selbstentfremdung.
Die Diskutanten sind sich einig darin, daß Goethe
nicht an die Machbarkeit von Geschichte glaubte.
Vielmehr spürte er, was auf ihn und die Menschen
zukam. Bei ihm weht ein Geist der Verteidigung
überkommener Lebensstile, der trotz aller
Veränderungen auf gelingendes Leben setzt. Die
Devise lautet demnach: Weltverbesserung durch
Selbstverbesserung. Dagegen repräsentiert Mephisto
den nun weitverbreiteten Alles-gratis-und-sofort-
Anspruch.
Diese galoppierende Entgrenzung überfordert die
neuronale, emotionale und physische Verfaßtheit
des Menschen. Osten mit Goethe: Der verständige
Mann müsse sich nur mäßigen, um glücklich zu sein.
Rettung erblickt Goethe vor allem in der Liebe, für
ihn das eigentliche Betriebsgeheimnis des Lebens.
Denn im Grunde sei der Mensch vom eigenen
Extremismus bedroht, von seinen dunklen Organen
und Affekten, die es durch gestaltete Sinnlichkeit zu
kultivieren gelte. Und dies geschehe in einer so
dynamischen wie vitalen Gleichgewichtsfindung,
die Goethe zwischen Lust an Grenzüberschreitung
und Rückbesinnung stets intensiv aufs Neue
anstrebt. Jeder Trost ist niederträchtig / Und
Verzweiflung nur ist Pflicht heißt es in einem
Versentwurf zum Faust.
Goethe selbst aber hat sich gegen Unglück und
Verzweiflung zur Wehr gesetzt und im Wilhelm
Meister dagegengehalten: Gedenke zu leben! Wage
es, glücklich zu sein! Manfred Osten zeigt, wie
Goethe sich zwischen diesen beiden extremen Polen
bewegt und wie er für sich Strategien und Wege
findet, glücklich zu sein. Wer glücklich sein will,
muß sich das erarbeiten, muß an sich arbeiten.
Goethe nannte dies das Übungsglück der Mäßigung.
Man hat mich immer als einen vom Glück besonders
Begünstigten gepriesen, so hat es der alte Goethe
seinem Eckermann erklärt: Allein im Grunde ist es
nichts als Mühe und Arbeit gewesen.
Die restliche Debatte beschäftigt sich mit den zehn
Überlebensregeln, die Manfred Osten bei Goethe
ausgemacht hat und die er in seinem Buch
zusammengestellt hat:
Lass die Vergangenheit hinter dir!
Lebensregel Nummer eins,
niedergeschrieben in der Zeitschrift
Chaos: Willst du dir ein gut Leben
zimmern/ Mußt ums Vergangene
dich nicht bekümmern.
Gelegentliche Verzweiflung ist
erlaubt, Vergessen aber ist Pflicht.
Mach die Augen auf!
Aufmerksamkeit ist das Leben! heißt
es in den Wanderjahren: Denn das
ist eben die Eigenschaft der wahren
Aufmerksamkeit, daß sie im Augenblick das Nichts
zu Allem macht. Augen auf also für die ewige Zier
der Welt, die gar nicht anders kann, als dem
Betrachter zu vermitteln, daß er Teil von ihr ist. Die
beste Methode übrigens: Die Zier gleich selbst
zeichnen.
Sei nicht ultra!
Vom Tempo der Moderne hat Goethe wenig
gehalten. Alles aber ... ist jetzt ultra , hat er geklagt
und den Dampfwagen genauso gemeint wie die
Zeitung und das Durchrauschen des Papiergeldes.
Ultra-Technik, Ultra-Kommunikation und Ultra-
Ökonomie aber schaffen nichts als Sorge. Die
herrlichste Kur dagegen? Goethe liest fünf Jahre
alte Zeitungen, aus denen nicht das Mindeste
abzuleiten war.
Mäßige dich!
Liebe ist prima, zu viel Leidenschaft nicht; der
Fluch der Natur will, glaubt Goethe, besiegt
werden, die Natur nämlich ist nicht auf Glück
geeicht. Der verständige Mann braucht sich nur zu
mäßigen, so ist er auch glücklich. Siehe
das Unglück des unmäßigen Faust.
Lass die Finger von der Religion!
Gott, so Goethe an den Freund Jacobi, hat
(dich) mit der Metaphysik gestraft und dir
einen Pfahl ins Fleisch gesetzt, mich
dagegen mit der Physik gesegnet, damit
mir es im Anschauen seiner Wercke wohl
werde. Goethe hat die Sonne und ihr
Licht verehrt, wodurch allein wir leben,
weben und sind, und alle Pflanzen und
Tiere mit uns.
Erzähl von deinem Glück!
Ausgerechnet einem Hofbeamten hat Goethe erklärt,
daß wir nur dadurch Menschen sind, daß wir
unseren Zuständen eine gewisse Folge zu geben
trachten. Das heißt: Man muß dem Leben den roten
Faden einer Glückserzählung einziehen, die das
Böse von sich stößt und das Gute fixiert. Das wahre
Glück ist selbst gemacht.
Ignorier den Rest!
Und wenn weder Achtsamkeit noch Autorschaft
noch die Verehrung des Augenblicks helfen? Dann
muß man das Übrige Gott überlassen.
Beerdigungen hat Goethe bekanntermaßen
grundsätzlich nicht besucht. Den Tod ... statuiere ich
nicht.
Lebhafter Applaus und interessierte Fragen aus dem
Publikum beenden einen gelungenen Abend.
395 Zuhörer
haben sich im
Humboldtsaal
der Urania
eingefunden,
darunter nicht
wenige, die
gespannt darauf
wartenden, wie
sich die Politikerin und Vorsitzende der LINKE-
Fraktion Sahra Wagenknecht bei diesem
anspruchsvollen Thema gegenüber den beiden
ausgewiesenen Faust-Experten Michael Jaeger und
Manfred Osten behaupten würde. Der Fausts
Schluß-Monolog im 5. Akt (Faust II) mit der Vision
auf freiem Grund mit freiem Volke stehn eröffnete
einen weiten Auslegungsspielraum, den die
Interpreten weidlich nutzten.
Was ist gemeint mit dem letzten Schluß der
Weisheit des greisen Faust, dieser Vision vom freien
Volk auf freiem Grund ?
Da Frau Wagenknecht- wie angekündigt- nach
einer guten halben Stunde vorzeitig zu einer ARD-
Live-Talk-Show
eilen muß, erhält
sie Gelegenheit,
ihren Standpunkt
gleich zu Beginn
ausführlich
darzulegen.
Zentraler Ausgangspunkt ist ihre Überzeugung, daß
der Schlußmonolog des 5. Aktes von Goethe
Altersdrama Faust II. in jedem Fall positiv und
zukunftsorientiert gelesen werden müsse.
Sie bezieht sich hierbei u.a. auf Goethes gründliche
Kenntnisse der Theorien der Frühsozialisten, die er
durch seine regelmäßige Lektüre der französischen
Zeitschrift Le Globe um 1830 gewonnen hat. Trotz
gewisser kritischer Anmerkungen habe er mehrfach
in Gesprächen und Briefen betont, daß es bei diesen,
den sogenannten Saint-Simonisten, um gescheite
Leute handele, die mit großer Sicherheit auf die
Fehler der damaligen Zeit aufmerksam gemacht
hätten, insbesondere auf die ungerechten
Eigentumsverhältnisse.
Daß Goethe sich in punkto Eigentum und Ökonomie
gut auskannte, beweise ja auch die Szene am Hofe
des Kaisers, in welcher der von Finanznöten
gebeutelte Marschalk klage: Wir wollen alle Tage
sparen und brauchen alle Tage mehr. Und täglich
wächst mir neue Pein.
Nach Frau Wagenknechts Überzeugung hätte
Goethe bereits vor Karl Marx erkannt, daß
Kapitalismus eben nicht nur Marktwirtschaft sei ,
nicht nur Tausch, sondern immer auch Raub
bedinge: Krieg, Handel und Piraterie sind für ihn
dreieinig und nicht zu trennen . Faust als
Wirtschaftsmächtiger brauche nicht allein Mephisto,
um seine Ziele zu verwirklichen, sondern auch die
drei gewaltigen Gesellen Habebald, Haltefest und
Eilebeute, die wesentlich zur Begründung seines
Weltbesitzes beitragen. Das entwerte Fausts
produktive Leistungen nicht, der technologische
Fortschritt sei real, aber er habe einen hohen Preis
einen unverantwortlich hohen Preis.
Ihrer Meinung nach könne es keinen Zweifel geben,
wie Goethes Urteil über einen Kapitalismus
ausgefallen wäre, in dem diese produktive Seite
mehr und mehr in den Hintergrund träte und
Renditejagd und Gier fast nur noch destruktiv
wirkten. Daß sie bei Goethe auch über den Faust
hinaus sattelfest ist, beweist sie durch den Hinweis
auf eine ihrer Meinung nach aufschlußreiche Stelle
in seinem Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre:
die Rede sei dort vom Eigentum im Sinne von
Gemeinsinn und Gemeinbesitz.
Nur kurz kann sie noch auf Zukunftsvision jener
französischen Frühsozialisten eingehen, deren
Emanzipationsprojekte Goethe gründlich studiert
habe und die bereits im Geiste einer geschichts-
philosophischen Dialektik für eine erbrechtliche
Umverteilung des Eigentums plädieren, muß sie
doch um kurz nach 20 Uhr bedauernd, vom
Publikum allerdings mit zustimmendem Applaus
bedacht, die Diskussion verlassen, um bereits eine
knappe Stunde später als Studiogast bei der Live-
Sendung Hart aber Fair Goethes Vorstellungen
vom Gemeinsinn, von Handel und Krieg oder doch
zumindest ihre Interpretation davon einem
Millionen-TV-Publikum darzulegen.
Da die beiden Faust-Experten nun unter sich sind,
entspinnt sich in der Folge eine mehr philosophisch
statt volkswirtschaftlich angelegter Debatte.
Zunächst greift Manfred
Osten den Hinweis seiner
Vorrednerin auf die Ideen der
Frühsozialisten auf, mit
deren Utopien sich Goethe in
seinen letzten Lebensjahren
auseinandergesetzt habe.
Goethe habe gewußt, wovon
er spreche, habe er doch bereits 1783 als
Finanzminister den Staatsbankrott des Herzogtums
Sachsen-Weimar abgewendet. Die hoch
aktuellen Versuchungen der Geldschöpfung
ohne Wertschöpfung seien ihm bereits durchaus
bekannt gewesen und er habe Marx
zur frühkapitalistischen Einsicht der Umwertung
aller Werte im Zeichen des Gelds verholfen.
Der junge Karl Marx habe sich nämlich, was wenig
bekannt sei, in seiner ökonomisch-philosophischen
Frühschrift von 1844 mit Goethes Faust
auseinandergesetzt und seine Überlegungen auf die
Verse bezogen:Was Henker! Freilich Hand und
Füße/Und Kopf und Hintre, die sind dein!
Doch alles, was ich frisch genieße,/Ist des drum
weniger mein?
Wenn ich sechs Hengste zahlen kann/Sind ihre
Kräfte nicht die meine?
Ich renne zu und bin ein rechter Mann/Als hätt ich
vierundzwanzig Beine
Das Geld, so zitiert Manfred Osten Karl
Marx, ist also der Gegenstand im eminenten
Besitz, indem es die Eigenschaft besitzt, alles
zu kaufen, alle Gegenstände sich anzueignen,
Die Universalität seiner Eigenschaft ist die
Allmacht seines Wesens; es gilt daher als
allmächtiges Wesen ...
Lange vor Karl Marx- so Osten- hätte Goethe
bereits das fatale Betriebsgeheimnis der
kapitalgetriebenen industriellen Revolution
erkannt: die Selbstentfremdung des Menschen
im Zeichen
seiner bis heute
andauernden
Unterwerfung
unter das
Profitdiktat der
Beschleunigung
aller Lebensbereiche. Goethes metaphorischen
Spiegelungen dieses Kollateralschadens des
Fortschritts im Zeichen von Geldschöpfung
ohne Wertschöpfung sei als Grundlage
anzusehen für den Prozeß der
Selbstentfremdung durch die absolute
Rangerhöhung des Kapitals in Zusammenhang
als Folge der erahnten Produktionsweise der
industriellen Revolution. Keiner kennt sich
mehr lautet sein Fazit.
Der Germanist Michael
Jaeger, seit zwei Jahrzehnten
und drei Büchern der derzeit
wohl kenntnisreichste Faust-
Exeget geht noch etwas
weiter, sieht er doch Fausts
letzte Worte vom Autor mit
tiefer Ironie formuliert und von Goethes
Hoffnungslosigkeit hinsichtlich seiner eigenen
Zeit geprägt.
Über sechzig Jahre nach
den ersten Konzepten für
ein Faustdrama, dessen
Protagonist bereits zu
Beginn auf der Suche
ist, nach dem, was die
Welt, im Innersten
zusammenhält schließt
Goethe am Ende seines
Lebens, die Arbeit am Faustmanuskript ab.
Die im zweiten
Tragödienteil noch
fehlenden Szenen habe
der Einundachtzigjährige
zwischen den
Sommermonaten der
Jahre1830 und Juli 1831
geschrieben, also
eindeutig vor dem
Hintergrund des Revolutionsjahres 1830. Diese
Tragödie, die am Vorabend der mit der
industriellen Revolution
anbrechenden modernen Welt
spielte, komme hier in den Blick.
Im Horizont dieses die Epoche
kennzeichnenden
fundamentalen Bruchs der
Überlieferung müsse man die
zuletzt geschriebenen
Faustszenen als dramatischen
Ausdruck der Krise des europäischen
Bewußtseins und als Zeugnis für die äußerste
Resignation des späten Goethe deuten.
Der Faust II sei- so Jaeger- eine Tragödie, die
den verzweifelten Weltabschied einer untergehenden
Kultur beschreibe, einer Kultur, die Goethe
bewahrenswert erschien. Vor seinem Ableben habe
er das Manuskript wohlweislich versiegelt, da er
davon ausging, daß seine Zeitgenossen diese sehr
ernsten Scherze wohl kaum verstehen würden; der
Faust II sei offenbar für spätere Generationen
geschrieben worden.
Daß viele Szenen heute im 21. Jahrhundert, in einer
Zeit, da alles im Umbruch erscheine, ebenso
verstanden würde, wie vor einem Jahrhundert nach
dem Ende 1. Weltkriegs zu Beginn der 20 er Jahre,
sei daher nur zu verständlich. Anhaltender Applaus
für eine hochkarätige Debatte und zahlreiche Fragen
aus dem Publikum rundeten den Abend erfreulich
ab.
Aufgrund einer schweren
Operation kann Theo Buck
seinen Vortrag nicht
persönlich vortragen, er
wird daher von Frau
Schubert verlesen.
Schon zu seinen Lebzeiten,
wie auch noch heute, waren und sind die
Meinungen über den Dramatiker Goethe
gegensätzlich, von manchem wurde und wird
sein theatralisches Talent sogar grundsätzlich in
Frage gestellt. Daß Goethe auch als Dramaturg
stets seiner Zeit voraus war, zeigt Theo Buck
exemplarisch auf an seinem Jugenddrama Götz
von Berlichingen. Tatsächlich habe Goethe damit
seinerzeit im deutschen Sprachraum eine
Bresche geschlagen für die offene Form, nämlich
die Auflösung der Einheit von Ort, Zeit und
Handlung.
Damit bahnt er-
erklärtermaßen nach dem
Vorbild der Dramen
Shakespeares- einem
realitätsbezogenen,
leidenschaftlichen,
kreativen, dynamischen
und subjektiven Drama
den Weg, das mit seiner
naturnahen Demonstrations-Energie den
Rezipienten zum produktiv kooperierenden Teil des
Ganzen macht. Das Drama um Götz entpuppte sich,
so gesehen, als Gesten-Tafel menschlicher
Unmenschlichkeiten. Goethes Wirkungsabsicht- so
Buck- war es keinesfalls, uns allein den biederen
deutschen AltvaterGötz vorzuführen, sondern in
erster Linie das Spiegelbild der ihn umgebenden
deformierten Gesellschaft.
Ein Jahrzehnt später vollzog Goethe mit der in
Weimar als Prosawerk
begonnenen Iphigenie eine
scheinbare Rückwendung zur
geschlossenen Form, doch in
Wahrheit stellte diese die
Herausbildung einer
kommunikativ ausgerichteten
Bewußtseins-Dramaturgie dar, wie
in der fünf Jahre später in Italien
als Versdrama vollendeten Iphigenie zum Ausdruck
kommt.
Das Publikum sollte, wie Goethe schon früh
forderte, nicht mehr eine fremde, meist theatralisch
zusammengeflickte Welt erleben, sondern
mitwirkend genießen.
Dieses Verfahren kommt schließlich im Faust II mit
seiner multiperspektivischen Totalität zu voller
Wirkung und dies führt zu einer förmlichen
Neubesinnung auf das Wesen des Theaters. Goethes
universale Bewußtseins-Inszenierung auf dem
Niveau des Faust
II , dessen
Protagonisten in
ihrem Handeln
zeitlos sind,
begründet hiermit
ein universales
Welttheater, das
jeder aufgeschlossene Betrachter unmittelbar auf
sich wirken lassen kann und das auch im 21.
Jahrhundert nichts von seiner Aktualität verloren
hat.
Zum allgemeinen Bedauern aber hat sich Prof.
Buck, der in den letzten zwei Jahrzehnten über ein
Dutzend Vorträge vor der GG-Berlin gehalten hat
und als einer unser beliebtesten Referenten galt,
nun von den Berlinern endgültig verabschiedet mit
Thoas Ausruf Lebt wohl ! aus Goethes Iphigenie.
Alle Anwesenden bedauern dies sehr.
Zu Goethes Lebzeiten beginnt langsam der
Wandel von der alten Praxis des ewigen
Verlagsrechts zum individuellen Recht des
Autors an seinem Werk. Diese Entwicklung
wird erst 1901 mit dem modernen
Urheberrecht abgeschlossen. Auch um 1800
waren die Autoren noch ständig von der Gefahr
des unrechtmäßigen Nachdrucks bedroht, für
die kein Honorar gezahlt wurde. Goethe war
mit seinen frühen Verlegern Göschen, Unger
u.a. aus verschiedenen Gründen (Druckfehler,
Nachdruck) nicht
zufrieden gewesen. Er
fand jedoch in Cotta, mit
dem er ab 1798 auf
Vermittlung Schillers
zusammenarbeitete,
einen geeigneten
Verleger.
Ihre gute Beziehung
basierte darauf, daß Cotta den Rechtscharakter
eines Verlagsverhältnisses auf der Basis der
Autorenrechte anerkannte, obwohl dies noch
keineswegs bestehendes Recht war.
Cotta geht auch auf alle
Wünsche Goethes
hinsichtlich der Gestaltung
ein, besonders bei der
Ausgabe letzter Hand . So
einigt man sich z.B. im
Vertrag von 1826 auf ein
Honorar von 60.000
Reichtalern bei 20.000 Subskribenten, weitere
20.000 sollen bei weiteren 10.000 Beziehern
folgen.
Die Ausgabe wird offenbar als eine Art
Nationaldenkmal verstanden, in Anerkenntniß
Ihrer um die deutsche Literatur erworbenen
Verdienste, wie Fürst Metternich an Goethe
schreibt. Sie wird deshalb ein einmaliger Fall
durch die Privilegien aller Mitglieder des
Deutschen Bundes bis 1867 geschützt .
Mit Feuermaschinen, den englischen
Dampfmaschinen, die das industrielle Zeitalter
eröffneten, wird Goethe erstmals 1790 bei seinem
Besuch des Bergwerks in Tarnowitz/Oberschlesien
bekannt. Der Einsatz der Feuermaschinen wird
tiefgreifende, wirtschaftliche und soziale
Veränderungen bewirken, auf die Goethe wie Karl
Marx in sehr unterschiedlicher Weise reagieren.
Der junge Karl Marx und der alte Goethe sind
beide Zeitgenossen der industriellen Revolution ,
die im ersten Drittel des 19.
Jahrhunderts weitreichende
gesellschaftliche Umwälzungen
mit sich bringt. Nicht zuletzt durch
die Verbesserung der
Dampfmaschinen,
werden die Themen
Industrie und
Transport zu einem untrennbaren
Bestandteil des täglichen Erlebens.
So erscheint bereits 16 Jahre nach
Goethes Tod das Kommunistische Manifest
(1848). Jaeger stellte die These vor, daß das
Manifest quasi als ein Kommentar zu Faust II
gelesen werden könne, treten doch hier erstmals
Arbeiter auf und wird von Ingenieursleistungen
berichtet.
Die Bedeutung des Themas unterstreicht Michael
Jaeger mit einem Blick auf seine Lehrtätigkeit an
der Peking- Universität. Die Goethe- und
besonders die Faust-Rezeption ist dort neben der
des Werthers sehr lebhaft. Auch der
Staatspräsident XI Jinping schätze Goethe. In
marxistischer Sicht, so bei der dort gezeigten
Ausstellung 200 Jahre Marx, markieren Goethe
und Marx zwei unterschiedliche Konstellationen
der Verbindung von Tradition und Moderne.
Bei Goethe aber werden die beiden Elemente
Ordnung und
Harmonie
besonders
bevorzugt.
Goethe
beschreibt
die neue Zeit
mit Begriffen
wie veloziferisch oder ultra, nach Marx bewirkt
indessen die Dampfmaschine größere
gesellschaftliche Veränderungen als die
Völkerwanderung oder die Kreuzzüge.
Die Verlierer sind dabei die Bourgeoisie und die
Handwerker, während das Proletariat die
revolutionäre Klasse bildet. Goethe ist hier
gegenteiliger Ansicht, wie etwa an den Amerika-
Projekt und den Plänen der Auswanderer in seinem
Altersroman Wilhelm Meisters Wanderjahre zu
sehen ist. Marx hat für solche Utopisten wie die (oft
gescheiterten) Siedlungsgründungen von
Handwerkern in den USA nur Hohn und Spott übrig.
Der Bourgeoisie kommt aber eine historische Rolle
im Modernisierungsprozeß zu. Goethe beschreibt
diesen komplizierten Prozeß kritisch mit dem Bild
des Hexenmeisters im Zauberlehrling oder im ersten
Akt von Faust II mit der Einführung des
Papiergelds.
Der Unterschied der beiden zeigt sich deutlich in der
Bewertung
der
Französischen
Revolution,
die Goethe
bekanntlich
als Hybris
ablehnt, denn
sie erzeuge nur eine Schädelstätte, aber kein
Golgatha mit Opfer und Erlösung für einen
Neuanfang. Für Goethe, der die Schriften der
Frühsozialisten studiert hat, ist sie die Folge einer
falschen Politik, für Marx ist die Revolution
unausweichlich und das einzige Mittel zur
gesellschaftlichen Veränderung.
Die Grenzen von Goethes Vorstellung vom
natürlichen, quasi an die Metamorphose der
Pflanzen angelehnten Gang der historischen
Entwicklungsprozesse zeigen sich aber deutlich im
5. Akt von Faust II in der Szene mit Philemon und
Baucis. Die beiden Alten, die dem Fortschritt der
Arbeiten im Wege stehen, werden auf brutale Weise
einfach ermordet. Die Metamorphose weicht der
Transformation. Jaegers sehr ideenreicher Vortrag
findet beim zahlreich erschienen Publikum ein
lebhaftes Echo.
2019 GOETHE-
Der Zeichner, Kunstkenner und Sammler
Beate Schubert (Einführung)
Das höchste Ziel der Kunst ist Schönheit
und ihre letzte Wirkung Gefühl der Anmut
Goethes Verhältnis zu den bildenden Künsten
Dr. Manfred Osten (Bonn)
wir sollten weniger sprechen und mehr zeichnen...
14.6.1809 Goethe zu Johann D. Falk
Einführung in Goethes Schule der Achtsamkeit
Dr. Petra Maisak (Bad Homburg)
Ich bin jetzt ganz Zeichner, habe Mut und Glück...
An Herder 5. Dezember
1772
Der junge Goethe und die bildenden Künste
Prof. Dr Norbert Christian Wolf (Salzburg)
Nicht von der Kunst in abstracto....
Goethes Kunstanschauung vom Sturm und Drang
bis zur Rückkehr aus Italien (1771- 1788)
Prof. Dr. Johannes Grave (Bielefeld)
wenn man auch hier historisch und stufenweise verfährt,
so kommt man mit Vergnügen zur richtigen Einsicht.
Ideal und Geschichte- Spannungen in Goethes
Kunstauffassung um 1800
Prof. Dr. Hermann Mildenberger (Weimar)
ein klarer Duft blaute Schatten....
Italienische Reise 2.April 1787
Goethes Weg zur Landschaft
Prof. Dr. Thorsten Valk (Weimar)
Daß wir uns bilden, ist die Hauptforderung
an Carl Jacob Ludwig Iken, 27.9.1827
Spannungsvolle Nähe- Goethe und die Kunst
der Romantik.
Prof. Dr. Stefan Matuschek (Jena)
Macht euch schnell von Fabeln frei!
Faust II, 3. Akt
Goethe Antike-Konzept in seiner
historischen Entwicklung
Dr. Robert Steegers (Bonn )
... wenn man künftig in das Büchlein von
guten Sitten auch ein Kapitel einschöbe,
wie man sich in Kunstsammlungen und
Museen zu betragen habe
Der Sammler Goethe im Spiegel
seiner Werke und seiner Zeit
Prof. Dr. Uwe Hentschel
(Berlin/Chemnitz)
Nun mag die Zeit des Bewahrens, wenn
auch zu spät, eintreten.
Goethe an
Friedrich Maximilian Klinger, 8.12.1811
(Autographen) Sammeln als
Leidenschaft.
Dr. Markus Bertsch (Hamburg)
Denken ist interessanter als Wissen,
aber nicht als Anschauen
Wirkung und Rezeption Goethes in
der zeitgenössischen Kunst
EINFÜHRUNG
Beate Schubert (Berlin)
Goethes Verhältnis zu den bildenden Künsten
Die Referentin versucht die ihr fast unmöglich
erscheinende Aufgabe zu lösen, in nur 60 Minuten
einen Überblick zu vermitteln über die Entwicklung
des Zeichners Goethe, seine allmähliche
Heranbildung zum Kunstkenner sowie seine- erst
in der zweiten Lebenshälfte einsetzende-
Entwicklung zum leidenschaftlichen Sammler.
Zunächst sucht sie die bereits im Elternhaus
einsetzenden Versuche des 15-jährigen zu
veranschaulichen, bei Ausflügen in die
Umgebung Frankfurts mit ersten, noch
recht ungelenken Bleistiftskizzen seine
Eindrücke
festzuhalten,
von denen nur
wenige Blätter
erhalten sind.
Bereits
eindrücklicher
dagegen die zahlreichen Leipziger
Genrezeichnungen aus dem Zeitraum
1765-68, die wenig bekannt sind, da sie im
Corpus der Goethezeichnungen von 1958
völlig verblaßt wiedergegeben, kaum die
Konturen erkennen lassen. Heute wieder
restauriert und digitalisiert, vermitteln sie
in ihrer Anschaulichkeit eine erstaunliche
Modernität
Hier etwa der in wenigen
Strichen skizzierte Kavalier
im Grase.
Ermutigt dazu, seinen
eigenen Stil zu entwickeln,
hat ihn sein damaliger Zeichenlehrer Adam Oeser, der- so
Goethe in Dichtung & Wahrheit- ein
Feind des Schnörkel- und
Muschelwesens und des ganzen
barocken Geschmacks war. Oeser
folgte in seinen Auftragsarbeiten
zunächst dem herrschenden barocken
Stil, strebte selbst aber einem neuen
klassizistischen Hochbilde zu,
entgegen der auf Effekte ausgerichteten, zeitgenössischen
Rokoko- Dekorationsmalerei
vertrat er zunehmend den
Gedanken der Dominanz des
Bildinhaltes vor der bloßen Form.
Oeser machte Goethe ferner mit
den Schriften seines Schülers
Johann Joachim Winckelmann
zur Formensprache der Antike
bekannt; beide Aspekte werden für
den Zeichner und Kunstkenner Goethe von nun an
bestimmend bleiben. Mit exemplarischen
einigen Bildbeispielen geht die Referentin
ein auf die Einflüsse seiner weiteren
Lehrer. Sein erstes Vorbild für die
Ausführung von Landschafts-Veduten
wird im ersten Weimarer Jahrzehnt
Georg Melchior Kraus , der Leiter der
dortigen Zeichenschule.
Hunderte von Handzeichnungen haben
sich aus dem ersten Weimarer Jahrzehnt erhalten,
die uns ein Bild vermitteln, was er da so
tut und treibt; vielfach sind es nur auf die Schnelle
verfertigte Skizzen, mit wenigen Strichen zeichnet er
verfallene Stollen,
Höhleneingänge, Bauernhütten, Hügel, Felsen,
Bäche; gerne bei ungewöhnlichem Licht.
Die Wartburg vor allem aber Moment aufnahmen jedoch
auch, etwa Brände auf den Dörfern, und immer wieder
das Ilmtal zu allen Jahres- und Tageszeiten, am liebsten
aber nachts bei Vollmond sowie die Entwicklung und
Umgestaltung des Weimarer Parks.
In den beiden Jahren der Italienischen Reise werden seine
prägenden Vorbilder Wilhelm Tischbein, der von Goethe
bewunderten Landschaftsmaler Jakob Philipp Hackert sowie
Christoph Heinrich Kniep der ihm in Sizilien die Kunst des
Aquarellierens beibringen soll.
Da der Kunstkenner Goethe,
der seine diesbezüglichen Einsichten im Lauf der Jahrzehnte
durch genaues Betrachten, intensives Studieren und
Vergleichen und mannigfaltige Lektüre gewinnt, ein weitere
Abende füllendes Thema ist, das nicht in einer halben
Stunden abgehandelt werden kann, beschränkt sich die
Referentin
im
Folgenden darauf, diese Kennerschaft
exemplarisch durch einige jener Kunstgegenstände zu
veranschaulichen, die Goethe etwa ab dem 25. Lebensjahr
zusammengetragen hat.
Der restliche Vortrag ist daher dem Sammler Goethe
gewidmet. Das Auditorium wird sodann mit einer derart
opulenten Bilderfülle aus Goethes Sammlungen konfrontiert,
daß es sich nach einer weiteren ¾ Stunde für zwar
kenntnismäßig hinsichtlich Goethes Sammlungen für
bereichert, aber eindeutig optisch überfordert erklärt.
Gottlob stehen ja noch ein Dutzend weiterer Vorträge aus.
Dr. Manfred Osten (Bonn)
Einführung in Goethes Schule der Achtsamkeit
Manfred Osten
zeichnet den Weg
von Goethes
Entwicklung als
Zeichner von
Dilettantismus
seiner frühen Jahre
bis zur Kennerschaft der späteren Zeit nach. Diese
Entwicklungslinie verband er mit seiner Theorie der
Achtsamkeit auf sich selbst und auf die Natur. Der Referent
hob sodann die positive Emotionalität und die Ausbildung
den jungen Goethe in Frankfurt hervor. Im Elternhaus am
Hirschgraben wurden bereits sein Interesse und sein
Gedächtnis geschult; Goethes Vater sei nach dem
Grundsatz verfahren : Zeichnen müsse jedermann lernen
und so habe der Sohn bereits von seinem ersten
Zeichenlehrer als 14-jähriger gelernt, genau hinzusehen
und auch die Details des Geschauten wahrzunehmen. Dazu
war vor allem das Zeichnen ein wichtiges Mittel, ebenso
wie ein weiterer Schritt, das Belehren der Organe, denn der
Verstand ist hochmütig. Die Kenntnis der Werke Spinozas
und seine Maxime: Deus sive natura, führte Goethe zur
tieferen Anschauung der Natur.
Der Referent zitiert sodann ein Gespräch Goethes 1816
in mit dem Kanzler von Müller, in dem der Dichter
bemerkt: Das Zeichnen entwickelt und nötigt zur
Aufmerksamkeit und ist ja doch die höchste aller
Tugenden und Fähigkeiten. Unter dem Aspekt der
Entwicklung von
Achtsamkeit stellt
Osten mehrere
Zeichnungen
Goethes vor, von
denen er meint,
einige seiner
Naturansichten
könne man sogar in
die Nähe von seinem Vorbild Rembrandt rücken, etwa
seinen Versuch dessen Landschaft mit Kahn
nachzuempfinden. Goethes eigene Versuche in der
Kunst des Abbildens - nahezu 1800 ausgeführte
Handzeichnungen - seien daher prägnante Beispiele für
seine Übungen in Achtsamkeit.
Im Corpus seiner Zeichnungen- so der Referent- habe
Goethe dokumentiert, wie es gelingen könnte, dem Menschen
und der Natur wieder zu ihrem Ansehen zu verhelfen.
Nämlich durch ständiges Üben und des Ansehens der
Phänomene anstelle von Theorien des ungeduldigen
Verstandes. Der Aspekt der Achtsamkeit äußerte sich auch
in der Hinwendung seiner Sammeltätigkeit z.B. auf Claude
Lorrain oder
Rembrandt.
Auch im Faust II
würde- so
Manfred Osten-
die immer
wieder erwähnte
Achtsamkeit in unterschiedlicher Weise thematisiert, etwa in
der Figur des Lynkaeus oder in der Gestalt der Sorge.
Dr. Petra Maisak (Bad Homburg)
Der junge Goethe und die bildenden Künste
Goethes literarische Begabung stand von Anfang an in
Konkurrenz mit seiner
Neigung zur bildenden
Kunst, besonders der
Malerei. Petra Maisak,
über drei Jahrzehnte
lang leitende Kustodin
im Frankfurter
Goethehaus am
Hirschgraben zitierte exemplarisch das Gedicht An den
Mond von 1777 und stellt ihm eine entsprechende
Zeichnung aus dieser Zeit, mit der gefühlten Form und
lockeren Abbreviaturen gegenüber. Goethe hatte in
Frankfurt eine gute Ausbildung erhalten, in Leipzig
studierte er- wie erwähnt- bei Oeser, in Mannheim
wurde der Antikensaal mit den vielen Gipsabgüssen zu
Maß und Form für die Zeichenkunst. Die Phase des
Sturm und Drang mit Gedichten wie Maifest wurde von
eigenen Zeichnungen begleitet; etliche finden sich auch
in seinen Briefen. Die Versuche in der Ölmalerei aber
scheiterten. Auf der Reise in die Schweiz mit den
Brüdern Stolberg (1775) setzten ihn die
Naturphänomene in
atemloses Staunen,
seine Kunst aber
geriet bei der
Wiedergabe der
Eindrücke an ihre
Grenzen.
Die Gruppe erreichte
Italien aber nicht, es
gab nur das Bild
Scheideblick nach
Italien. Einen
besonderen Raum
nahmen Goethes
Zeichnungen von
Personen ein. In diese Zeit gehörten aber auch die Bilder
zu Themen aus seiner Umwelt, so seines eigenen Hauses
in Weimar oder von Landschaften im Nebel mit
einfachen Linien auf blauem Papier. Das Zeichnen war
ihm ein existentielles Bedürfnis, auch um manchmal ein
Bild in ein Gedicht zu verwandeln. Er verzichtete in
dieser Phase aber noch auf Kolorit, dies kam erst nach
seinem Italienbesuch auf.
Prof. Dr. Norbert Wolf Goethes Kunstanschauung vom
Sturm und Drang bis zur Rückkehr aus Italien
Der Referent entwarf ein großes
Panorama des geistigen Umfeldes
sowohl des stürmenden, drängenden
jungen Goethe als auch des klassischen
Goethe nach seiner italienischen Reise.
Zum Ausgangspunkt seiner
Darstellungen nahm er Goethes Rede
Zum Shakespeares-Tag, deren Verfasser zum Zeitpunkt
der Niederschrift gerade 22 Jahre alt war. Für Wolf wird
er damit zum Protagonisten und mit seinen Schriften zum
Motor der Entwicklung von einer auf ihre moralische
Wirkung auf die Gesellschaft bedachten Wirkungsästhetik
hin zu einer genialischen Produktionsästhetik, die eine
außerliterarische Legitimation der Literatur für obsolet
erklärt und die in der Literaturgeschichte den Namen
Sturm und Drang erhalten hat.
Spätestens hier wurde allerdings deutlich, daß der
Vortragende im wesentlichen aus seiner unlängst
erschienenen, 5oo Seiten umfassenden Publikation
Streitbare Ästhetik zitierte, welche auf seiner am Institut
für deutsche Philologie der
Freien Universität
erschienenen
Habilitationsschrift fußte.
Der Rezension ist zu
entnehmen: Die Studie
bemühe sich
um eine
Rekonstruktion des
ästhetischen Denkens
Goethes bis zur Weimarer
Klassik. Im Untersuchungsgebiet zeichnen sich schon
sehr früh Tendenzen zur Autonomisierung der Kunst-
und Literaturtheorie ab. Seine paradigmatischen
theoretischen Schriften werden einer intertextuellen
Mikroanalyse unterzogen und zugleich sowohl mit den
unmittelbaren Entstehungsumständen und
künstlerischen Bezugspunkten, als auch v.a. mit ihren
europäischen Kontexten in Beziehung gesetzt. Das Buch
lege in seinen beiden Hauptteilen jeweils einen
Querschnitt durch den ideengeschichtlichen Kontext der
theoretischen Texte Goethes um 1771/72 und 1788/89.
Anstatt Goethes Einzigartigkeit zu postulieren, gelinge
es Wolf vielmehr aufzuzeigen, wie sehr Goethes
Positionen von dessen geistigem und literarischem
Umfeld abhängen und sich mit dem Wandel des
Umfeldes ebenfalls wandeln mußten.
Prof. Dr. Johannes Grave (Bielefeld)
Spannungen in Goethes Kunstauffassung um 1800
Zum Ausgangspunkt seiner Betrachtung nimmt der
Johannes Grave die Goethesche Gratwanderung
zwischen sinnlicher Anschauung konkreter Kunstwerke
und kunsttheoretischer, normativer Systembildung.
Zunächst gibt er noch einmal
einen strukturierten Überblick
über Goethes zeichnerische
Tätigkeit (mehr als 2500
Handzeichnungen von ihm
sind erhalten),
widmet sich sodann aber in
der Hauptsache seiner
Grafiksammlung, die im
Laufe der Jahrzehnte auf
9179 Druckblätter und 2512
Handzeichnungen heranwächst.
Durch zahlreiche Bildbeispiele veranschaulicht der
Referent sodann, wie sehr Goethe, trotz eines vehementen
klassizistischen
Intermezzos im
Gefolge der
Italienreise, seinen
in der Frankfurter
Jugend und
während seiner
Leipziger
Studienzeit
entwickelten und in
der eigenen zeichnerischen Tätigkeit kultivierten
Neigungen treu bleibt.
Er zeigt auf- hiermit dem immer wiederholten Klischee
vom Weimarer Olympier und deutschen Klassiker
widersprechend- mit welcher Intensität Goethe auch in
der zweiten Lebenshälfte- trotz
seiner erklärten Vorliebe für Klassik
und Antike- weiterhin systematisch
Blätter von Albrecht Dürer und
anderen Altdeutschen sammelte,
wobei sich nicht zuletzt sein
Augenmerk auf die Besonderheiten
der Drucktechniken und der
unterschiedlichen Abzugsqualitäten konzentrierten.
Chronologisch demonstriert er
Goethes Entwicklung als
Sammler von Druckgrafiken
und Zeichnungen.
Bereits 1780 beginnt Goethe in
Weimar mit dem Aufbau seiner
einschlägigen Kollektion. Ab
1805 erfolgt die konsequente
Neuordnung der Sammlung
nach Schulen, ab 1814
strukturiert er sie dann konsequent um nach chronologisch
gereihten Künstlern. Die Zuhörer wurden auf diese Weise
in die Lage versetzt, Goethes Konzepte anhand des immer
wieder umgruppierten Sammlungsbestandes- dessen
Aufbau durchaus auch von so profanen Dingen wie
Sparsamkeit und Schnäppchenjagd pointiert war- Schritt
für Schritt nachzuvollziehen:
Seine Sammlung sollte leben, also sich ständig erweitern und
verändern können. Als Quintessenz seiner Haltung äußert er
Kanzler von Müller gegenüber 1830: Ich habe nicht nach
Laune und Willkür, sondern jedes Mal mit Plan und Absicht
zu meiner eigenen
folgerechten
Bildung (...)
gesammelt und
an jedem Stück
meines Besitzes
etwas gelernt.
Prof. Dr. Hermann Mildenberger (Weimar)
Goethes Weg zur Landschaft
Hermann Mildenberger, Leiter der
Graphischen Sammlung in Weimar
berichtete über Goethes Tätigkeit auf
diesem Feld. Von Goethes ca. 2.600
erhaltenen Zeichnungen werden dort
an die 2.000 aufbewahrt. Goethe
baute die Sammlung durch Ankäufe
von Nachlässen auf, ebenso aber durch Ankäufe auf dem
Kunstmarkt. Hierbei hatte er bereits in Frankfurt
Erfahrungen gesammelt, denn die Stadt war damals der
Mittelpunkt des deutschen Kunsthandles.
Zu den Ankäufen gehörten die Werke älterer Künstler
wie etwa Rembrandt oder Claude Lorrain, dessen
Blätter mit Landschaftsdarstellungen fälschlicherweise
ursprünglich Adam Elsheimer zugeschrieben wurden.
Hinzu kommen z.B. Werke
von Antoine Watteau, seine
Zeichnungen mit zwei
Tänzerinnen von höchster
Qualität. Von den
Zeitgenossen wurden
Gemälde und Zeichnungen
von Caspar David
Friedrich erworben, ebenso
von Philipp Otto Runge
oder Angelika Kaufmann,
die Goethe ja auch bei
seinem Aufenthalt in Rom getroffen hatte. Goethe war
für diese Tätigkeit bestens vorbereitet durch den frühen
Unterricht, den er in Frankfurt bei verschiedenen Malern
genossen hatte oder auch seine Studien in Leipzig. Er
fand seinen eigenen Weg bei der Brockenreise von 1777
mit Zeichnungen von Nachtstücken auf blauem Papier
mit Aussparungen und
Fragmentierungen.
In Rom ist es zunächst Johann
Heinrich Tischbein, der ihn
zunächst fördert, zu dem sich aber
das
Verhältnis
bald eintrübte. In Süditalien wird
Jakob Philipp Hackert von
großer Bedeutung für ihn, ja,
Goethe sieht sich zeitweilig
sogar als sein Schüler an. Neben
Experimenten mit der camera
obscura bei der Landschaftsdarstellung waren es
besonders die Wolkenbilder, die ihn faszinierten.
Mildenberger sah sie sogar in Korrespondenz der
Bereiche Poesie und Landschaft. Auch nach der
Italienischen Reise ist Goethe als Zeichner tätig. Bei
allen seinen Arbeiten aber blieb er selbst sein schärfster
Kritiker.
Prof. Dr. Thorsten Valk- Spannungsvolle Nähe.
Goethe und die Kunst der Romantik.
Es gehört zu den Grundannahmen der germanistischen
Forschung, die Positionen der Weimarer Klassiker und
der Romantiker als stark divergierend auszuweisen,
nicht selten wird von einer unüberbrückbaren
Meinungsfeindschaft gesprochen. Thorsten Valk
unternimmt in seinem Vortrag den Versuch, die These
von der Unvereinbarkeit der Ansichten ein Stück weit in
Frage zu stellen; er möchte von einer- wie es im Titel
seines Vortrages heißt- spannungsvollen Nähe
sprechen.
Es gibt zahlreiche Themen, die
Goethe und die Romantiker
gleichermaßen interessieren;
beispielhaft genannt werden der
Maler Raffael, später dann die
mittelalterliche Bildkunst, wie
sie im Umfeld des Heidelberger
Kunstfreundes Sulpiz Boisserée
gesammelt wurde, oder die
gotische Architektur- für die
sich Goethe schon in jungen Jahren in Straßburg
begeisterte. Valk kann nachweisen, daß bei aller Kritik,
die Goethe dem religiösen Schwärmertum der Romantiker
entgegenbrachte, er doch deren künstlerische
Entwicklung, insbesondere die der Maler Caspar David
Friedrich und Philipp Otto Runge, aufmerksam verfolgt.
Als dieser ihm seinen Zeiten-Zyklus 1805 nach Weimar
schickte, blieb Goethe skeptisch. Er attestierte ihm zwar-
so der Referent- eine Vollendung, die man bewundern,
müsse, doch wünschte Goethe sich, daß die Kunst im
ganzen einen anderen
Weg nehmen werde.
Bringt er den
anfänglichen
Landschaftsbildern
Friedrichs noch
Wohlwollen entgegen
und veranlaßt sogar den
Weimarer Hof, mehrere seiner Werke anzukaufen, so
reagiert auf das Gemälde Morgennebel im Gebirge mit
unverhohlener Ablehnung. Als Friedrich 1811 seine
Winterlandschaft mit weiteren Ölgemälden nach Weimar
schickt, weigert sich Goethe, sich der Schwermut dieser
finsteren Naturräume auszusetzen, die auch den
Betrachter des Bildes ergreift. Ebenso entschieden
opponiert er gegen dessen im Zeichen des Todes stehende
Ruinen- und
Kirchhofbilder.
Seine wohl
schärfste Kritik an
einem Romantiker
-Motiv, dem
Gemälde des
jungen Malers
Carl Friedrich Lessing , betitelt Klosterhof im Schnee hat
sich erhalten: Zuerst also die erstorbene Natur,
Winterlandschaft; den Winter statuiere ich nicht; dann
Mönche, Flüchtlinge aus dem Leben, lebendig
Begrabene; Mönche statuiere ich nicht; dann ein Kloster,
zwar ein verfallenes, allein Klöster statuiere ich nicht;
und nun zuletzt, nun vollends noch ein Toter, eine Leiche;
den Tod aber statuiere ich nicht.
Diese strikte, kompromisslose Ablehnung gegenüber allen
Darstellungen von Erstarrtem und Lebensfeindlichen,
insbesondere abgestorbener Natur wird er bis an sein
Lebensende beibehalten. Valks Vortrag entspricht
vollständig seinem Aufsatz Glaubenswelten, der in dem in
diesem Jahr erschienen Katalogband zur Bonner
Ausstellung Goethe, Verwandlung der Welt nachgelesen
werden kann.
Prof. Dr. Stefan Matuschek- Goethe Antike-Konzept
in seiner historischen Entwicklung
Ausnahmend gut besucht ist der
Vortrag Stefan Matuschek, dem neuen
Präsidenten der Goethe Gesellschaft
Weimar e.V. Der Referent konzentriert
sich in seinem Vortrag auf einen
Teilaspekt der Antike-Rezeption von
Goethe, wenn er sich ausschließlich auf
dessen Aneignung der antiken Mythologie bezieht.
Indem Goethe sich immer wieder in seinen Texten die
griechischen und römischen Mythen zueignet, diese
seinen poetischen Vorstellungen gemäß aufbereitet,
entspricht er so ganz dem
Bedürfnis der Zeit um 1800, der
rational-abstrakten Moderne mit
einer Neuen Mythologie
(Friedrich Schlegel) zu
begegnen, in der neues Denken
anschaulich und bildereich
vergegenständlicht werden
kann. Goethe spielt virtuos mit
dem überkommenen mythologischen Bild-Reservoir.
Matuschek zeigt dies paradigmatisch an der
Prometheus-Ode, dem Schauspiel Iphigenie auf Tauris
und an den Helena-Szenen im Faust II auf, wobei die
These vertreten wird, daß Goethe im Verlaufe seines
Schaffens umfassender und kreativer aus dem
überkommenen Musterkatalog neue Mythologie-Ideen
entwickelt hat, was sich insbesondere in verschiedenen
Szenen im Faust II zeige.
Da der Referent die Antike auf ihren Mythos reduziert,
unterbleiben die von den Zuhörern erwarteten
Ausführungen z. B. zur Rezeption antiker Kunst und
Architektur; wäre deren Aneignung durch Goethe
thematisiert worden, hätten sich deutlicher noch
Grundzüge seiner kunsthistorischen Entwicklung
herausarbeiten lassen.
Dr. Rober Steegers
Der Sammler Goethe im Spiegel seiner Werke und
seiner Zeit
Dem Thema Der Sammler Goethe im Spiegel seiner
Werke und seiner Zeit nähert sich Robert Steegers in
konzentrischen Kreisen. Zunächst einmal ein vertiefter
Blick auf Goethes Sammlungen: Er hinterließ 1832
Manuskripte, die heute 341 Kästen füllen, eine
Sammlung von 17800
Steinen, mehr als 9000
Blätter Graphik, etwa
4500 Gemmenabgüsse,
8000 Bücher, des
weiteren umfangreiche
naturwissenschaftliche Sammlungen, ferner zahlreiche
Gemälde und Plastiken. Neben den 9000
Druckgraphiken stehen mehr als 2300
Handzeichnungen, rund 50 Gemälde, mehrere tausend
Abgüsse antiker Gemmen, figürliche Bronzen vom alten
Ägypten bis zu Objekten aus dem
frühen 19. Jahrhundert14, rund 100
Majoliken, denen in Goethes
Wohnhaus ein ganzes Zimmer
gewidmet war. Der 1848 von
Christian Schuchardt vorgelegte
zweibändige Katalog Goethes
Kunstsammlungen verzeichnet aus
dem Nachlass des Dichters
imposante 26.000 Objekte.
Sodann erfahren wir: Wie wurde zur Goethezeit
gesammelt? Von wem? Und für wen? Welche
Sammlungen waren bedeutend? Welche hat Goethe
selbst gekannt und welche waren für seine eigene
Sammeltätigkeit prägend? Schließlich der Blick in
Goethes Werke: Wie spiegelt sich der Sammler Goethe,
wie spiegeln sich seine Sammlungen in seinen Werken,
und insbesondere natürlich in den literarischen?
Der Referent weist darauf hin, daß in der Weimarer
Ausgabe der Werke- incl. der Briefe- die Begriffe
Sammlung(en) und sammeln über 1560 Erwähnungen
finden.
In seiner Schrift Der
Sammler und die
Seinigen reflektiert
Goethe über
verschiedene Wege,
sich der Kunst zu
nähern. In diesem
kleinen, auf Kunst sich beziehenden Roman wirft Goethe
einen Blick auf Sammlungen und die
Sammelpraxis seiner Zeit. Der Zweck
des unermüdlichen Zusammentragens
von ungewöhnlichen und
interessanten Objekten ist jedenfalls
für ihn klar bestimmt: Er braucht die
Anschauung, den unmittelbaren
Umgang mit den Gegenständen, die
ihn zur Auseinandersetzung anregen.
Davon zeugen seine
Sammlungen zur Kunst
und zu den
Naturwissenschaften,
ohne die viele seiner
Schriften nicht denkbar
gewesen wären, ebenso
wie die heute weitgehend in ihrer Substanz noch
erhaltenen Sammlungen in Weimar und Jena, deren Auf-
und Ausbau er in seiner amtlichen Tätigkeit vorantrieb.
Nicht zuletzt ist Goethe ein Menschen-Sammler, der um
sich und sein Haus, besonders in den letzten
Lebensjahrzehnten, einen Kreis von Mitarbeitern
versammelt, die Anteil an seiner Arbeit nehmen.
Prof. Dr. Uwe Hentschel- (Autographen) Sammeln
als Leidenschaft.
Ausschlaggebend für Goethes Entschluß, eine
Sammlung von Autographen anzulegen, ist eine
Sendung von 30 Handschriften aus der Hinterlassen-
schaft des Dichters Johann Friedrich Gleim, die er 1805
erhält. Wenig später w
endet er sich an seinen Verleger
Johann Friedrich Cotta mit der
Bitte, dieser möge ihn bei der
Beschaffung weiterer Zeugnisse
unterstützen, wobei er ihm
gleich einen konkreten
Vorschlag unterbreitet: Sie
könnten mir (...) eine besondere
Gefälligkeit erzeigen, wenn Sie
ein Stammbuch (...) anschafften
und die würdigen Männer um sich her um die
Einzeichnung eines freundlichen Wortes und ihrer
Namens Unterschrift in meinem Namen ersuchten. Uwe
Hentschel zeigt, mit welcher Begeisterung Goethe von
nun an Handschriften
sammelt; zu diesem
Zweck läßt er sogar 1811
einen zweiseitigen
Handzettel drucken und
verteilen. Auf ihm
vermerkt er die bereits vorliegenden Autographen und
fordert seine Zeitgenossen auf, ihm weitere zukommen
zu lassen. Auf diese Weise kann Goethe seine
Sammlung in kurzer Zeit vergrößern. Die Handschriften
ihm bekannter und befreundeter Persönlichkeiten sind
von großem auratischen Wert für Goethe, denn mit ihrer
Hilfe vermag er es, sich die in der Ferne Lebenden und
die bereits
Verstorbenen zu
vergegenwärtigen;
er meint sogar, von
den Handschriften
ließe sich auf den
Charakter des
Schreibers
schließen. Im
Zusammenhang mit
dem Sammel
n von
Autographen
verwies der Referent
darauf, welche Bedeutung für Goethe das Sammeln und
Bewahren grundsätzlich einnahm. Es ist kein Zufall, daß
diese Leidenschaft für das Überkommene in dem
Moment wächst, als Goethe um 1805, nach einer
lebensbedrohlichen Krankheit, dem Tode Schillers und
dem Ende des Römischen Reichs deutscher Nation spürt,
daß- in Zeiten des Verlustes und der Umbrüche- das
Alte bewahrt werden müsse. Dieses Verlangen steigert
sich in dem Maße, wie modernes Leben, das allein auf
einen akzelerierten Fortschritt setzte, verstärkt um sich
griff
.
Dr. Markus Bertsch (Hamburg)
Wirkung und Rezeption Goethes in der
zeitgenössischen Kunst
Bei seiner Darstellung
von Goethes Wirkung
auf die Kunst der
Zeitgenossen, betont
Markus Bertsch, dass
dieser bekanntlich ein
Augenmensch war, der
sich durch das bildhafte
Sehen die Welt erschloß.
Die neuen Buchmedien
der Zeit wie Almanache
und Taschenbücher
erforderten Bildbeigaben und Goethe war überzeugt, daß
diese sich positiv auf sein Werk ausgewirkten.
Umgekehrt galten Dichtungen als wichtigste
Inspirationsquelle für die bildenden Künstler. Diese
konnten allerdings nur selektiv verfahren und lediglich
eine Auswahl der Motive zeigen, auch ist dabei der Grad
der Textnähe bei den Bildmotiven sehr unterschiedlich.
Die Rezeption des zu veranschaulichenden Werkes, die
Illustrationen in Büchern ebenso wie ein eigenständiges
Gemälde, die Umsetzung eines Textes also in ein Bild,
bedeutet daher zugleich auch immer eine Interpretation.
Die künstlerische Rezeption von Goethes Werken war
sehr unterschiedlich. Lösen der Werther und der Götz im
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts eine lebhafte
Aneignung bei den Künstler-Zeitgenossen wie etwa
Daniel Chodowiecki und Franz Pforr aus, die diese
Werke als Quellen der nationalen Poesie ansahen, so
war die Aufnahme von Goethes klassischen Dramen
jedoch eher zurückhaltend. Die größte Wirkung auf die
bildenden Künste hat Goethes 1808 veröffentlichtes
Drama Faust I, insbesondere bei den Romantikern.
Peter Cornelius und Moritz Retzsch, doch auch
unbekanntere wie etwa Christian Julius Stieglitz oder
Johannes Riepenhausen warten mit zum Teil
eigenwilligen Interpretationen auf, die Bertsch als
Beispiele für Bild-Illustrationen anführt, die sich von der
bloß dienenden Funktion der Veranschaulichung des
Textes entfernten.
So gesellt letzterer Gretchen bei der ersten Begegnung
mit Faust noch einen Schutzengel bei; auch Mephisto
hat bei dieser Szene eigentlich nichts verloren.